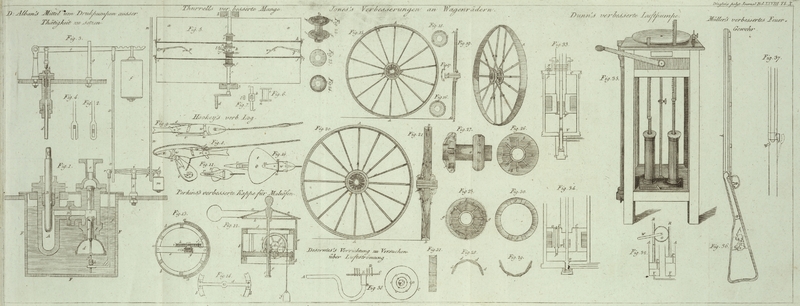| Titel: | Leichtes und sicheres Mittel, um Drukpumpen außer Thätigkeit zu sezen. Vorgeschlagen von Dr. Ernst Alban. |
| Fundstelle: | Band 28, Jahrgang 1828, Nr. CIX., S. 426 |
| Download: | XML |
CIX.
Leichtes und sicheres Mittel, um Drukpumpen außer
Thaͤtigkeit zu sezen. Vorgeschlagen von Dr. Ernst Alban.
Mit Abbildungen auf Tab.
X.
Alban's Mittel, um Drukpumpen außer Thaͤtigkeit zu
sezen.
Herr John
Potter empfiehlt in Gill's technical Repository N.
61Polytechn. Journal, Bd. XXIV. S.
309. eine, wie er meint, ganz neue Methode, die Wirkung einer Drukpumpe durch
Luͤftung des Saugventils zu hemmen. Da ich dieselbe bereits aber schon vor 8
Jahren an einer hydraulischen Presse anwandte, und in den vor 3 Jahren nach England
gebrachten Plaͤnen zu meiner neuen Dampfmaschine von sehr hohem Druke
weitlaͤufig mit beschrieben, auch durch eine Menge Zeichnungen fuͤr
verschiedene Anwendungen erlaͤutert habe, so erlaube ich mir der Neuheit der
Sache hiemit zu widersprechen, und nehme die Erfindung, wenn sie anders neu ist,
fuͤr mich in Anspruch.
Daß diese Methode entschiedene Vorzuͤge vor den bisher uͤblichen
Wirkungshemmungen der Drukpumpen, vorzuͤglich sehr stark wirkender habe, ist
nicht zu bezweifeln; denn
1) Es wird ganz erstaunlich wenig Kraft erfordert, um die Hemmung auf diese Weise zu
bewirken. Oft reichen wenige Loch hin, um das Saugventil, vorzuͤglich wenn
seine eigenthuͤmliche Schwere durch Vorrichtungen balancirt wird, zu heben
und in dieser Stellung zu erhalten. Dieser Umstand ist von ganz vorzuͤglichem
Werthe, wo nur wenige. Kraft zu einer sich selbst regulirenden Hemmung vorhanden
ist, wo man z.B. nur sehr kleine Schwimmer im Kessel und Generator anwenden kann,
oder die Hemmung durch sehr kleine Gouverneure oder Moderatoren bestreiten lassen
will. Die gewoͤhnlich uͤblichen Abschlußhaͤhne an den
Saugroͤhren muͤssen eine nicht ganz unbedeutende Groͤße haben,
um eine hinreichende Oeffnung fuͤr das aufgesogene Waͤsser zu geben,
und werden, so wie jeder Wasserhahn, leicht undicht, da die stete Einwirkung des
Wassers die Schmiere derselben bald entfernt und zerstoͤrt. Manche Wasser
enthalten aber auch saure oder erdige Bestandtheile, wovon erstere das Metall des
Hahns rauh fressen und ihn feststehend machen, waͤhrend leztere erdige
Concremente an denselben absezen und die Bewegung desselben theils erschweren,
theils der Dichtheit seines Ganges Schaden thun. Welche Gefahr aber das
Stekenbleiben eines solchen Hahns, vorzuͤglich wenn dieses im geschlossenen Zustande
desselben Statt findet, fuͤr einen Kessel bringen kann, ist aus meiner ersten
Abhandlung uͤber die Hochdrukmaschinen klar geworden.
2) Dampfmaschinen ersparen bei Anwendung dieser Hemmungsmethode und der dadurch
bewirkten Hemmung die Kraft, die zur Betreibung der Drukpumpe noͤthig ist.
Dieser Vortheil springt da recht in die Augen, wo bei Anwendung eines sehr hohen
Dampfdrukes die Bewegung der Drukpumpe einen nicht unbedeutenden Kraftverlust
bringt. Bei hydraulischen Pressen bewirkt sie waͤhrend des Eintritts ihrer
Wirkung sogar eine Ersparung beinahe des ganzen zur Betreibung derselben
noͤthigen Kraftaufwandes, waͤhrend der Druk in der Presse auf keine
Weise nachlaͤßt. Dieserhalb wuͤrde ihre Anwendung in den neuen
hydraulisches Pressen des Franzosen Hallette
Man vergl. Bullet. de la Soc. d'Encourag. etc. N.
272, S. 33. Polyt. Journ. B. XXIV. S.
473. viel guͤnstigere Resultate gewaͤhren, als der von ihm
erwaͤhlte Nothbehelf, wornach er bei eintretendem Maximum in der Wirkung des
einen oder anderen Preßcylinders das Wasser durch die Drukpumpe zum
Sicherheitsventile so lange herausdruͤken laͤßt, bis der Regulirhahn
die Wirkung dieser Drukpumpen auf einen anderen Punct leitet. Wie meine
Hemmungsmethode bei hydraulischen Pressen zwekmaͤßig anzubringen sey, davon
hernach.
3) Meine Hemmungsmethode vermeidet ferner die Bildung desjenigen schaͤdlichen
Vacuums unter dem Kolben oder Staͤmpel, das bei der Anwendung eines
Abschließhahnes an der Saugroͤhre waͤhrend des jedesmahligen Steigens
dieses Kolbens oder Staͤmpels hervorgebracht wird. Abgesehen von dem geringen
Kraftverluste, den die jedesmahlige Formirung eines solchen Vacuums in der Drukpumpe
bei der Bewegung derselben von Seiten der Maschine oder durch andere
Betriebskraͤfte herbeifuͤhrt, wird durch dieses Vacuum nicht selten
die Wirkung des Drukwerkes bei Wiedereroͤffnung des Hahnes auf
laͤngere Zeit gestoͤrt, vorzuͤglich wenn dasselbe, wie man so
haͤufig sieht, nicht richtig construirt ist. Man lasse mich hier etwas
deutlicher reden.
Wenn der Staͤmpel eines Drukwerkes, dieses moͤge nun mit einem soliden
ungeliederten Staͤmpel, einem in England sogenannten plunger, der durch eine Stopfbuͤchse arbeitet, oder mit einem
geliederten Kolben (piston)Beide Ausdruͤke werden von den meisten Mechanikern als gleich
bedeutend genommen. Waͤre es aber nicht zwekmaͤßiger, wenn man
Kolben fuͤr das englische Wort piston und
Staͤmpel fuͤr plunger gebrauchte?
so haͤtte man fuͤr jedes dieser beiden sehr verschiedenen
Organe doch auch eine bestimmte Benennung, was manchen Irrthum vermeiden
helfen moͤchte. – In der That bezeichnet aber auch der Ausdruk:
Staͤmpel sehr gut die dadurch
auszudruͤkende Sache, indem ein plunger
eine solide cylindrische Stange ist. Kolben sagt nach seiner
urspruͤnglichen Bedeutung so viel, als ein staͤrkerer Theil an
einem schwaͤcheren Stiele, woher das Wort Streitkolben,
Destillirkolben u.s.w. Ein solches Werkzeug ist aber wirklich auch ein piston an seiner Stange. – Der plunger arbeitet in einem ungebohrten Cylinder,
durch eine an einem Ende desselben angebrachte Stopfbuͤchse, er ist
also ohne Liederung, da diese in dem Cylinder enthalten ist und steht fest,
waͤhrend sie sich an einem piston mit
diesem bewegt. Lezterer (der piston) erfordert
daher einen gebohrten und genau ausgeschliffenen Cylinder, waͤhrend
er selbst weniger Akkuratesse in der Ausfuͤhrung noͤthig hat,
da nicht er, sondern seine Liederung seinen Gang dichtet.Um nun aber auch den Cylinder eines Staͤmpels von dem eines Kolbens zu
unterscheiden, da beide doch ihrer Construktion nach wesentlich verschieden
sind, so uͤberlasse ich es den Kunstverstaͤndigen zur
Pruͤfung, ob fuͤr ersteren nicht der Ausdruk: Stiefel sehr paßlich seyn moͤchte,
waͤhrend man fuͤr lezteren das Wort: Cylinder beibehaͤlt? – Ich moͤchte glauben,
daß auch diese Ausdruͤke fuͤr ihren Gegenstand eben so
bezeichnend sind, als Staͤmpel und Kolben fuͤr den ihrigen.
Cylinder deutet naͤmlich immer schon ein genauer gearbeitetes
Stuͤk an, als ein Stiefel, der (d.h. sein oberer Theil oder der
sogenannte Schaft) zwar auch roͤhrenartig gebaut, jedoch nichts
weniger als genau cylindrisch ist.Ich werde in meinen kuͤnftigen Maschinenbeschreibungen diesen meinen
Vorschlag beruͤksichtigen und bin uͤberzeugt, daß ich dadurch
oft kuͤrzer und verstaͤndlicher mich zu fassen Gelegenheit
finden werde. und einem gebohrten Cylinder versehen seyn, bei Schließung der Saugroͤhre,
waͤhrend seines Steigens, fortwaͤhrend ein Vacuum bilden muß, das
durch kein durch das Saugrohr aufsteigendes Wasser ausgefuͤllt wird, so
geschieht es haͤufig, daß bei einer nicht ganz luftdichten Liederung des
Staͤmpels oder Kolbens etwas Luft von oben vor der Liederung vorbei in den
Stiefel dringt. Diese LuftLuft kann auch durch einen undichten Hahn an der Saugroͤhre
fortwaͤhrend in die Pumpe gebracht werden. haͤlt sich dann bei wieder aufgehobener Hemmung des Spiels der Pumpe
haͤufig eine zeitlang unter ihrem Kolben oder Staͤmpel, und verhindert
ein gehoͤriges Saugen derselben, wodurch ihre Arbeit nicht selten auf mehrere
Minuten und oft noch weit laͤnger unterbrochen wird, ja wohl ganz und gar
unterbleibt, wenn der Staͤmpel nach der Hallette'schen Methode, d.h. mit einfachem LederringeMan sehe am angefuͤhrten Orte (im Bulletin
und polytechn. Journale) nach. geliedert ist, bei welchem der Luft der Eintritt in den Stiefel der Pumpe
verstattet, der Zuruͤktritt aber abgeschlossen ist. Bei
Staͤmpel- (plunger) Pumpen wird dieser
Nachtheil um so fuͤhlbarer, wenn das in die Ventilbuͤchse
fuͤhrende Seitenrohr am unteren Theile des Stiefels angebracht ist, so daß
die eingedrungene Luft durch dieses nicht entweichen kann. Dieserhalb kann man beim
Bau solcher Pumpen nicht vorsichtig genug seyn. In der Folge werde ich Gelegenheit
haben, hieruͤber bestimmte Regeln aufzustellen.
4) Meine Hemmungsmethode ist endlich hoͤchst einfach, indem sie weiter keine
besondere Einrichtung, als eine Verlaͤngerung des Stiels der Saugvalve durch
ein kleines duͤnnes Staͤngelchen verlangt, auf welches eine in den
Wasserhaͤlter der Pumpe herabreichende Hebstange wirkt. Diese Einrichtung ist
nicht allein weit leichter als ein Hahn hergestellt, sondern auch von jedem
gewoͤhnlichen Arbeiter ohne Aufwand von Geschiklichkeit vollendet.
Auf Tab. X. Fig.
1. habe ich eine Drukpumpe bester Construktion dargestellt. Sie besteht
aus dem Drukstiefel, A. In demselben arbeitet der genau
abgedrehte und polirte Staͤmpel, B, am besten von
weichem Messing oder Kupfer,Bei groͤßeren Pumpen wuͤrde ein solider kupferner
Staͤmpel zu kostspielig werden, darum nimmt man einen eisernen, den
man mit einer duͤnnen Huͤlse von Kupfer uͤberzieht.
Diese Huͤlse wird mit weichem Schlagelothe zusammengeloͤthet,
uͤber den eisernen Staͤmpel geschoben und beide nun durch
einen Ring gezogen, wobei sich die kupferne Huͤlse genau an den
eisernen Staͤmpel anlegt und unzertrennlich mit demselben verbindet.
Der Staͤmpel braucht dann nicht weiter gedreht und polirt zu werden,
weil er durch das Ziehen durch den Ring gehoͤrige Rundung, gleiche
Dike und Politur erhaͤlt. Massiv kupferne Staͤmpel
muͤssen beim Abdrehen immer mit Milch befeuchtet werden, dann
erhaͤlt man gleiche Spaͤne und hat kein Hoppern des Meißels zu
befuͤrchten. um das Rosten zu verhuͤten, gebaut. Er hat oben einen
schwaͤcheren Theil, woruͤber die Huͤlse der Zugstange greift,
und mit einem Keil befestigt wird. a, ist die
Stopfbuͤchse, die den Gang des Staͤmpels dichtet, C, die Ventilbuͤchse, die durch das
Communicationsrohr, D, mit dem Drukstiefel in Verbindung
steht. In dem oberen Theile der Buͤchse befindet sich das Entleerungs-
oder Drukventil, b, in einer an der Buͤchse
angeschrobenen Roͤhre, E, aber das Saugventil,
C. Das untere Ende dieses Rohres ist mit einem
kupferneu Seiher, d, versehen. Ueber der Buͤchse
ist die Steigroͤhre, e, angeschroben, die
uͤber dem Ventile eine Erweiterung hat, damit das aus dem Ventile, b, kommende Wasser gehoͤrig in dieselbe treten
kann. Die Ventile sind gewoͤhnliche Kegelventile mit einem dreiekigen Stiele,
der ihnen die Leitung gibt.
Die Vorrichtung zum Oeffnen des Ventils, wie ich sie vorschlage und zum Theil schon
angewandt habe, besteht in der Hebstange, f, die
senkrecht in den Wasserkasten dringt. Sie biegt sich unter dem Seiher horizontal um,
und trifft hier auf das Staͤngelchen, g, das in
den Stiel des Saugventils, c, eingeschoben ist und durch
eine Oeffnung des Seihers, d, geht, in welcher es
zugleich einige Leitung findet. Der horizontale untere Theil der Hebstange hat ein
Loch, zur Aufnahme des Staͤngelchens, g, und
vermag sich damit frei an demselben auf und nieder zu bewegen, ohne auf das Ventil
zu wirken. Um eine Luͤftung des Staͤngelchens mit dem Saugventile
durch die Hebstange zu bewirken, ist auf erstere eine Art Knopf, h, geschoben und festgekeilt. Gegen diesen stoͤßt
die Hebstange bei ihrer Hebung. Der Knopf muß von dem Staͤngelchen entfernt
werden koͤnnen, wenn das Ventil aus der Ventilbuͤchse herausgenommen
werden soll.Das Knoͤpfchen auf die Stange zu schrauben, widerrathe ich, weil es
sich
auf der Schraube leicht drehen und seinen richtigen Plaz veraͤndern
kann, auch der horizontale Arm der Stange, f,
bei dem Auf- und Niedergleiten auf dem unter dem Knopfe befindlichen
Ende des Staͤngelchens, g, einigen
Widerstand an einem darauf geschnittenen Gewinde finden moͤchte.
Die Stange, f, steht außerhalb des
Wasserbehaͤlters, F, der Pumpe mit einem kleinen
Balancier, i, in Verbindung, der sich auf der
Stuͤze K, bewegt. Dieser ist bei, e, mit einem Gewichte, m,
belastet, dessen Schwere so berechnet ist, daß es die Stange, g, mit dem Saugventile vereinigt aufwiegt, und bei der Arbeit der Pumpe
das sich geluͤftet habende Ventil, c,
geoͤffnet erhalten kann. n, ist eine
Regulirstange, die von dem Gouverneur einer Dampfmaschine, oder von einem mit einem
Schwimmer des Dampfkessels verbundenen Hebel kommt. Sie hat unten einen Schliz, der
in Fig. 2.
besonders abgebildet ist. Mit diesem greift sie bei, o,
uͤber das mit dem Gewichte beschwerte Ende des kleinen Balanciers und wird
hier durch 2 kleine durch denselben gehende Stifte, p,
und, q, in ihrer Lage so erhalten, daß sie keine
Seitenbewegung auf demselben machen kann. Der Schliz schiebt sich leicht an dem
Balancier auf und nieder, ohne ihn zu bewegen. Die Regulirstange, n, ist mit dem Gouverneur oder Schwimmer in der Art
verbunden, daß sie sinkt, wenn die Kugeln des ersteren bei zu großer Geschwindigkeit
der Maschine abspringen oder der Schwimmer faͤllt (was durch eine
Hebelcommunication leicht zu bewerkstelligen ist). In beiden Faͤllen aber
senkt sich dann der untere Rand ihres Schlizes, worauf der Balancier ruhte, dieser
wird frei und das Gewicht luͤftet das Saugventil, c, worauf die Arbeit der Pumpe so lange unterbrochen wird, bis die
Regulirstange sich wieder hebt, der untere Rand ihres Schlizes das Gewichtsende des
Balanciers aufzieht, und dadurch die Saugvalve wieder sinken laͤßt. Ein zu
starkes Heben der Regulirstange und des Gewichtsendes des Balanciers kann nicht
nachtheilig fuͤr das Ventil werden, weil der horizontale Arm der Stange, f, nach unten Spielraum genug auf dem
Staͤngelchen, g, des Ventils hat.
Anmerkung.
Es mag manchem Mechaniker auffallen, warum ich die Stange, f, nicht gleich Regulirstange seyn lasse, und wozu ich die Anordnung des
Balanciers und des Gewichts getroffen habe. Hier meine Gruͤnde: da wo die
Wirkung auf die Stange, f, ploͤzlich und mit
einer gewissen Energie erfolgt, wie es wohl bei dem Gouverneur einer Dampfmaschine
oder der von mir gleich zu beschreibenden Vorrichtung einer hydraulischen Presse
geschieht, wuͤrde, wenn der Act dieser ploͤzlichen und energischen
Wirkung waͤhrend des Druͤkens des Drukstaͤmpels der Pumpe, wo
das Saugventil durch die in dieselbe gedruͤkte Fluͤßigkeit gewaltsam
geschlossen gehalten wird, eintraͤte, die Stange, g, leicht gebogen und dadurch fuͤr die Folge unthaͤtig gemacht werden
koͤnnen, was fuͤr die Sicherheit des ganzen Hemmungsapparates und
seiner Wirkung von hoͤchst nachteiligen Folgen seyn kann. Bei der Anordnung
des Balanciers mit dem Gewichte ist die Wirkung auf die Stange aber allein von
diesem Gewichte abhaͤngig, und dieses oͤffnet das Saugventil nur beim
Saugen der Pumpe, also in einem Augenblike, wo dieses Oeffnen schon von selbst durch
das Saugen des Staͤmpels bewirkt wird, es kann also hier nie ein gewaltsamer
Zug an der Stange, f, Statt finden. Die Regulirstange
hebt nur die Hemmung in der Wirkung des Gewichtes auf, und ihre Action mag so
schnell und so kraftvoll eintreten, als sie will, die das Saugventil
oͤffnende Ursache bleibt deshalb immer dieselbe.
Bei hydraulischen Pressen kann das Luͤften des Saugventils durch eine sehr
einfache Vorrichtung bewirkt werden, die zugleich als Anzeiger des Maximums in der
Wirkung der Presse zu benuzen ist. Sie ist mit dem inneren Raume des Preßcylinders
oder der Preßcylinder, wenn mehrere angewandt werden, durch eine kleine
Roͤhre in Verbindung gesezt und in Fig. 3. abgebildet. a, ist hier ein kleiner Cylinder, worin sich ein
Staͤmpel, b, in einer Stopfbuͤchse, c, dicht bewegt. Der innere Raum des Cylinders ist mit
dem des Preßcylinders durch eben genannte Roͤhre, d, verbunden, so daß die in jenem wirkende Fluͤßigkeit auch ihre
Wirkung auf den kleinen Staͤmpel zu aͤußern vermag. Dieser
Staͤmpel ist durch eine kleine Verbindungsstange und einem doppelten
Scharnier mit dem Hebel, e, verbunden, der ein
Stellgewicht, f, nach Art eines Sicherheitsventils hat.
Der Durchmesser des Staͤmpels, die Laͤnge des Gewichtshebels und die
Schwere des Stellgewichtes muͤssen zusammen so berechnet seyn, daß der
Staͤmpel beim Eintritt des Normaldruks in der Presse den Hebel mit dem
Gewichte zu luͤften beginnt. Bei, g, ist eine
Stuͤze mit einem Schliz, worin der Hebel theils Leitung gewinnt, theils aber
auch zugleich am zu starken Sinken und Steigen gehindert wird, indem er in beiden
Faͤllen gegen den oberen und unteren Rand des Schlizes anstoͤßt. Durch
Stellung des Gewichts kann zugleich der beruͤhrte Normaldruk in der Presse
beliebig modificirt werden. Von dem Gewichtshebel fuͤhrt die Regulirstange,
x, zu dem Stangenende, r, des kleinen Balanciers der ersten Figur, und faßt uͤber diesen mit
einem unten offenen Schlize. Sie wird ebenfalls durch zwei Stifte am Balancier vor
Seitenschwankungen auf demselben bewahrt. In Fig. 4. ist der Schliz
dieser Regulirstange besonders abgebildet.
Die Wirkung dieser Vorrichtung ist folgende: wenn das Maximum des Druks der
Fluͤßigkeit in dem Preßcylinder eintritt, beginnt der Staͤmpel, c, in dem kleinen Cylinder, a, sich zu heben und luͤftet den Hebel mit dem Stellgewichte, wobei der Schliz in der
Stuͤze, f, das weitere Emporsteigen hindert, der
Hebel aber zieht die Regulirstange in die Hoͤhe, so daß der obere Rand des
Schlizes den Balancier, den er niedergedruͤkt hielt, frei macht, worauf das
Gewicht am anderen Ende desselben zur Luͤftung der Saugvalve seine Action
beginnt. Laͤßt der Druk der Fluͤßigkeit in den Preßcylindern etwas
wieder nach, wie es z.B. beim Pressen von Oehlsamen geschieht, der beim Heraustreten
des Oehls sich etwas zusammenzieht, so faͤllt augenbliklich der
Staͤmpel mir dem Hebel und der Regulirstange, und hebt die Wirkung des
Balanciergewichts wieder auf, worauf die Drukpumpe so lange wieder arbeitet, bis der
Normaldruk von neuem eingetreten ist. Dieser Vorgang wird sich ohne alles Mitwirken
des Aufsehers der Presse so oft wiederholen, bis keine Verminderung des Normaldruks
mehr Statt finden kann, wo dann die Drukpumpe fuͤr immer außer Arbeit gesezt
bleibt, wenn der Aufseher nicht den Druk in dem Arbeitscylinder der Presse aufhebt.
Bei Anwendung dieser Vorrichtung kann keine Gefahr durch Uebertreibung des
Normaldruks in der Presse entstehen, und dadurch eine Beschaͤdigung oder
Sprengung derselben herbeigefuͤhrt werden, selbst wenn der Aufseher sich um
dieselbe nicht bekuͤmmert. Sollte es einem Fabrikunternehmer darum zu thun
seyn, fuͤr den Aufseher irgend ein hoͤrbares Zeichen des eingetretenen
Normaldruks in der Presse zu haben, so ließe sich leicht die Einrichtung treffen,
daß der sich luͤftende Gewichtshebel einen Glokenzug in Bewegung sezte. Eine
solche Einrichtung wird aber jeder Maschinenbauer ohne besondere Anleitung zu machen
verstehen.
Indem ich diese Vorrichtung bloß ihrem Principe nach, wie ich hoffe, deutlich genug
angegeben habe, darf ich uͤberzeugt seyn, daß jeder Maschinenbaumeister die
Anwendung derselben nach allen besonderen Faͤllen zu modificiren verstehen
wird.
Diejenige hydraulische Presse, die ich vor 8 Jahren fuͤr eine
Oehlmuͤhle baute, und die jezt noch der Hr. Kaufmann Karnatz in Rostock zum Pressen des
Senfes gebraucht, besaß die Hemmungsvorrichtung der Drukpumpe in der Art, daß der
Presser oder Aufseher sie vermittelst der Hand in Bewegung sezte, sobald er
bemerkte, daß ein kleines Rohr zu sprizen anfing, was das aus dem Sicherheitsventile
kommende Oehl (ich gebrauchte in dieser Presse als fluͤßiges Medium
naͤmlich Oehl statt Wasser) in einen Trichter fuͤhrte, der es in den
Reservoir der Drukpumpe zuruͤkleitete. Die Anordnung war fuͤr den
Presser so getroffen, daß er die Luͤftung des Saugventils von demjenigen
Tische aus bestreiten konnte, worauf er den Oehlsamen in die Haartuͤcher zu
thun beschaͤftigt war. Zu dem Ende ging die das Ventil luͤftende
Stange bis an die Deke des Oehlmuͤhlenlocals, und war hier an dem einen Ende
eines leichten Balancier von Holz eingelenkt, der bis uͤber den besagten
Tisch reichte, und von seinem entgegengesezten Ende eine Stange zu diesem Tische
herabschikte, an welcher ein Gewicht durch seine Schwere die Luͤftung des
Saugventils in der Art besorgte, wie es in Fig. 1. geschieht. Wollte
der Arbeiter die Wirkung der Drukpumpe wieder erneuern lassen, so bewegte er nur den
Hebel einer kleinen Welle uͤber dem Tische, die durch einen kleinen Hebdaumen
die Gewichtsstange wieder emporhob.
Stubbendorf im Monate November 1827.
Tafeln