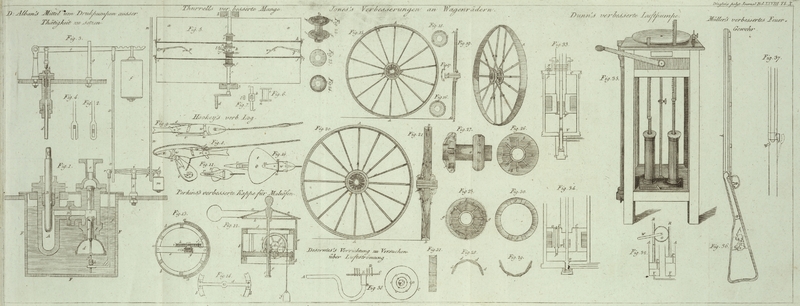| Titel: | Verbesserung an Wagenrädern, worauf Theod. Jones, Accountant in Coleman-Street, City of London, sich am 11. October 1826 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 28, Jahrgang 1828, Nr. CXVII., S. 444 |
| Download: | XML |
CXVII.
Verbesserung an Wagenraͤdern, worauf
Theod. Jones, Accountant
in Coleman-Street, City of London, sich am 11.
October 1826 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent Inventions. Mai 1828. S.
279.
Mit Abbildungen auf Tab.
X.
Jones's Verbesserung an Wagenraͤdern.
Diese Erfindung besteht in einem solchen Baue der
Raͤder, daß das Gewicht, welches sie zu tragen haben, an dem oberen Theile
des Rades haͤngt, und nicht wie gewoͤhnlich von den Speichen, die sich
unter der Achse befinden, getragen wird.
In der Zeichnung stellt Fig. 15. einen
Seitenaufriß meiner verbesserten Raͤder mit einer einfachen Reihe von
Haͤngestangen dar, wie ich die Speichen in diesem Rade nennen will. A, A, ist ein starker Reif aus geschlagenem Eisen oder
aus irgend einem anderen schiklichen Material, welchen ich, da er die Stelle der
Felgen und des Reifes zugleich vertritt, den Rand nennen will. Dieser Rand kann
entweder ein flacher Reif, oder wie er hier dargestellt ist, innenwendig mit einer
Rippe versehen seyn, damit er staͤrker wird. Durch diesen Rand laufen
vierzehn kegelfoͤrmige Loͤcher, die gleichweit von einander entfernt
sind: sie sind hier, durch punctirte Linien angedeutet, und eines derselben ist mit,
a, bezeichnet. G, ist
die Buͤchse. F, F, die Nabe, an welcher die Kappe
oder der Schild abgenommen ist, um den Bau derselben deutlicher zu zeigen. Die Nabe
enthaͤlt vierzehn Waͤnde oder Abtheilungen, wovon eine mit, f, bezeichnet ist: diese Waͤnde theilen sie in
eben so viele Faͤcher oder Zellen, und sie ist, sammt der Buͤchse, aus
Einem Stuͤke aus Gußeisen oder aus irgend einem anderen schiklichen Metalle.
B, ist eine Haͤngestange aus geschlagenem
Eisen oder aus einem anderen schiklichen Metalle mit einem kegelfoͤrmigen
Kopfe, der genau in das fuͤr ihn in dem Rande gebohrte Loch paßt: das andere
Ende bildet eine Schraube. Diese Stange fuͤhre ich durch das Loch, a, in dem Rande und dann durch ein correspondirendes
Loch in der Nabe, so daß das Ende mit der Schraube in die fuͤr dasselbe
vorgerichtete Zelle eindringt. Wenn nun auf diese Schraube das Niet, D, aufgeschraubt wird, so ist diese Haͤngestange
an ihrer Stelle. Die uͤbrigen dreizehn Hangestangen werden auf dieselbe Weise
eingesezt.
Fig. 16.
zeigt die Platte, welche ich den Schild nenne; er ist aus Gußeisen oder aus anderem
schiklichen Metalle, und wird mittelst Schrauben vorne an der Nabe befestigt, damit
die Niete sich nicht drehen koͤnnen, wenn sie an ihrer Stelle eingeschraubt
sind.
Fig. 17. ist
ein senkrechter Durchschnitt desselben Schildes, und Fig. 18. zeigt den Schild
von innen. Die Theile, h, h, kommen damit in
Beruͤhrung, und ruhen auf einer der flachen Seiten eines jeden Nietes,
wodurch das Lokerwerden oder Abschrauben derselben vollkommen gehindert wird. Die
Loͤcher in der Nabe sind groß genug, um die Haͤngestangen frei
durchzulassen, und die Niete, welche auf die Haͤngestangen aufgeschraubt
werden, haben Raum genug, um in ihre Zellen zuruͤk zu schluͤpfen. Die
Haͤngestangen haben keine Schultern gegen die Außenseite der Nabe, und ihre
Schrauben laufen nicht so weit durch die Niete in ihre Zellen, daß sie die
Buͤchse beruͤhren, und ihr Zuruͤktreten gehindert
wuͤrde. Es ist naͤmlich dieß das Eigene an meinet, verbesserten
Raͤdern, daß die Stangen, die unter der Achse sich befinden, sich so in ihre
Zellen zuruͤkziehen, daß sie nie einem Druke ausgesezt sind, und die Folge
hiervon ist, daß das ganze Gewicht, das auf der Achse in der Buͤchse, G, ruht, mittelst der oberen Stangen an jenem Theile des
Rades aufgehaͤngt erhalten wird, der waͤhrend der Umdrehungen des
Rades immer der oberste ist. Fig. 19. ist ein
Durchschnitt von Fig. 15. nach der punctirten Linie, A, A. In
dieser Figur ist, A, A, der Rand; B, ist eine duͤnne Wand auf dem kegelfoͤrmigen Kopfe der
Stange, die in einen correspondirenden Spalt in der Seite des kegelfoͤrmigen
Loches in dem Rande paßt, und so die Stange hindert, sich zu drehen, wenn das Niet
an ihrem anderen Ende aufgeschraubt wird. F, ist die
Nabe. G, die Buͤchse.
Fig. A, Tab. X. ist ein
groͤßeres Rad nach meiner verbesserten Methode mit einer doppelten Reihe von
Haͤngestangen fuͤr Lastkarren, welche staͤrkere Raͤder
fordern. G, G, in Fig. 22. ist die
Buͤchse, welche aus Einem Stuͤke gegossen ist, mit zwei Naben oder mit
zwei Reihen von Zellen, F, F, und, f, f, welche dieselbe umgeben.
Fig. 20. ist
ein Aufriß dieses Rades von der Seite, an welchem der Schild vorne an der Nabe
abgenommen ist. A, A, ist der Rand mit
kegelfoͤrmigen Loͤchern, in welche die Stangen kommen; D, D, sind acht Niete, die auf den Enden der
Haͤngestangen, B, B, aufgeschraubt sind: die
anderen acht Haͤngestangen, C, C, sind mittelst
Nieten in der Hinteren Nabe befestigt. f, f, sind acht
Waͤnde, die die vordere Nabe in acht Zellen theilen: die Hintere Nabe hat
eben so viele Zellen. In der Perspectivzeichnung, Fig. 22., sieht man, daß
die Loͤcher fuͤr die Haͤngestangen an der vorderen Nabe nicht
den Loͤchern in der anderen Nabe gegenuͤber stehen, sondern
abwechselnd mit denselben angebracht sind, so daß z.B., K, zwischen, L, und, M, zu stehen kommt.
Fig. 21. ist
ein Durchschnitt von Fig. 20. durch die
punctirte Linie, A, A. Diese Figur zeigt bei, B, den kegelfoͤrmigen Kopf der Stange mit der
duͤnnen Wand, die in einen correspondirenden Spalt in dem Rande paßt, um die
Stange, wie oben bemerkt wurde, vor dem Umdrehen zu schuͤzen. Man muß auch
bemerken, daß der obere Theil der Zelle, f, f, unter
einem rechten Winkel auf die Stange, B, steht, um dem
Niete, D, ein schoͤnes Lager darzubieten: dieß
gilt uͤbrigens auch von allen anderen Zellen. Die Stellung der Stangen, B, C, B, C, so wie sie abwechselnd mit der vorderen und
Hinteren Nabe in Verbindung stehen, sieht man besser in der Zeichnung, A.
Fig. 23.
zeigt den Schild fuͤr die vordere Nabe von außen, wie oben.
Fig. 24.
zeigt denselben Schild von innen. Ein aͤhnlicher Schild ist auch fuͤr
die Hintere Reihe von Nieten noͤthig, damit sie sich nicht abschrauben
koͤnnen, und wird auf dieselbe Weise befestigt.
Die Methode, die mir am besten bei Verfertigung der Buͤchse und Naben an
meinen Raͤdern scheint, ist folgende Verbindung des Guß- und geschlagenen Eisens. Fig. 25. zeigt
bei, a, a, eine Endansicht der Buͤchse, auf
welcher ein breiter Ranft, b, und zugleich die acht
Waͤnde, c, c, in gleicher Entfernung rings umher
in der Buͤchse gegossen sind, so daß sie den Raum in Zellen theilen, die zur
Aufnahme der Nieten bestimmt sind, wie in Fig. 20.
Fig. 25. gibt
eine aͤhnliche Ansicht der Buͤchse, a, a,
und der Waͤnde, c, c, sammt dem Rande, b. d, d, d, d, ist ein Ring aus geschlagenem Eisen,
dessen innerer Theil auf einer Doke in ein Achtek, dddd, und, eeee, ausgebildet ist. Acht
kleinere Seiten wechseln mit den groͤßeren, zwischen welchen sie sich
befinden; diese kleineren Seiten passen mit den Enden der Radialwaͤnde, und
da die Radialwaͤnde nach innen sich schief abdachen, wie man in der
Seitenansicht Fig.
27. bei, c, c, sieht, so muß dieser achtekige
Ring in zwei Theile getheilt werden, wie Fig. 28. und 29. zeigt.
Wenn diese beiden Haͤlften, d, d, d, d, auf den
Ranft, b, aufgesezt werden, so daß sie die Waͤnde
umfassen, die in Fig. 26. dargestellt sind, wird der Ring aus geschlagenem Eisen, g, g, in Fig. 30. (nachdem er
vorlaͤufig dem achtekigen Ringe angepaßt wurde, der außen cylindrisch ist)
roth gluͤhend gehizt, und uͤber die beiden Haͤlften des
achtekigen Ringes geschoben, wo er dann bei dem Erkalten sich zusammenzieht, und
folglich alle Theile fest zusammenhaͤlt, so daß genau solche Zellen
entstehen, wie in den Naben aus Gußeisen Fig. 20., 21., 22. Die punctirte Linie,
g, g, Fig. 25., zeigt die Lage
des aͤußeren Ringes. Wenn alles zusammengefuͤgt ist, werden die
Loͤcher fuͤr die Haͤngestangen durch beide Ringe durchgebohrt,
wie die punctirten Linien in Fig. 26. zeigen.Wir sehen sie nicht im Originale. A. d. U.
Fig. 27.
zeigt die Buͤchse, a, a, von der Seite, wo, d, und, g, die beiden Ringe
aus Eisen sind (im Durchschnitte), wie sie uͤber einander liegen, und ihre
Verbindung mit den Waͤnden deutlicher dargestellt ist.
Fig. 31,
zeigt den achtekigen Ring in einer seiner Haͤlften von innen, wie dieselbe
mit jenem Stuͤke, das in Fig. 27. als an seiner
Stelle (im Durchschnitte) aufgelegt ist, correspondirt. f, zeigt den Schild, der dem bereits beschriebenen aͤhnlich ist, im
Durchschnitte, und, m, zeigt die Hintere Nabe ganz von
außen.
Meine Verbesserung besteht demnach darin, die Last von den unter der Achse
befindlichen Speichen wegzunehmen, und von den daruͤber befindlichen Stangen
tragen zu lassen.
Bemerkungen des
Patenttraͤgers.
Wer immer mit Wagen viel zu thun hat, kennt die Maͤngel der
gewoͤhnlichen hoͤlzernen Raͤder, die theils von den Fehlern im
Baue derselben, theils von der Hinfaͤlligkeit des Holzes
herruͤhren.
Gegenwaͤrtiges Patentrad soll, nach den mit demselben angestellten Versuchen,
diesen Fehlern und Maͤngeln abhelfen.
Dieses Patentrad ist ganz aus Eisen, und das Gelingen desselben haͤngt
hauptsaͤchlich von dem Umstaͤnde ab, daß das Eisen hier so angewendet
ist, daß es nur durch seine Spannung wirken kann, folglich auf die vortheilhafteste
Weise.
Daß dieser Schluß richtig ist, erhellt aus der durch Versuche erwiesenen Thatsache,
daß ein duͤnner Draht das groͤßte Gewicht zu halten vermag, und daß
man an einer eisernen Stange von einem Quadratzoll im Durchschnitte 28 Tonnen (die
Tonne zu 2000. Pf.) aufzuhaͤngen vermag.
An den hoͤlzernen Raͤdern muͤssen die Speichen unter der Nabe
die Last tragen, waͤhrend an diesen Raͤdern eiserne Stangen statt
dieser Speichen die Last so in die Hoͤhe halten, daß sie gleichfoͤrmig
auf alle Stangen vertheilt wird, und dieß zwar an dem oberen Theile des Rades.
Durch diesen Bau des Rades erhaͤlt dasselbe eine außerordentliche
Staͤrke; das Materiale desselben ist ohne Vergleich dauerhafter, als Holz,
und das Rad selbst bekommt dadurch eine leichte und elegante Form. Diese
Raͤder bilden ferner vollkommene Walzen: eine Vollkommenheit im Baue
derselben, die bisher noch nie in diesem Grade erreicht wurde, obschon die Vortheile
dieser Cylinderform so allgemein anerkannt sind, daß in Folge eines
Parliamentsactes, 3. Georg IV. Cap. 126. Sec. 9. alle Zoͤllner auf allen
Straßen ermaͤchtigt sind, den Zoll in allen Faͤllen, wo Raͤder
und Achsen vollkommen walzenfoͤrmig sind, auf 2/5 herabzusezen.
Die Vortheile bei diesen Raͤdern sind folgende:
1) eine bedeutende Ersparung, indem sie nur um etwas weniges theurer zu stehen
kommen, als die gewoͤhnlichen hoͤlzernen Raͤder, dafuͤr
aber weit laͤnger dauern, als diese, theils ihres Baues, theils ihres
Materiales wegen, das der Witterung und der Naͤsse, und in warmen
Laͤndern den Insecten weit besser zu widerstehen vermag, als das Holz.
2) Koͤnnen sie, sowohl dem Materiale als dem Baue nach, jede beliebige
Staͤrke erhalten, und jedes andere Rad an Staͤrke uͤbertreffen.
Sie lassen sich leicht ausbessern, und jeder einzelne Theil kann, ohne daß die
uͤbrigen dadurch litten, ausgebessert werden. Man gewinnt ferner auch an
Material: denn, wenn das Rad auch bereits gaͤnzlich abgenuͤzt ist, hat
es noch den Werth des alten Eisens, waͤhrend ein abgenuͤztes
hoͤlzernes altes Rad, buchstaͤblich genommen, keinen Schilling werth
ist. Dieß ist bei Unternehmungen, die viele Raͤder nothwendig machen, eine
Sache von Wichtigkeit.
3) Erleichtert die rein cylindrische Form dieser Raͤder den Zug der Pferde
ungemein, und Geschirr und Straße leidet weniger.
4) An diesen Wagen drehen sich die Achsen, und die Raͤder sind ohne Schrauben
und Lohnnaͤgel an denselben befestigt. Da sie auf einer breiteren Basis
stehen, so ist die Gefahr des Umwerfens geringer.
5) Lassen sie sich leichter schmieren: dieß darf hoͤchstens zwei oder drei
Mahl im Jahre geschehen, und das Rad darf hierzu nicht abgenommen werden, wie es bei
hoͤlzernen Raͤdern haͤufig der Fall ist.Das Register of Arts lobt diese
Patentraͤder, die der Redacteur desselben an verschiedenen Fuhrwerken
angebracht sah, ungemein. Was wir bei denselben fuͤrchten, ist der
Rost, der sich hoͤchstens an solchen Raͤdern fuͤr
elegante Kutschen, durch Plattirung verhuͤten laͤßt. Auch
besorgen wir, daß diese eisernen Raͤder auf dem Pflaster stark
brummen werden. A. d. U.
Tafeln