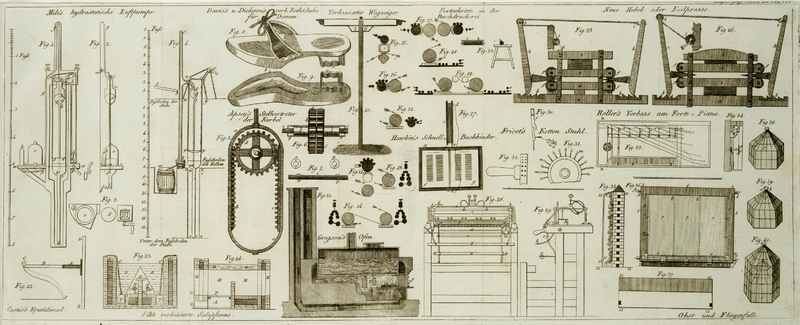| Titel: | Neue hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben, Hähne, Klappen und Stöpsel, erfunden und beschrieben von J. Mile, Professor an der königl. Universität in Warschau. |
| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. I., S. 1 |
| Download: | XML |
I.
Neue hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben,
Haͤhne, Klappen und Stoͤpsel, erfunden und beschrieben von J. Mile, Professor an der
koͤnigl. Universitaͤt in Warschau.
Aus A. v. Drake's polnischen Miszellen. Bd. 1. S.
162.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Mile's neue hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben, Haͤhne,
Klappen und Stoͤpsel.
In der von mir veraͤnderten Luftpumpe vertritt Queksilber die Stelle des
Kolbens, und in dieser Hinsicht ist sie nicht neu, in dem bereits Swedenborg, Baader und Hindenburg erstens dabei angewandt haben.Gehler physikalisches Woͤrterbuch 1790: V.
596. III. 79 und 81. Dadurch aber unterscheidet sie sich wesentlich von anderen, daß bei ihr gar
keine mechanischen Vorrichtungen angebracht sind. Swedenborg gebrauchte bei der seinigen Klappen, Baader und Hindenburg Haͤhne, die
meinige aber besteht in einer einfachen Vereinigung von Roͤhren, worin das
Queksilber allein die Dienste des Kolbens, der Klappen, Haͤhne und
Stoͤpsel vertritt. Ich habe sie in den Jahrbuͤchern der
koͤnigl. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften in Warschau, im XVI. Bd.
v. J. 1823, und eine Verbesserung derselben im XVII. Bd. v. J. 1824 beschrieben.
Spaͤterhin ist mir die Beschreibung der Rommershausischen MaschineArchiv fuͤr die gesammte Naturlehre von Kastner. Bd. II. H. 3. 1824. und einer zweiten von Oechsle verbessertenObiges Archiv u.s.w. Bd. V. H. 3. 1825. Beschreibung einer großen
Queksilber-Luftpumpe, welche sich im physikalischen Kabinet zu
Karlsruhe befindet, vom Prof. Wucherer. bekannt geworden. Lezterer bedient sich eines Kolbens, um das Queksilber zu
heben, wie ich dasselbe auf die naͤmliche Weise zwei Jahre fruͤher
gebrauchte, sodann aber diese Methode als unzwekmaͤßig verwarf. Auch
gebraucht er, wie alle anderen, zwei Haͤhne, von denen der eine dazu dient,
die Luft aus dem Recipienten hinauszulassen, der andere, sie wiederum aus der Gloke
in den Recipienten hineinzulassen. Diese Maschine hat also nichts Besonderes vor den
anderen voraus, und wegen der Haͤhne, die man aufmerksam drehen muß, ist sie
complicirt. Uthe hat eine der Rommershausischen ganz
aͤhnliche Pumpe beschrieben und sie fuͤr seine eigene fruͤher
erfundene ausgegeben.Die hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben und Ventile, im polyt. Journ. von
Dingler. Juli 1825. S. 272. An beiden ist ein Hahn noͤthig, der aͤußerst fleißig
ausgefuͤhrt seyn
muß, da sich auf ihm die ganze Maschine dreht; der Erfinder sagt selbst, daß hier
alles aus Stahl und sorgsam gearbeitet seyn muß. Bei meiner Maschine ist der Hahn
entbehrlich, nur muͤssen die Roͤhren fest zusammengekittet seyn, und
außerdem nichts mehr. Sie ist keine Kabinetsraritaͤt, und kann in der Technik
angewandt werden, weil man durch sie mit leichter Muͤhe die Luft in so großer
Menge verduͤnnen kann, wie durch keine andere.
Aus diesem Grunde denke ich, waͤre es nicht uͤberfluͤssig, dem
Auslande hier die Beschreibung meiner Luftpumpe mitzutheilen. Ihre Einrichtung
erklaͤren die Figuren auf der hier beigefuͤgten Tafel, von denen die
erste die Maschine von vorn, die zweite von der Seite und die dritte in horizontalem
Durchschnitte nach der Linie, x, x, vorstellt. Dieselben
Theile sind in allen Figuren mit denselben Buchstaben bezeichnet.
Das Hauptbehaͤltniß, in dem der Wechsel der Ausdehnung und
Zusammendruͤkung der Luft geschehen soll, ist ein Cylinder oder die Kugel,
a, die in die Rohre, b,
b, welche unten geoͤffnet ist, uͤbergeht. In dem oberen
Theile dieser Kugel sind zwei Roͤhren, g, g, und,
h, h, eingekittet, deren Durchmesser
ungefaͤhr eine Linie betraͤgt. Die Roͤhre, g, g, muß bis in den Hals der Kugel, a, reichen; sie hebt sich in die Hoͤhe, beugt
sich dann wieder nach unten, und ist mit der auf dem Teller aufgestellten Gloke, o, und mit der Barometerprobe, k, verbunden. Die zweite Roͤhre, h, h,
aber darf nicht in die Kugel hineinreichen, und braucht nur auf dem Halse derselben
aufgekittet zu werden, damit die lezte Luftblase beim Conprimiren leicht hinaus
koͤnne. Diese Roͤhre ist gebogen und tritt mit ihrem zweiten auch
offenen Ende in das Gefaͤß, i. Auf die
Roͤhre, b, b, muß die zweite Roͤhre, c, c, sich gleich einer Scheide leicht aufschieben
lassen; sie ist unten verschlossen, oben aber trichterfoͤrmig so erweitert,
daß dieser Theil uͤber die Kugel aufzubringen ist. Dieser Trichter, d, d, sammt der Rohre, c, c,
kann aber in die Hoͤhe gebracht werden, und zwar vermittelst der durch das
Drehen der Kurbel bewegten Rolle, p, auf die sich
Schnuͤre aufwinden, die uͤber die Rollen, f,
f, nach dem Trichter hingehen.
Die Roͤhren, g, h, wie auch die Kugel, a, koͤnnen aus Glas, die Roͤhren, b, b, c, c, aber muͤssen aus Eisen und der
Trichter von Holz seyn. Alles kann, wie die Figuren zeigen, am hoͤlzernen
Geruͤste befestigt werden. Einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf das
Befestigen der Kugel, a, durch die Klammer, n, weil diese Kugel von allen Seiten frei bleiben muß,
um den Trichter uͤber dieselbe hinausziehen zu koͤnnen. Die Maschine
kann vermoͤge der Haken, m, m,
an der Wand aufgehangen werden; auf diese Art nimmt sie ungeachtet ihrer
Hoͤhe nicht viel Raum ein.
Die Vorbereitung zum Gebrauche der Luftpumpe besteht in dem Anfuͤllen des
Trichters, d, d, mit so vielem Queksilber, daß bei
dessen Aufziehen uͤber die Kugel und bei deren ganzen Anfuͤllen, das
Niveau im Trichter uͤber dem hoͤchsten Punct der Kugel stehe, was das
Ausstoßen aller Luft aus lezterer versichert. Außerdem muß man etwa ein paar Linien
uͤber die Oeffnung der Roͤhre, h, h, noch
Queksilber in das Gefaͤß, i, gießen.
Das Auspumpen der Luft geschieht auf folgende Art durch Aufziehen und Herablassen des
Trichters, d, d. Beim Aufziehen des Trichters bis auf
die Kugel, a, verschließt das aufsteigende Queksilber
gleich die Oeffnung, g; deßhalb kann die in der Kugel
zusammengedruͤkte Luft nur durch die Roͤhre, h,
h, heraustreten, und dieses geschieht mit großer Leichtigkeit, weil sie nur
den Widerstand einer ein Paar Linien hohen Queksilbersaͤule im
Gefaͤße, i, zu uͤberwinden hat. Wenn alle
Luft aus der Kugel, a, herausgetrieben ist, was am
Aufhoͤren des Brausens im Gefaͤße, i, zu
erkennen ist, wird der Trichter herabgelassen, worauf das sich senkende Queksilber
eine Leere in der Kugel, a, zuruͤklaͤßt.
Dadurch wird zugleich die vorher durch das Queksilber verschlossene Oeffnung der
Roͤhre, g, frei; jezt kann also die Luft aus der
Gloke in die Kugel, a, so lange
hinuͤberstroͤmen, bis es zum Gleichgewichte kommt. Die aͤußere
Luft wird in die Kugel einzudringen streben, hat hiezu aber nur einen Weg,
naͤmlich die Roͤhre, h, h, durch welche
sie hinausgetreten. Da aber das Ende dieser Roͤhre im Queksilber des
Gefaͤßes, i, eingesenkt ist, so wird die auf die
Oberflaͤche des Queksilbers druͤkende Luft dasselbe in der
Roͤhre, h, h, hoͤchstens 28 Zoll hoch
treiben, jedoch in die Kugel nicht gelangen koͤnnen. Um den aus der Gloke in
die Kugel vertheilten Theil der Luft herauszutreiben, wird der Trichter von Neuem
gehoben, wodurch das einstroͤmende Queksilber abermahls die Oeffnung, g, verschließt, und die Luft durch die Roͤhre,
h, h, heraustreibt. Durch das Wiederholen dieses
Verfahrens wird man also immer eine neue Quantitaͤt Luft aus der Gloke
herausbringen, die Verduͤnnung wird also stufenweise wie in einer
gewoͤhnlichen Luftpumpe erfolgen.
Bei dieser Operation vertritt das Heben und Senken des Queksilbers vermittelst des
Trichters die Stelle des Kolbens, und in dem es die Oeffnungen der Roͤhren,
g, und, h, bald der
heraustretenden Luft oͤffnet, bald der eintretenden verschließt, wirkt es
anstatt der Haͤhne, Ventile und Stoͤpsel der bis jezt
gebraͤuchlichen sowohl mechanischen als hydrostatischen Luftpumpen.
Aus der Beschreibung der Wirkung geht hervor, warum diese Luftpumpe so hoch
ausfaͤllt, und die Roͤhren uͤber 28 Zoll Laͤnge bekommen
muͤssen. Denn wenn das Queksilber nicht uͤber 29 Zoll unter die
Oeffnung, g, herabgelassen werden koͤnnte,
wuͤrde gegen das Ende der Verduͤnnung der Luft die Kugel, a, sich des Queksilbers nicht entleeren, noch sich mit
Luft anfuͤllen, auch wuͤrde die Roͤhre, g, nicht geoͤffnet werden koͤnnen. Deßgleichen, wenn die
Roͤhre, g, g, nicht 28 Zoll erhoben waͤre,
so wuͤrde im Augenblike des Eindringens des Queksilbers in die Kugel, a, waͤhrend der schon hochgetriebenen
Luftverduͤnnung unter der Gloke, das Queksilber durch diese Roͤhre in
die Gloke uͤberlaufen. Wenn endlich die Roͤhre, h, h, nicht uͤber 28 Zoll lang waͤre, so wuͤrde
waͤhrend der Verduͤnnung der Luft in der Kugel, a, das von der aͤußern Luft gedruͤkte Queksilber aus dem
Gefaͤß, i, in die Kugel und hinterdrein die
aͤußere Luft hineinstroͤmen.
Das Einlassen der Luft in die Gloke nach Beendigung des Versuches geschieht leicht,
ohne Huͤlfe eines Hahns. Das Roͤhrchen, l,
welches sehr duͤnn, gekruͤmmt und oben trichterfoͤrmig
erweitert ist, wird, in dem man es mit dem Finger zuhaͤlt, durch das
Queksilber in die Oeffnung der Roͤhre, b,
eingestekt, die es aber nicht zuschließen darf. Nachdem man den Finger
hinweggenommen, stroͤmt die leichtere Luft in die Kugel und von da in die
Gloke. Man koͤnnte dasselbe dadurch bewirken, daß man den Trichter, d, d, so tief herabsenkte, bis das Ende der
Roͤhre, b, b, frei in die Luft
hervorstuͤnde; in diesem Falle aber wuͤrde die durch die
groͤßere Oeffnung in zu großer Menge einstroͤmende Luft das Queksilber
in die Roͤhre, g, und in die Gloke mit
fortreißen.
Dieses ist der Bau einer Maschine, bei welcher das Oehl unnoͤthig ist, und der
Staub nicht schadet, da sie keiner Ausreibung unterworfen und uͤberall
luftdicht verschlossen ist, und in welcher der schaͤdliche Raum sich auf das
Kanaͤlchen, h, h, beschraͤnkt.
Die Einfachheit dieser Luftpumpe empfiehlt ihren Gebrauch in der Technik,Dingler sagt im polytechn. Journ. VII. Bd. 3. H.
S. 374 uͤber die Anwendung der Luftpumpe in Fabriken und Manufacturen
Folgendes: vor noch nicht laͤnger als 10 Jahren war die Anwendung der
Luftpumpe lediglich auf physische und chemische Versuche beschraͤnkt.
Jezt faͤngt man so ziemlich allgemein an, dieses herrliche Instrument
bei Manufacturen zu gebrauchen. Unseres Wissens waren die HHrn. Howard und Hodgson die
Ersten, welche laut ihres Patentes die Luftpumpe bei ihren Zukerraffinerieen
im Großen anwendeten u.s.w. Auch wurde bekanntlich die Anwendung der
Luftpumpe in Manufacturen der Gegenstand einer Preisaufgabe der Gesellschaft
der Wissenschaften in Harlem. in welchem Falle man den Durchmesser des Behaͤltnisses und der
Roͤhren nach Belieben vergroͤßern kann, um eine groͤßere
Quantitaͤt Luft in kuͤrzerer Zeit hinauszutreiben, wozu freilich auch
eine groͤßere Quantitaͤt Queksilber und eine groͤßere Kraft, es
zu heben, noͤthig waͤre; die Maschine selbst aber brauchte deßhalb
nicht hoͤher zu
werden. Da es aber in der technischen Anwendung gewoͤhnlich nicht
erforderlich ist, die Luft im hohen Grade zu verduͤnnen, so kann man statt
Queksilber Wasser oder eine andere Fluͤssigkeit gebrauchen, und die
Hoͤhe der Maschine dem specifischen Gewichte der Fluͤssigkeit
anpassen, wodurch sie doch nicht sehr hoch ausfallen wuͤrde. Moͤge
hier als Beispiel die Beschreibung ihrer Anwendung beim Destillirapparat
angefuͤhrt werden, welche ich in der polnischen Zeitschrift Isis vom Jahre
1824, N. 5, einruͤken lassen, wo die Verduͤnnung auf ein Viertel des
Atmosphaͤrendruks oder auf 8 Fuß Wasserdruk berechnet ist.
Die vom Refrigerator abgeleitete Roͤhre (Fig. 4.) geht in die
Roͤhre, a, f, uͤber, welche mit ihrem
Ende, a, in dem Gefaͤße, e, eingesenkt und mit Branntwein angefuͤllt ist. Oben bei, f, beugt sich die Roͤhre nach unten und reicht
bis auf den Boden der Kugel, g, h, die einige Maas
Fluͤssigkeit enthalten kann. Vom obern Theile dieser Kugel geht die Rohre,
i, k, ins Gefaͤß, e. Endlich geht von der
Kugel die Roͤhre, l, m, nach unten,
woruͤber die Scheide, n, o, und der Trichter, p, q, vermittelst der Schnuͤre, p, r, t, p, s, t, und der Rolle, t, durch die Bewegung der Kurbel aufgezogen werden koͤnnen. Das
Ganze kann von Kupfer verfertigt seyn, und ist an dem Fußboden befestigt.
Die Wirkungsart dieser Luftpumpe ist aus dem oben Gesagten leicht zu begreifen. Da
die Roͤhre, l, m, nur 8 Fuß lang ist, so
wuͤrde, wie gesagt, die Luft um 1/4 des Atmosphaͤrendruks
verduͤnnt. Ueber diesen Punct wuͤrde auch bei weiterer Bewegung keine
Luft mehr herauskommen, weil die Kugel, g, h, sich nicht
vom Wasser entleeren, also nicht mit Luft anfuͤllen konnte. Doch
moͤchte solche unnuͤze Bewegung keinen Schaden hervorbringen. Nach dem
Verhaͤltniß der Laͤnge der Roͤhre, l,
m, muß gleichfalls die der anderen ausfallen. Der ganze innere Raum des
Apparats waͤre also verschlossen, und der abgekuͤhlte Branntwein
moͤchte in die Roͤhre, b, a, abfließen,
hier 8 Fuß hoch stehen und die neu zufließende Menge moͤchte immer eine
gleiche in das Gefaͤß, a, k, und von da in die
Faͤsser abtreiben.
Um nach Beendigung der Operation Luft in den Apparat einzulassen, wuͤrde die
aus dem Gefaͤß, o, weggeschoͤpfte
Quantitaͤt Branntwein ein leichtes Mittel abgeben: denn dadurch wuͤrde
die Oeffnung, a, außerhalb der Fluͤssigkeit
kommen, und der atmosphaͤrischen Luft den Eintritt gewaͤhren.
Aus obiger Beschreibung ist ersichtlich, daß der Fußboden die Oeffnung, x, y, haben muß, um den Trichter, p, p, frei durchzulassen; deßgleichen, daß im Boden des Kellers eine
hoͤlzerne Roͤhre eingegraben seyn muß, damit die Scheide, n,
o, frei bis dahin herabgelassen werden koͤnne. Die Befestigungsart
der ganzen Maschine am Boden der Stube ist aus der Fig. 4. leicht zu
erkennen, und kann nach Belieben veraͤndert werden.
Tafeln