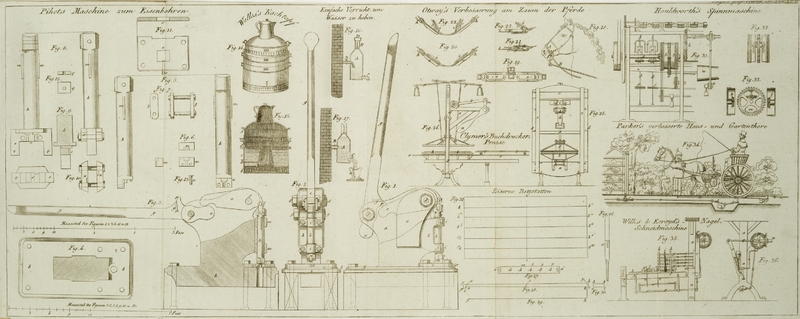| Titel: | Maschine zum Schneiden der Nägel, Schuhnägel und Stifte, worauf Jak. Wilks, Zinngießer zu Rochdale, Lancastershire, und Joh. Ecroyd, Krämer und Talglichthändler eben daselbst, sich am 8. November 1825 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. XXV., S. 86 |
| Download: | XML |
XXV.
Maschine zum Schneiden der Naͤgel,
Schuhnaͤgel und Stifte, worauf Jak. Wilks, Zinngießer zu
Rochdale, Lancastershire, und Joh. Ecroyd, Kraͤmer und
Talglichthaͤndler eben daselbst, sich am 8.
November 1825 ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem London Journal of Arts. Jaͤner 1828. S.
550.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Wilks's und Ecroyd's Maschine zum Schneiden der Naͤgel
etc.
Diese Maschine dient zum Schneiden schmaler keilfoͤrmiger Stuͤke aus
den Enden schmaler Streifen von Eisenblech: mehrere solche Streifen kommen auf ein
Mahl unter die Messer, oder unter die Schere, so daß mehrere Naͤgel etc. auf
ein Mahl geschnitten werden.
Die Maschine besteht aus einem Schlitten, welcher die Blechstreifen unter die
Schneiden des Messers fuͤhrt, und aus einem beweglichen Arme oder Messer,
welches mit den uͤbrigen Theilen der Maschine durch eine Kurbel, die von
einer sich drehenden Achse getrieben wird, in Bewegung gesezt wird.
Fig. 35 gibt
eine Laͤngenansicht dieser Maschine. Fig. 36 zeigt sie von
vorne. a, a, ist der Hauptpfosten, an dessen Seite die
Stahlplatte befestigt ist, welche eines der Blaͤtter der Schere bildet. c, ist ein Hebel oder ein Arm, der sich um einen
Stuͤzpunct in dem Pfosten, a, schwingt, und die
gekruͤmmte staͤhlerne Klinge, d,
fuͤhrt. e, e, e, sind die Streifen Eisenblech,
die mittelst der Schere, b, d, in Naͤgel
geschnitten werden sollen. f, f, ist ein Lager, welches
den Zahnstok sammt Zugehoͤr fuͤhrt, wodurch die Blechstreifen nach und
nach unter die Schere gebracht werden.
Die Streifen, e, e, e, sind mit einem ihrer Enden an den
Spindeln, g, g, g, befestigt, die sich in den
senkrechten Leisten, h, h, drehen; jede Spindel fuͤhrt ihren
Triebstok, i, i, i, der in den nachstehenden eingreift.
Die Leisten, h, h, bilden den Schlitten fuͤr die
Streifen, der an dem Zahnstoke, k, k, befestigt ist, und
mir diesem auf dem Lager, f, f, hinschleift.
Auf diesem Lager befinden sich zwei andere Leisten, die eine Schraube ohne Ende, l, fuͤhren, welche durch ihre Umdrehung den
Zahnstok, k, vorwaͤrts schiebt, zugleich mit den
Leisten, h, h, den Triebstoͤken, i, den Spindeln, g, und den
zu schneidenden Blechstreifen, e.
Das Lager, f, liegt, wie man sieht, nicht horizontal,
damit naͤmlich die Streifen nicht in einer senkrechten Richtung auf ihre
Achsen geschnitten werden, sondern schief, so daß also keilfoͤrmige
Stuͤke zum Vorscheine kommen. Zu diesem Ende laͤßt das Bett sich unter
jedem Winkel stellen, um jeden Winkel an dem keilfoͤrmigen Stuͤke
hervorzubringen, und ruht daher an jenem Ende, mit welchem es zunaͤchst an
dem Pfosten, 2, steht, in einem Gefuͤge, und an dem anderen Ende mittelst
eines Zapfens in einem Hinterpfosten, m, so, daß es nach
einem in Grade getheilten Kreisausschnitte gestellt werden kann.
Das Spiel der Maschine ist folgendes. Wenn eine gehoͤrige Drehekraft an der
Spindel, n,
Fig. 36,
angebracht wird, so wird das Rad, o, das Rad, p, drehen, und die Stange, q, die mit dem Hebel, c, und mit einer Kurbel an
der Achse dieses Rades verbunden ist, wird, so wie das Rad sich dreht, den Hebel,
c, in Schwung bringen, und die beiden Schneiden, d, und, b, wie die Schneiden
einer Schere wirken lassen, wodurch die Enden der Streifen des Eisenbleches
abgeschnitten werden.
Die Stange, r, die an einem excentrischen Rade, und auch
auf der Achse des Rades, p, befestigt ist, steigt zu
einem Arme, s, herab, der seitwaͤrts von der
langen Spindel, s, s,
Fig. 35,
auslaͤuft, wodurch, so wie das Rad, p, sich
dreht, die Spindel, s, s, sich schwingt. Diese Stange
fuͤhrt eine Stange oder ein Blatt, t, und so wie
die Spindel, s, sich schwingt, bewegt das Blatt, t, sich hin und her, und wirkt als ein Klopfer auf die
gabelfoͤrmigen Hebel, u, und, v, die oben in Stuͤzen haͤngen.
Der Stoß des Blattes, t, auf den gabelfoͤrmigen
Hebel, u, der durch die obigen Schwingungen
hervorgebracht wird, macht, daß ein Sperrkegel, der von dem oberen Ende des Hebels,
u, auf einen Zahn des Rades, w, schlaͤgt, und dasselbe dadurch einen Theil seiner Umdrehung
machen laͤßt, und so auch die Schraube ohne Ende, l, die auf der Achse desselben Rades befestigt ist. Diese Bewegung der
Schraube ohne Ende, die in die Zaͤhne des Zahnstokes, k, eingreift, schiebt, den Zahnstok um etwas vorwaͤrts, und dadurch zugleich auch den
Schlitten, h, h, und die Blechstreifen, e, e, e, die geschnitten werden sollen.
So wie diese Streifen, e, e, e, zwischen die Messer
vorwaͤrts geschoben werden, folgt alsogleich der Schlag des Hebels, und
schneidet die Enden ab, die in kleinen keilfoͤrmigen Stuͤken abfallen,
d.h. in den beabsichtigten Naͤgeln.
Wenn der Hebel, c, zuruͤktritt, macht die Stange,
r, die Spindel, s, sich
neuerdings schwingen, und das Blatt, t, wieder gegen die
gabelfoͤrmigen Hebel, u, und, v, anschlagen. Wenn der Hebel, v, bewegt wird, schlaͤgt sein oberes Ende gegen einen Zahn des
Zahnrades, x, und in dem er. dasselbe umher treibt,
treibt er auch das Zahnrad, y, auf derselben Achse,
welches in den unteren Zahnstok der Reihe, i, eingreift,
alle uͤbrigen zu einer halben Umdrehung noͤthigt, und die
Eisenblechstreifen, e, gleichfalls dreht, wodurch die
schiefe Flaͤche, die von dem lezten Schnitte uͤbrig blieb, auf die
andere Seite gekehrt, und das folgende Stuͤk ebenso keilfoͤrmig, wie
das erste, geschnitten wird. Durch die folgende Bewegung des Blattes, t, schlaͤgt der gabelfoͤrmige Hebel, u, auf das Rad, w, wie
vorher, und in dem die Schraube ohne Ende, l, gedreht
wird, wird der Zahnstok und der Schlitten sammt den Blechstreifen, o, o, o, vorgeschoben.
Auf diese Weise ertheilt jede Umdrehung des Rades, p, den
Scheren eine Bewegung, worauf jede Schwingung der Spindel, s, und ihres Blattes, t, den Schlitten mit den
Streifen vorwaͤrts schiebt, und zwar nur um Nagelbreite; die Blechstreifen
werden gedreht bei jedem Schnitte, und wenn nach wiederholten Schnitten die Bleche
bis an die sie hallenden Spindeln abgeschnitten sind, stoßt ein vorne an dem
Zahnstoke angebrachtes Stuͤk gegen das Ende des Hebels, z, welches das Rad, p,
zuruͤk schiebt und außer Umlauf sezt, und den weiteren Umlauf der Maschine
aufhebt.
Tafeln