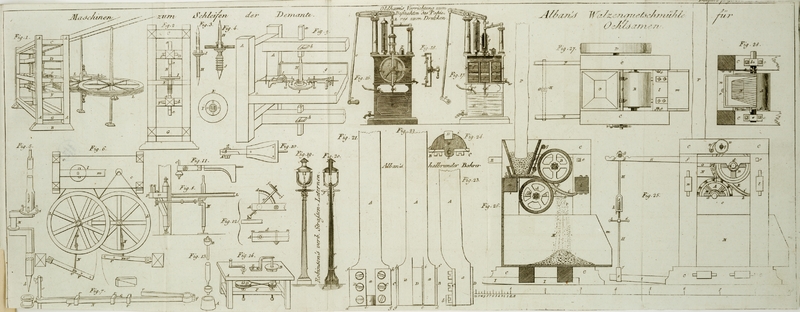| Titel: | Ueber das Schneiden und Schleifen der Demante und Edelsteine. |
| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. XLIV., S. 162 |
| Download: | XML |
XLIV.
Ueber das Schneiden und Schleifen der Demante und
Edelsteine.
Aus Gill's technological Repository. August S.
65.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
(Im
Auszuge.)
Ueber das Schneiden und Schleifen der Demante und
Edelsteine.
Hr. Gill glaubt seinem fruͤheren Aufsaze
uͤber Demantschnitt von Hrn. Turrell, den wir im
polytechnischen Journ. Bd. XXVI. S. 18
geliefert haben, noch den Aufsaz uͤber diesen Gegenstand aus einem der lezten
Baͤnde des Dictionnaire technologique, Bd. XII.
S. 124 (aus welchem wir hier unsere Uebersezung liefern) nachschiken zu
muͤssen, da die englischen Demantschleifer sehr geheimnißvoll mit ihren
Arbeiten sind, und „die Steinschleifer zu Paris, wie man nicht
laͤugnen kann, ihre Kunst hoͤher gebracht haben, als alle
anderen.“
Die Kunst, Demante zu schleifen, ist sehr alt, wird aber meistens ohne genauere
Kenntniß der Grundsaͤze, auf welchen sie beruht, ausgeuͤbt.
Es scheint, daß die Alten nicht bloß wußten, daß der Demant der haͤrteste
Stein ist, sondern daß sie auch die Brechung der Lichtstrahlen, das Farbenspiel an
den regelmaͤßig krystallisirten Stuͤken desselben kannten; sie wußten
ihn aber nicht zu schneiden oder zu schleifen, und trugen ihn so, wie er aus der
Erde kam. Sie hatten keine Idee von dem Glanze, von dem Feuer, welches der Demant
durch den Schliff erhaͤlt.
Es war im J. 1476, daß Louis de Berquen zufaͤllig
die Kunst, Demante zu schleifen, dadurch entdekte, daß er zwei Demante an einander
rieb, und sie durch ihren eigenen Staub, durch das Demantpulver (égrisée),Hr. Gill, sagt man, nennt das Demantpulver égrisée
„wegen seiner schneidenden oder schleifenden
Eigenschaft;“ allein égrisée ist bloß das Particip des Zeitwortes: égriser, welches der Kunstausdruk fuͤr
Demantschleifen bei den Franzosen ist, und weder eine „cutting“ noch eine „grinding quality“ bezeichnet A.
d. Ueb. poliren lernte.
Man verkuͤrzt die Arbeit des langweiligen Demantschleifens auf zwei
verschiedene Weisen: 1) durch das Spalten des Demantes in der Richtung seines
Blaͤtterdurchganges: Stuͤke, die diese Operation nicht erlauben,
werden den Glasern in ihrem natuͤrlichen Zustande (als diamans de nature) verkauft; 2) durch den Schnitt mittelst eines feinen
Eisendrahtes, der mit einer Mischung aus Oehl und Demantstaub uͤberzogen
ist.
Demant ist der einzige Edelstein, der mit Demantpulver und Oehl geschnitten, und auf
einer sehr weichen Stahlplatte polirt wird.
Rubine, Sapphire, orientalische Topaße werden mit Demantpulver und Oehl auf einer
kupfernen Scheibe geschnitten, die geschnittenen Faßetten aber auf einer anderen
kupfernen Scheibe mit Trippel und Wasser polirt.
Schmaragde, Hyacinthe, Amethyste, Granate, Achate und andere minder harte Steine
werden mit einer bleiernen Scheibe mit Schmergel und Wasser geschnitten, und auf
einer zinnernen Scheibe mit Trippel und Wasser polirt, oder was noch besser ist, auf
einer Scheibe aus Zink mit Zinnasche und Wasser.Hr. Gill uͤbersezt sehr unrichtig:
„mit demselben Polirmateriale.“
Die kostbaren Steine weicherer Art, auch die kuͤnstlichen oder sogenannten
Pasten werden auf einer Scheibe aus hartem Holze mit Schmergel und Wasser
geschnitten, und auf einer aͤhnlichen Scheibe mit Trippel und Wasser
polirt.
Die Handgriffe bei dem Schneiden und Schleifen der uͤbrigen Steine sind
dieselben, wie bei dem Demante.
Fig. 1 zeigt
die Scheibe des Steinschneiders, die in einem starken Gestelle, A, A, aus Eichenholz aufgezogen ist, an welchem die
einzelnen Stuͤke in einander eingezapft, und durch Schrauben und Niete in
einander befestigt sind. Das Gestell hat die Form eines Parallelopipedes von 23 bis
26 DecimeterEin Decimeter ist 3,93702 englische Zoll; folglich ein Centimeter 0,39370
engl. Zoll. A. d. engl. Uebers. Laͤnge, 19–20 Decimeter Hoͤhe, und 6–7 Decimeter
Breite. In einem solchen Gestelle haben zwei Scheiben neben einander Plaz, wie die
Figur zeigt.
Außer den Fuͤßen, B, B, sind noch die fuͤnf
großen Querstuͤke, C, D, E, F, G, zu bemerken,
wovon das oberste und unterste, C, und, G, Theile des Gestelles bilden, und zur Befestigung
desselben dienen. Die beiden Querstuͤke, D, und,
F, fuͤhren in ihrer Mitte ein langes
Stuͤk Holz von gleicher Dike mit ihnen selbst, aber nur von zwoͤlf
Centimetern Breite, das fest in dieselben eingezapft ist. Diese beiden
Laͤngenstuͤke sind einander gegenuͤber und uͤber
einander mit ihren Flaͤchen parallel gestellt: das eine, D, heißt der obere, das andere, F, der untere Balken. Fig. 2 zeigt das Gestell
von innen, so daß man sieht, wie die Scheiben gestellt und gestuͤzt sind.
Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in allen Figuren.
Jeder Balken hat zwei vierekige Loͤcher, die einander genau genau
gegenuͤber stehen, und in welche zwei vierekige Bloͤke aus Eichenholz, a, a, sehr genau passen: die Enden dieser Bloͤke
sind mit kegelfoͤrmigen Loͤchern versehen, welche als Pfannen die
kegelfoͤrmigen Spizen an den Enden des gehaͤrteten Stahles aufnehmen,
der die eiserne Achse, H, der Scheibe bildet. Diese
Bloͤke, a, a, werden in gehoͤriger
Hoͤhe mittelst der doppelten hoͤlzernen Keile, b, b, befestigt.
Das mittlere Querstuͤk, E, E, traͤgt eine
Tafel, c, c, welche ein starkes Brett aus Eichenholz
ist. Diese Tafel ist mit zwei großen Loͤchern versehen, deren Mittelpunkte
mit den kegelfoͤrmigen Loͤchern in den Enden der vierekigen
Bloͤke, a, a, correspondiren. Jene Loͤcher
haben ungefaͤhr 16 Centimeter im Durchmesser, und lassen die Achsen zweier
Scheiben frei durch.
Jede Scheibe, I,
Fig. 3,
besteht aus einer eisernen Achse, H, von verschiedener
Staͤrke, so daß man sie nach Umstaͤnden und nach dem Gewichte der
Scheibe wechseln kann; dann aus der Rolle, J, Fig. 4, die
mehrere Furchen an ihrem Umfange hat, und auf dem vierekigen Theile der Achse
aufgesezt ist.
Die Achse fuͤhrt einen Knopf, d, in welchem sich
vier eiserne Stifte befinden, die in die Loͤcher passen, welche in der
Scheibe zur Aufnahme derselben angebracht sind.
Die Scheibe, die man in, k, im Grundrisse sieht, ist im
Mittelpuncte zur halben Dike ausgehoͤhlt. Wenn sie, wie in Fig. 4, auf ihrer Achse
aufgezogen ist, wird ein Ring von geschlagenem Eisen auf ihr aufgesezt, und diese
ganze Vorrichtung wird durch doppelte eiserne Keile, f,
gehoͤrig befestigt, die durch einen Einschnitt in der Achse, welcher zur
Aufnahme derselben bestimmt ist, durchgezogen werden.
Eine hoͤlzerne Leiste, g, ungefaͤhr zwei
Decimeter hoch, ist an der entgegengesezten Seite, an welcher die Arbeiter bei ihrer
Arbeit stehen, befestigt, damit nichts von den Schneide- und Polirmaterialien
durch die Wurfskraft der Bewegung der Scheiben uͤber die Tafel hinaus
geschlaͤudert wird.
Hinter diesem Apparate ist fuͤr jede Scheibe ein großes Laufrad, L, angebracht, wie bei Messerschmieden, nur daß es
horizontal steht. Der Laufriemen oder die Schnur laͤuft in einer Furche an
dem Umfange dieses Rades, und in einer der Furchen an der Rolle, J, die auf der Scheibe unter der Achse befestigt ist.
Auf diese Weise wird durch das Drehen des Rades, L, die
Scheibe gleichfalls, und zwar mit einer Geschwindigkeit gedreht, die mit jener des
Rades und mit dem Unterschiede zwischen den Durchmessern des großen Rades, L, und der kleinen Rolle, J,
im Verhaͤltnisse steht.
Jedes Rad, J, ist auf einer eisernen Achse aufgezogen,
auf welcher eine Kurbel,
M, angebracht ist, die man in Fig. 5 in einem
groͤßeren Maßstabe sieht. Der untere Zapfen, h,
dieser Achse ist kegelfoͤrmig, und dreht sich in einem metallnen Lager, das
auf dem Fußboden der Werkstaͤtte gehoͤrig befestigt ist. Das große Rad
selbst ist auf dem Knopfe, i, angebracht, auf welchem
sich gleichfalls vier Stifte befinden, die in eben so viele, zur Aufnahme derselben
vorgerichtete Loͤcher in dem Rade passen, und so dasselbe auf der Achse
befestigen. Ueber dem Rade ist ein eiserner Ring angebracht, und das Ganze wird so,
wie die Scheiben, mittelst doppelter Keile, die in dem in der Achse hierzu
bestimmten Einschnitte, l, durchgetrieben werden,
befestigt.
Fig. 6 zeigt
diese ganze Vorrichtung im Durchschnitte: man hat jedoch, um das Spiel der Maschine
deutlicher zu zeigen, die uͤber dem oberen Balken befindlichen Theile
weggenommen. Man sieht hier die Tafel, c, c; den oberen
Laͤngebalken, m; eine der beiden Scheiben, I; (die andere ist abgenommen, damit man den Lauf des
Laufbandes sehen kann, das sich nicht kreuzt); die zwei großen Triebraͤder,
L, L; die zusammengesezten Verbindungsstangen, N, N, von welchen eine einzeln im groͤßeren
Maßstabe in Fig.
7 dargestellt ist, und die die großen Raͤder, L, L, treiben. Diese Verbindungsstange, N, besteht aus drei eisernen Stangen, n, o, p, q, und q, r. Die
erste, n, o, endet sich in ein Auge oder in einen Ring,
n, worein der Stift, s,
paßt. Die zweite, p, q, ist von gleicher Laͤnge
und Dike mit der ersten und mit der dritten, und mit dieser lezteren mittelst eines
Gewindes bei dem Puncte, q, verbunden, wo die beiden
Theile einen Kreis bilden, der den Hals der Kurbel, M,
umfaͤngt. Nachdem die Theile zusammengebracht wurden, werden sie in
gehoͤriger Laͤnge mittelst der vierekigen Ringe, t, t, t, die sie umgeben, befestigt, wie man in Fig. 6
sieht.
Die Stifte, s, s, wovon man einen bei, s, in Fig. 7 sieht, sind an den
Puncten, v, v, in Fig. 6 mittelst
Vorstekkeilen befestigt, und mit den hoͤlzernen Schwungarmen oder Hebeln, P, P, verbunden, die auf senkrechten Achsen aufgezogen
sind, wovon man eine einzeln und im Perspektive in Fig. 8 dargestellt sieht.
Die Treiber oder die Arbeiter, die das Rad drehen, ergreifen die beiden
hoͤlzernen Griffe, x, x, auf den Hebeln, P, P, und durch die abwechselnde Bewegung nach
ruͤkwaͤrts und vorwaͤrts, welche die Hebel dadurch erhalten,
theilen sie dieselbe mittelst der Verbindungsstangen den Kurbeln, M, M, auf den Achsen des großen Rades mit, und erzeugen
dadurch eine umdrehende Bewegung an diesen Achsen und an den Scheiben.
Fig. 9 zeigt
einen Theil dieser Vorrichtung von vorne und im Perspective. Wir sehen hier die
Tafel, c, c, und die Scheibe, I, die in
senkrechter Richtung zwischen den zwei vierekigen Bloͤken aus Eichenholz, a, a, welche in den Laͤngenbalken mittelst der
Keile, b, b, befestigt sind, festgehalten wird. Zu jeder
Seite der Scheibe sehen wir zwei jener wichtigen Werkzeuge, die man in England die
Zangen nennt (die Franzosen nennen sie Cadrans), von
welchen die Steine waͤhrend des Schleifens und Polirens fest gehalten werden.
Diese Zangen, welche wir einzeln in Fig. 10 und 11 dargestellt
haben, haben bedeutende Verbesserungen erhalten, die wir nach Fig. 12 beschreiben
werden. Der Arbeiter nimmt eines dieser Instrumente in jede Hand, und bringt es
gegen die Stifte, u, u, die in der Tafel befestigt sind,
damit es nicht durch die Schnelligkeit, mit welcher die Scheibe sich dreht,
weggeschlaͤudert wird. Diese Zangen sind uͤberdieß zuweilen noch mit
Gewichten beschwert (von welchen man eines bei, l,
sieht),Fehlt im Originale. A. d. Ueb. damit die Scheibe desto kraͤftiger eingreift.
Fig. 10 und
11 zeigt
die gewoͤhnlichen Zangen oder Cadrans der
Steinschneider: Fig. 10 im Grundrisse und von oben gesehen; Fig. 11. im Aufrisse oder
von der Seite; Fig.
9. im Perspective. Jede dieser Zangen hat zwei Baken, A, wie ein Schraubstok mit einer Schraube, a, die durch dieselben laͤuft, und sie an
einander festhaͤlt. Bei, b, sieht man ein von
beiden Baken gebildetes Loch, in welches der Stiel des Kittstabes, c, den man in Fig. 11 sieht, und an
dessen unterem Ende der Demant mit Mastix eingekittet oder mit Zinn
eingeloͤthet ist, eingesezt wird. Der Arbeiter neigt diesen Stab mehr oder
minder, je nachdem er den Faßetten, welche er auf dem Demante schleift, mehr oder
minder Neigung geben will, und wenn er von einer Faßette zur anderen
uͤbergeht, dreht er den Stab etwas herum. Da er indessen durch keinen
sicheren Leiter geleitet wird, so kann er hier leicht dadurch einen Fehler begehen,
daß die Faßetten nicht dort zu stehen kommen, wo sie eigentlich seyn sollten.
Einer der geschiktesten Steinschleifer zu Genf erlaubte mir die Verbesserungen zu
beschreiben, die er an diesem Instrumente anbrachte, und wodurch er in den Stand
gesezt wird, die Faßetten mit großer Regelmaͤßigkeit zu schleifen und zu
poliren, und wodurch er auch das Instrument wirklich zu einem wahren Cadran, d.i. zu
einem wahren Zifferblatte machte. Fig. 12 zeigt diese
Verbesserung. Jeder Baken enthaͤlt eine große muschelfoͤrmige
Hoͤhle, in welche eine messingene Kugel kommt, die an ihrem oberen Theile
eine Roͤhre, e, fuͤhrt, an deren Ende ein
flaches kreisfoͤrmiges Zifferblatt, f, f,
angebracht ist, auf welchem viele concentrische Kreise gezeichnet sind, deren jeder
in gleiche Theile getheilt ist, nach der Anzahl der Faßetten, die man gewoͤhnlich in jeder
Reihe von Schliffen geben will. Die Roͤhre nimmt den Stiel des Kittstabes mit
sanfter Reibung auf, und lezterer wird mittelst einer auf einem schlichen Puncte
angebrachten Stellschraube vollkommen darin befestigt. Man hat diese Stellschraube
in der Figur nicht darstellen koͤnnen, indem sie sich hinter dem senkrechten
Viertelkreise befindet, von welchem wir alsogleich sprechen werden.Wir sehen nicht ein, warum Hr. Gill die lezten
zwei Saͤze aus folgende Weise uͤbersezte: „Die
Roͤhre gibt dem Stiele des Kittstabes einen hinlaͤnglichen
Grad von Reibung, um ihn auf jeder Abtheilung fest zu halten, und wird
unter jedem schiklichen Winkel mittelst einer Schraube festgestellt, die
die zwei Baken zusammenhaͤlt, die man in der Figur nicht
dargestellt hat, indem“ etc. Es ist kein Wort von Abtheilung
und Winkel etc. im Originale. A. d. Ueb.
Ein Zeiger, g, stekt auf dem vierekigen Ende, in welches
der Kittstab oben auslaͤuft, und zeigt mittelst seiner Spize die Abtheilungen
auf dem Zifferplatte, f, f.
An der Seite, m, n, des Bakens, A, ist der in Grade getheilte Bogen oder Viertelkreis, d, mittelst zwei Schrauben befestigt: der Mittelpunct
dieses Viertelkreises wird als Mittelpunkt der Kugel angenommen. Dieser Viertelkreis
ist in 90° getheilt, wovon der oberste mit 0, der unterste mit 70°
bezeichnet ist: die anderen 20° bis 90 sind von dem Baken verstekt. Diese
beiden Cadrans oder Zifferblaͤtter werden auf folgende Weise gebraucht.
Wenn der Kittstab auf, o, an dem Viertelkreise gestellt
ist, so ist er senkrecht, und schleift an dem Demante die Tafel, oderHier ist ein Sinn entstellender Drukfehler in der englischen Uebersezung:
„on“ statt
„or;“
„the table of the brilliant on the point
opposite to it“ statt: „or the point.“ A. d. Ueb. die derselben gegenuͤberstehende Seite, die parallel mit der Tafel
seyn muß. Wenn man den Kittstab etwas, um 5 Grade, neigt, so werden alle Faßetten in
demselben Guͤrtel liegen, wenn anders ihre Neigung nicht sehr abweicht.Se trouverent sur une même zone, pourvu que
l'inclinaison ne varie pas. Gill uͤbersezte: „all wil be found in the same zone with their
inclination but little varied.“ A. d. Ueb. Wenn man nun den Kittstab dreht, so weiset der Zeiger, g, die Abtheilungen auf dem Kreise des Zifferblattes,
f, f; so daß, wenn man auf dem Kreise mit 16
Abtheilungen arbeitet, und bei jeder Abtheilung eine gehoͤrige Zeit
uͤber verweilt, man auf dem Demante, nachdem der ganze Kreis vollendet seyn
wird, 16 vollkommen gleiche Flaͤchen, und alle diese Flaͤchen
vollkommen gleich weit von einander abstehend erhalten wird.
Man schleift gegenwaͤrtig den Demant nur auf zwei verschiedene Weisen: man
gibt ihm naͤmlich den sogenannten Rosen-
oder den Brillantenschliff.
Der Rosenschliff ist unten flach, wie an allen schwachen
Steinen, seine obere
Flaͤche ist aber kuppelfoͤrmig gewoͤlbt, und in Faßetten
geschliffen. Im Mittelpuncte sind gewoͤhnliche sechs Faßetten, welche eben so
viele Dreieke bilden, deren Scheitel an einander stoßen. Die Grundlinien dieser
Dreieke stoßen an eine andere Reihe von Dreieken, die in verkehrter Ordnung mit
denselben stehen, so daß naͤmlich die Grundlinien beider an einander liegen,
und die Scheitel derselben an den scharfen Umfang des Steines stoßen,Diesen Saz hat Hr. Gill ganz ausgelassen. A. d.
Ueb. den man das Blaͤtterwerk nennt (feuilletés). Die lezten Dreieke lassen
Zwischenraͤume, deren jeder in zwei Faßetten geschnitten wird. Auf diese
Weise bekommt der Rosendemant 24 Faßetten, und die Oberflaͤche des Steines
wird in zwei Theile getheilt, von weichender obere die sogenannte Krone, und der sie umgebende untere Theil die Spizen
bildet (dentelle, die Hr. Gill mit Zaͤhnen, tuth,
uͤbersezt).
Der sogenannte Brillant ist immer wenigstens drei Mahl
diker, als die Rose.Wenigstens 3 Mahl diker, „au moins trois
fois plus épais, ist bei Hrn. Gill: „immer
duͤnner“
always thinner.“ A. d. Ueb. Seine Dike wird in zwei ungleiche Theile getheilt: ein Drittel wird
fuͤr die obere Flaͤche des Steines aufbewahrt, und zwei Drittel
bleiben fuͤr den unteren Theil desselben, den die Franzosen die Culasse nennen. Die Tafel hat 8 Flaͤchen, und der
Umfang wird gleichfalls in Faßetten geschliffen, von welchen einige Dreieke, und
andere Rauten bilden. Der untere Theil des Steines bekommt auch Faßetten, die die
franzoͤsischen Steinschleifer Pavillons nennen.
Es ist sehr zu beachten, daß diese Pavillons in dieselbe Lage kommen, wie die oberen
Faßetten, und mit einander in der vollkommensten Symmetrie uͤbereinstimmen,
denn sonst wuͤrde der Brillant falsch spielen.
Obschon der Rosendemant ein sehr starkes Feuer blizen laͤßt, und dasselbe
zuweilen noch weiter verbreitet, als der Brillant, so spielt lezterer doch unendlich
besser, was von dem verschiedenen Schliffe herruͤhrt.Um dem litterarischen Polizeispione in der Didaskalia, – r, zu zeigen,
wie in den besten englischen Journalen, unter
welche Gill's Repository allerdings gehoͤrt, uͤbersezt wird,
wollen wir noch folgende Stelle aus dem Franzoͤsischen im Dictionnaire technologique S. 130 uͤber
ihrer englischen Uebersezung hier einruͤken: „Quoique le diamant-rose darde de
très-grands éclats de lenière à
proportion souvent plus étendus que le brillant;
celui-ci joue infiniment d'avantage, à cause de la
différence de la taille“. Dieß heißt bei Hrn.
Gill S. 72:„Although the rose diamond darts a great
splendour of light, in proportion as it is more spread than the
brilliant; this infinite advantage is caused by the difference in
cutting it.“ Der Brillant hat 32 Faßetten von verschiedener Gestalt und unter
verschiedener Winkelneigung rings um die Tafel auf der oberen Flaͤche des Steines. Der
untere Theil desselben hat ferner noch 24 Faßetten rings um eine kleine Tafel
aufgeschlissen, durch welche dieser Theil zur abgestuzten Pyramide wird. Diese 24
Flaͤchen sind, wie die 32 oberen, unter verschiedenen Winkeln geneigt, und
bieten verschiedene Figuren dar. Indessen wird es wesentlich nothwendig, daß die
Faßetten des oberen und des unteren Theiles mit einander correspondiren, und zwar in
so genauen Verhaͤltnissen, daß die Brechungen und Zuruͤkwerfungen der
Lichtstrahlen so vervielfaͤltigt werden, daß man die Farben des Prismas alle
so hell als moͤglich wahrnehmen kann.
Die uͤbrigen natuͤrlichen Edelsteine, so wie die kuͤnstlichen
oder die Pasten, werden wie die Brillianten geschnitten; der einzige Unterschied
besteht in dem Materiale, aus welchem die Scheiben zum Schleifen und zum Poliren
verfertigt werden, wie wir bereits oben bemerkten.
Die Steine, welche geschliffen werden sollen, werden auf dem Kittstabe, Fig. 13
aufgezogen, den man senkrecht in eine Muschel, A, stekt,
welche sich in der Mitte befindet, und auf einer Art von Leuchter ruht, die man
Salzfaß (salière) nennt, und die das
Schwanzstuͤk des Kittstabes aufnimmt: der Kopf fuͤllt die
Hoͤhlung aus.Dieß heißt im Franzoͤsischen: „On
monte les pierres sur le bâton
à ciment, qu'on place debout dans
une coquille, A, placée au milieu et posée sur une
espèce de chandelier nommé salière, qui reçoit la queue du
bâton; la tête remplit la cavité de la
coquille.“
Im Englischen aber heißt es: „The stones to
be cut are mounted in a cement-stick, which is placed upright
with its shell A in the middle of a kind of candlestick or
saltcellar, which receives into its socket the stem of the
cement-stick; cavity in its head being filled up by the shell
of it!!“ A. d. Ueb. Man hat eine Composition aus Zinn und Blei, geschmolzen und zwar ziemlich
fluͤssig bei der Hand; man legt den Stein darauf und in die Mitte, und sobald
die Composition erstarrt ist, schabt man mit einem kleinen Messer die den Demant
umgebende Loͤthung ab, und gibt ihr die pyramidenfoͤrmige Gestalt, die
man in, B, sieht.
Das Spalten wurde ehemahls haͤufiger angewendet,
als gegenwaͤrtig; da es indessen auch jezt noch Faͤlle gibt, wo man
spalten muß, so wollen wir diese Arbeit beschreiben. Man schneidet, wenn man spalten
will, mittelst eines sehr duͤnnen Eisendrahtes, der in dem Gestelle einer
Saͤge aufgezogen ist, mittelst Demantstaubes, den man mit Oehl benezt, rings
um den Stein dort, wo man ihn theilen will, eine Furche in denselben, und beobachtet
dabei den wahren Durchgang der Blaͤtter (le vrai fil
de la pierre). Nachdem diese Furche tief genug geworden ist, sezt man die
Schneide eines scharfen und gut gehaͤrteten Messers in dieselbe,
fuͤhrt mit einem Hammer auf den gerade und vollkommen senkrecht gestellten„Sur la pierre posée droite et bien
à plomb“ heißt es im Originale; der englische
Uebersezer uͤbersezt dieß: „directly
upon the stone whilst it is posited upright upon a block of
lead.“ A. d. Ueb. Stein einen derben Streich, und der Stein wird in zwei beinahe gleiche
Theile gespalten seyn. Der gespaltene Demant schikt sich sehr gut zu Rosen.
Es gibt ein Instrument, dessen sich die Stahlpolirer, die fuͤr Uhrmacher
arbeiten, und die Uhrglasmacher bei Uhrglaͤsern mit zugeschliffenem Rande
bedienen, und das sie den Steinschneider nennen (lapidaire).Diesen lezten Saz hat der englische Uebersezer gaͤnzlich weggelassen.
A. d. Ueb. Dieses Instrument besteht aus einem Tische, A,
Fig. 14,
aus starkem Eichenholze sowohl an der Tafel, als an den Fuͤßen. Oben ist er
mit zwei Loͤchern versehen: das eine dient zum Durchgange der Rolle und der
Achse der Scheibe, B, die nach Umstaͤnden
entweder aus Blei oder aus hartem Holze ist; das andere, C, ist zur Aufnahme des oberen Theiles der Achse der großen Rolle
bestimmt, D. Der obere Zapfen der Scheibe stuͤzt
sich auf ein Eisen, C, das auf dem Tische mittelst
zweier hoͤlzernen Schrauben befestigt ist. Die unteren Zapfen der beiden
Achsen laufen auf Schraubenpfannen, die in eine in dem Balken, F, eingesezte Mutterschraube eingreifen. Die
Fuͤße an diesem Tische sind mehr oder minder hoch gestellt, je nachdem man an
demselben sizend oder stehend arbeiten will.
Man bedient sich des Schmergels zum Abschleifen, und der Zinnasche oder des
Englischroth zum Poliren.
Der Arbeiter legt das Stuͤk mit einer Hand auf die Scheibe, und druͤkt
mit einem Korke auf dasselbe, waͤhrend er mit der anderen Hand die Kurbel
dreht. Das Eisen, E, auf welches er seine Hand
stuͤzt, dient ihm als Unterlage beim Flachpoliren. Die Scheiben sind ebenso
eingerichtet und werden ebenso aufgezogen, wie wir oben bei dem Demantschliffe
dieselben beschrieben haben. Man bedient sich dieser lezten Vorrichtung
haͤufig in Uhrfabriken.
Anmerkung des Hrn. Gill. Bei
uns in England wird, wie Hr. Turrell bemerkt, das
Schlagloch um den Demant mit dem Mittelfinger aufgetragen, indem man lezteren
haͤufig in der Asche der Holzkohlen reibt, deren man sich zum Schmelzen des
Schlagloches bedient, wodurch man dem Anhaͤngen der heißen Metalltheilchen,
die den Finger verbrennen wuͤrden, vorbeugt. Man bedient sich des
Schlagloches statt des Kittes beim Demantschliffe wegen der großen Hize, die durch
die Reibung entsteht.
Tafeln