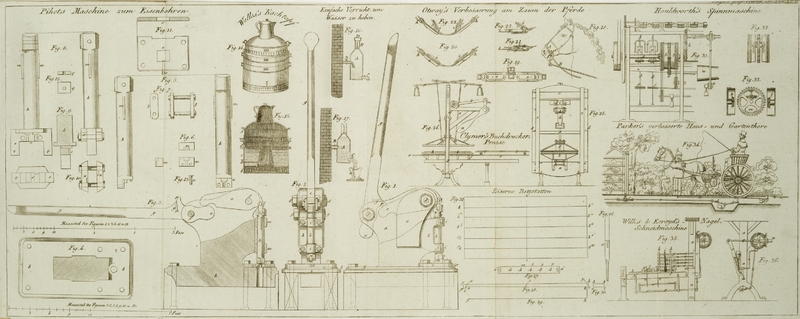| Titel: | Walzenquetschmühle für verschiedene Oehlsamen. Von Dr. Ernst Alban. |
| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |
| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. XLVIII., S. 179 |
| Download: | XML |
XLVIII.
Walzenquetschmuͤhle fuͤr
verschiedene Oehlsamen. Von Dr. Ernst
Alban.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Alban's Walzenquetschmuͤhle fuͤr verschiedene
Oehlsamen.
Die gewoͤhnlichen Maschinen dieser Art haben meistens viererlei Fehler:
1) Sie quetschen nach Verhaͤltniß der Kraft, die zu ihrem Betriebe
noͤthig ist, eine zu geringe Quantitaͤt Samen;
2) Der gequetschte Samen wird darauf nur geplaͤttet, so daß oft nicht einmahl
seine Huͤlsen aufspringen, er folglich bei seiner Bearbeitung in den Stampfen sich
der Wirkung dieser eben so leicht entzieht, als ein ungequetschter Same. Ueberhaupt
wird durch die Unvollkommenheit der Quetschung die voͤllige Verarbeitung des
Samens unter den Stampfen sehr verzoͤgert;
3) Der Same muß den bisherigen Walzenmuͤhlen sehr gereinigt
uͤberliefert werden, vorzuͤglich sind alle Steine sorgfaͤltig
abzusondern, um nicht die genau abgedrehten und gestellten Walzen zu verderben.
4) Die Walzen verlieren bald ihre genau gearbeitete Oberflaͤche und
muͤssen oͤfters neu abgedreht werden.
Alle diese Mangel sind hauptsaͤchlich in dem Umstande begruͤndet, daß
man die Walzen dieser Muͤhlen durch Stellschrauben in eine voͤllig
unnachgiebige Stellung gegen einander bringt, bei welcher zwischen beiden ein nach
Beschaffenheit des Samens verhaͤltnißmaͤßig geringer Zwischenraum
bleibt. In diesem kann der Same bei seinem Durchgange nur einen unvollkommenen Grad
von Plattung erfahren, so daß oͤfters, vorzuͤglich bei kleinern
Koͤrnern, seine Huͤlse nicht einmahl aufspringt. Ganz kleine
Koͤrner, wie sich doch viele in jedem noch so guten Samen finden,
entschluͤpfen nicht selten ganz der Bearbeitung durch die Walzen, indem jener
Zwischenraum fuͤr sie zu groß ist. Zum Zweke einer gehoͤrigen, und
einer nachherigen, lange Kraft und Zeit raubenden Bearbeitung unter schweren
Stampfen ersparende Quetschung, wobei der Same die noͤthige Eigenschaft des
Zusammenballens erhaͤlt, wenn eine Portion davon in der Hand
zusammengedruͤkt wird, ist es aber durchaus erforderlich, daß er bei
derselben voͤllig auseinander fließe, und sowohl in Hinsicht seines Kerns als
seiner Huͤlse gehoͤrig zertheilt erscheine.
Vorzuͤgliche Nachtheile bringt dieses Stellen der Walzen durch Stellschrauben
aber fuͤr die Muͤhle selbst, wenn der Same mit kleinen Steinchen, wie
es so haͤufig geschieht, verunreinigt ist. Sind diese zu groß, um durch den
Zwischenraum zwischen beiden Walzen schluͤpfen zu koͤnnen, oder gar so
hart, daß die Walzen sie nicht zu zerdruͤken vermoͤgen, dann graben
sie so tiefe Gruben in diese, oder schleifen darin nach und nach an der durch sie
betheiligten Stelle eine ringfoͤrmige Furche bis zu der Groͤße, daß
sie durchschluͤpfen koͤnnen. Dabei werden die Walzen aber
natuͤrlich gaͤnzlich verdorben und unbrauchbar gemacht.
Alle diese Maͤngel lebhaft fuͤhlend, kam ich schon vor 10 Jahren auf
die Idee, die Walzen unmittelbar auf einander arbeiten zu lassen, so daß sie sich
jederzeit beruͤhrten. Ich wurde auf diese Idee durch die Bemerkung
gefuͤhrt, daß die gewoͤhnlichen großen Laͤufersteine in den
Oehlmuͤhlen, die unmittelbar auf ihren Bodensteinen umlaufen, und mit ihrem
ganzen Gewichte darauf druͤken, eine so schnelle und vollkommene Quetschung bewirken. Das Gewicht
der Bodensteine glaubte ich leicht auf eine kuͤnstliche Weise und durch
einfache Vorrichtungen ersezen zu koͤnnen. Der Versuch, wodurch ich diese
Idee ins Leben treten ließ, fiel zu meiner hoͤchsten Zufriedenheit aus.
Rappsamen wurde so vollkommen auf meiner Muͤhle gequetscht, daß er zur ersten
Pressung geschikt befunden wurde, und Leinsamen war in dem Maße zerdruͤkt,
daß er nur noch kurze Zeit gestampft zu werden brauchte. Ich hatte in dieser
Probemaschine das Gewicht der Laͤufersteine dadurch ersezt, daß ich die eine
der Walzen in ein bewegliches Gestell legte, und dieses mit seiner Walze durch
starke Federkraft gegen die andere fixirt umlaufende druͤken ließ. Ich gewann
außer der vollkommenen Quetschung des Samens durch diese Einrichtung noch zwei
andere Vortheile:
a) Daß bei Zwischenfallen von groͤßern
Unreinigkeiten oder Steinen zwischen die Walzen denselben kein Schade
zugefuͤgt wurde, indem die bewegliche Walze bei Durchgang derselben nachgab.
In dem Augenblike des Nachgebens fiel dann zwar eine Portion Samenkoͤrner
ungequetscht durch, der Nachtheil war aber nicht in Rechnung zu bringen gegen den
Verlust der Walzen, die einmahl in Furchen geschnitten, fortwaͤhrend eine
weit groͤßere Menge Samenkoͤrner unbearbeitet durchschluͤpfen
lassen.
b) Bemerkte ich aber auch, daß jezt keine Getriebe an
den Walzenwellen noͤthig waren, um beide Walzen in gleichem Umtriebe zu
erhalten. Die Friction der fixirt umlaufenden, und durch irgend eine Triebkraft in
Bewegung zu sezenden Walze gegen die andere reichte vollkommen hin, um diese mit
umzudrehen. Dabei fand uͤberdem eine Art Schleifen zwischen den
Beruͤhrungslinien beider Walzen Statt; das waͤhrend des
Dazwischenfallens des Samens, durch eine verzoͤgerte Geschwindigkeit der
zweiten, im beweglichen Gestelle liegenden Walze in der Weise bewirkt wurde, daß die
Glatte der Samenkerne die Reibung, wodurch die leztere Walze von der fixirt
umlaufenden aus in Umtrieb gesezt wurde, etwas verminderte. Grade dadurch aber
geschah die Zerquetschung des Samens um so vollkommener, weil diese nun zugleich mit
einem Zerreiben wohlthaͤtig verbunden war.
Die Probemuͤhle, die ich nach diesem Principe erbaut habe, hat nur 8 Zoll
breite Walzen voll hartem Sandstein, und der Same faͤllt nur in einen 5 Zoll
breiten Striemen zwischen denselben, dessen ungeachtet verarbeitet sie in 12 Stunden
gegen 16 ScheffelIch verstehe hier den Rostocker Scheffel, der ungefaͤhr 5/7 des
Inhaltes eines Berliner faßt. Rappsamen so vollkommen, daß er des Stampfens nur noch eine hoͤchst
unbedeutende Zeit
bedarf, um sogleich gepreßt zu werden. Ich habe sie in der Oehlmuͤhle des
Muͤllers Kaͤhlert in Tulendorf bei Rostock
aufgestellt, dessen Windmuͤhle zu ihrer Betreibung nicht mehr Kraft
gebraucht, als zur Ingangsezung von 2 Stampfen noͤthig ist, so daß sie mit
einem kaum fuͤhlbaren Winde ihrer voͤllig maͤchtig wird. Beim
Versuch mit einer Kurbel waren 2 Mann hinreichend, um sie gehoͤrig in Betrieb
zu sezen und zu erhalten.
Sie wird in der Kaͤhlertschen Muͤhle sowohl
zum Quetschen des Rapp- als auch des Leinsamens mit großem Erfolge gebraucht,
und durch einen starken Gurt in Bewegung gesezt, der uͤber ein Riemenrad der
Daumenwelle von 5 Fuß Durchmesser laͤuft, und von hier aus ein anderes
Riemenrad von 2 Fuß Durchmesser, an der fixirt umlaufenden Walzenwelle, mit der
Geschwindigkeit von 50 bis 60 Umgangen in der Minute, fuͤr lezteres umtreibt.
Die Walzen sind von verschiedenem Durchmesser, so daß der der fixirt umlaufenden 1
Fuß, der der andern 18 Zoll betraͤgt. Der Gurt wird durch einen Hebel mit
einer Rolle, die gegen denselben durch ein schweres Gewicht angedruͤkt wird,
in steter gleicher Spannung erhalten.
Beschreibung der Muͤhle.
Zwei Steine, A, und, B, gute,
harte Sandsteine, oder noch besser von GranitSandsteine rathe ich nur im aͤußersten Nothfalle zu nehmen, da sie
sich abnuzen, und oͤfter ersezt werden muͤssen. Zwar werden
sie durch das sich in sie ziehende Oehl des Samens auf ihrer
Oberflaͤche haͤrter, als im Innern, indem das Oehl darin
troken wird und erhaͤrtet, dessen ungeachtet haben sie nach meinen
Erfahrungen nicht den erwuͤnschten Erfolg. Ueberdem findet man sie
selten auch an allen Stellen von gleicher Haͤrte, sie nuzen sich
daher ungleich ab, und laufen unrund, was der richtigen Wirkung der
Muͤhle sehr hinderlich ist.) gehoͤrig walzenfoͤrmig bearbeitet, von 1 Fuß im Durchmesser
und 1, 1/2 bis 2 Fuß Breite, oder auch 2 gußeiserne Walzen von diesen Dimensionen,
aus einem hohlen Cylinder und 2 eingesezten Endscheiben zusammengesezt,Ich wuͤrde nicht gerne massiv gußeiserne Walzen nehmen, weil sie sehr
schwer ausfallen, und die Anlage der Maschine unnoͤthig vertheuern.
Die auf oben angegebene Weise zusammengesezten Walzen verbinden hinreichende
Staͤrke mit Leichtigkeit. Werden sie sehr genau gegossen, mit grobem
Sandsteine auf ihrer Oberflaͤche etwas vom Gußsande gereinigt und
geebnet, und gut centrisch zusammengesezt und auf ihre Welle gekeilt, so
wird das genauere Abdrehen derselben unnoͤthig. sind auf eiserne Wellen aufgezogen, so daß sie gehoͤrig centrisch
umlaufen, und liegen auf einem hoͤlzernen (oder gußeisernen) starken
Gestelle, C, so uͤber einander, daß das Centrum
der obern Walze einen Winkel von ungefaͤhr 30° mit der senkrechten,
durch den Mittelpunct der untern Walze gezogenen Linie macht, wenn man von der
erstem zur leztern die Linie zieht. Die Walze, A, ist
die fixirt umlaufende. Sie dreht sich mit ihrem Wellzapfen in 2 Lagern, a, und, b, mit messingenen
Futtern, die an dem Riegel, c, des Gestelles, C, befestigt sind. Außerhalb des Gestelles ist aber an ihrer Welle ein
Riemenrad, D, oder Getriebe angebracht, wodurch sie in
Umlauf gesezt wird. Die obere Walze, B, liegt in 2, an
den eisernen Hebeln, E, und, F, befestigten, und mit Messing ausgefuͤtterten Lagern, d. Das Hypomochlion der Hebel, E, und, F, dreht sich bei, e, im Stender des Gestelles um einen eisernen Zapfen,
e, bei, F, laufen aber
beide Hebel durch einen Schliz des gegenuͤberstehenden Stenders des
Gestelles, und stehen hier 2 oder mehrere Fuß lang nach außen hervor. Gegen das Ende
derselben sind mehrere correspondirende Furchen, g, g,
auf ihrer obern Flaͤche angebracht, in deren 2, in beiden Hebeln
gegenuͤberstehenden, eine runde eiserne Querstange ruht, die in Fig. 27 bei,
G, punctirt vorgestellt ist. Von derselben, und zwar
von ihrer Mitte, geht eine Zugstange, H,
abwaͤrts, die sie mit einer starken Holzfeder, I,
in Verbindung sezt, welche quer unter dem Gestelle der Muͤhle befestigt ist.
Die Zugstange, H, kann durch eine Stellvorrichtung, h, verlaͤngert und verkuͤrzt werden, je
nachdem man die Holzfeder mehr oder weniger spannen, und dadurch den Druk auf die
Hebel, E, und, F, vermehren
oder vermindern will. Bei der Gegenwart der verschiedenen Furchen, g, g, auf den Hebeln, E,
und, F, wird es zugleich moͤglich, die Querstange
naͤher oder entfernter dem Hypomochlio der Hebel, E, und, F, zu bringen, und so den Druk auf
dieselben auch auf diese Weise zu modificiren. Die Stellvorrichtung an der
Zugstange, H, besteht in einer Stellschraube 1, die bei
2 in einem Gewinde des obern Endes 3 derselben geht. Das untere Ende der Zugstange
mit der Schraube 1 kann vermittelst des doppelten Handgriffes 5 und 6 gedreht
werden, und hat zu diesem Ende bei 7 ein Knopfgelenk in dem Halsbande 8, das die
Holzfeder umfaßt.
Anmerkung. Ich ziehe das Andruͤken der obern
Walze, B, an die untere, A,
durch Federkraft weit dem durch Gewichte vor. Meine Erfahrung hat mich
naͤmlich belehrt, daß die Gewichte dem Springen ausgesezt sind, sobald
unzerdruͤkbare Partikeln zwischen den Walzen durchgehen, und eine
ploͤzliche Luͤftung der Hebel, E, und, F, bewirken. Ein solches Springen der Gewichte hat aber
den Nachtheil, daß in dem Momente desselben eine groͤßere Quantitaͤt
Samen unzerquetscht den Walzen entwischt, als sonst beim Durchgehen eines fremden
Koͤrpers durch dieselben geschieht, indem der Druk der Walzen auf einander
dabei zu lange unterbrochen wird.
Zum Abnehmen des bei dieser Quetschmethode fest an den Walzen haͤngen
bleibenden Samens dienen 4 Schaber, K, und, L, die an ihrer Schaͤrfe verstahlt werden
muͤssen, und jeder durch 2 Federn, i, und, k, an den Riegel, l, des
Gestelles geschroben werden. Die Federn sind so gespreizt, daß die des obern Schabers, K, denselben gegen die obere, die des untern, L, den ihrigen gegen die untere Walze
andruͤkt.
Der gequetschte Same faͤllt in einen, unten im Gestelle angebrachten
Behaͤlter, M, aus dessen offener, und aus dem
Gestelle etwas hervorragender Seite, m, er vermittelst
einer Kruͤke in die zu seiner Aufnahme bestimmten Kasten geschafft werden
kann; diese sezt man am zwekmaͤßigsten in eine Vertiefung des Fußbodens. In
Faͤllen, wo man die Muͤhle etwas erhoͤht stellen kann,
laͤßt sich auch eine Art Trichter im Gestelle unter den Walzen anbringen, der
den Samen in darunter gestellte große Behaͤlter leitet. Dieß hat da
vorzuͤglichen Werth, wo man die Muͤhle etwa ohne Aufsicht die
Naͤchte durch arbeiten lassen will.
Zum Leiten des Samens zu den Walzen dient ein gewoͤhnlicher Schuh, N, wie er in Kornmuͤhlen uͤblich ist. Er
ist nach den Walzen zu offen, und seine Oeffnung im Lichten 2 1/2 Zoll
schmaͤler als die Breite der Walzen. Das Bodenbrett desselben ist in der, in
der Abbildung Fig.
4 angegebenen Weise gefurcht, damit der Same moͤglichst
gleichmaͤßig zwischen die Walzen gebracht werde. Die Furchen laufen ein wenig
convergirend nach der untern schmaͤlern, und in der Figur punctirt
angegebenen Rumpfoͤffnung zu. Auf diese Weise nehmen alle Furchen gleich viel
Samen aus dem Rumpfe auf, und leiten ihn troz alles Schuͤttelns in gleichen
Striemen bis zur vordern Ausgußoͤffnung, indem derselbe uͤber den
hoͤhern Rand der Furchen nicht wieder weggeschnellt werden kann. Die
Ausgußoͤffnung muß der Beruͤhrungslinie beider Walzen so viel als
irgend thunlich genaͤhert werden, damit der einmahl aus derselben gedrungene
Same sogleich von den Walzen ergriffen werde, ohne auf den Seiten ausweichen zu
koͤnnen.
An seinem hintern Ende ruht der Schuh auf dem Riegel, n,
des Gestelles. Er hat in seiner Mitte hier ein eisernes Oehr, womit er sich auf den
Nagel, o, des Riegels wendet. Seine ganze Stellung
erscheint nach der Ausflußoͤffnung hin etwas geneigt, damit der Same schon
von selbst etwas Fall dahin habe. Ueber der Ausflußoͤffnung ist er an 2
Schnuͤren, p, aufgehaͤngt, die sich
uͤber eine durch die Gestelle quer durchlaufende hoͤlzerne Welle, q, schlagen oder wikeln. Durch Drehung dieser leztern
kann man den Schuh mehr heben oder senken, je nachdem man mehr oder weniger Samen
zwischen die Walzen bringen will.
Das Ruͤtteln des Schuhes geschieht durch den Nagel, r, der an einer oder der andern Seite desselben angeschroben ist. Er
kruͤmmt sich erst nach außen und dann nach unten, so daß er den auf diesem
Ende gezahnten Rand der Walze, A, beruͤhrt und
durch die, auf der
entgegengesezten Seite an das Gestelle angeschrobene Holz- oder Stahlfeder,
t, in deren Zahnung hinein gedruͤkt wird. Der
Rand der Walze ist in der Art eines Steigrades in einer Uhr gegossen, und
druͤkt beim Umgange derselben durch seine Zahne den Nagel mit dem Schuh in
schnell auf einander folgenden Momenten nach außen, wo derselbe dann gleich darauf
immer wieder vom Zahn abschnappt, und durch die Wirkung der Feder
zuruͤkgeschnellt wird. Da ich es sehr zwekmaͤßig fuͤr eine
regelmaͤßige Arbeit des Schuhes gefunden habe, wenn derselbe recht schnell
geruͤttelt wird, so gebe ich dem Rande der Walze bei 50 UmgaͤngenDiese Geschwindigkeit ist, nach meinen Erfahrungen, die beste und
zwekmaͤßigste fuͤr Walzen von der angegebenen Groͤße,
jedoch geht dieselbe in der Kaͤhlertschen
Muͤhle haͤufig uͤber 60 Umgaͤnge, ohne daß ein
schlechteres Product geliefert wuͤrde. derselben 12 Zaͤhne.
Die zur Stellung des Schuhes dienende Welle, q, hat
außerhalb am Gestelle ein kleines hoͤlzernes Sperrrad, u, und an dem Gestelle selbst ist ein Sperrkegel, v, angebracht, der sie in der ihr einmahl gegebenen Stellung
erhaͤlt.
In dem Schuhe steht der Rumpf, O, der auf
gewoͤhnliche Weise eingerichtet, aber nur so klein ist, daß er uͤber
dem Gestelle der Muͤhle nicht hervorragt. Bis zur Haͤlfte seiner Tiefe
hinab haͤngt ein Schlauch, P, von starker
Leinwand, der in das obere Stokwerk fuͤhrt, wo in den Oehlmuͤhlen
gewoͤhnlich die Samenvorraͤthe angehaͤuft liegen. Hier ist er
an dem untern Ende eines großen Rumpfes befestigt, der, um an Aufsicht und Arbeit zu
ersparen, wo moͤglich die in einem Tage zu quetschende Menge Samen fassen
kann. Dieser große Rumpf versorgt dann den kleinen Rumpf der Muͤhle immer in
der Art, daß dieser stets bis uͤber die Haͤlfte gefuͤllt
bleiben muß, so lange noch Same im großen Rumpfe vorhanden ist, und zwar auf
folgende Weise: Sobald der Same naͤmlich vom obern Rumpf durch den Schlauch
in den untern hinunterfallt, fuͤllt sich dieser augenbliklich bis an die
Muͤndung des Schlauchs, und schließt diese, waͤhrend er durch seinen
Druk noch etwas weniges uͤber das Ende des Schlauchs im Rumpfe empor steigt.
Durch den, auf diese Art durch den Samen selbst bewirkten Verschluß der untern
Oeffnung des Schlauchs wird der Same verhindert, den kleinen Rumpf der Maschine zu
uͤberfuͤllen, so daß er nur in dem Maße weiter nachstroͤmen
kann, als der leztere sich wieder entleert.
Erklaͤrung der Tafel.
Fig. 25.
Aufriß der Muͤhle.
A, die fixirt umlaufende Walze.
B, zweite Walze. C,
hoͤlzernes Gestell der Muͤhle.
E, Einer der eisernen Hebel, die die Walze, B, auf die untere Walze andruͤken. d,
Lager desselben fuͤr die Wellzapfen der Walze. e,
eiserner Zapfen als Hypomochlio des Hebels. f, deutet
die Stelle an, wo der Hebel durch einen Schliz im Stender geht, so daß er sich frei
bewegen kann, und zugleich vor jedem Wanken nach den Seiten gesichert wird.
G, Querstange uͤber den Drukhebeln. g, g, Furchen in leztern zur Aufnahme derselben.
H, Zugstange die zur
I, Holzfeder fuͤhrt. h, Stellvorrichtung zur Verlaͤngerung oder Verkuͤrzung der
Zugstange, H, 1 Schraube des untern Theils der
Zugstange. Sie dreht sich in dem Gewinde bei 2, 5 und 6 Handgriffen zum Drehen der
untern Zugstange. 7 und 8 eisernes Halsband fuͤr die Holzfeder.
K, und, L, die beiden
Schaber, welche die Walzen rein von dem gequetschten Samen erhalten, i, und, k. Die sie
andruͤkenden Federn dieser Seite.
l, und, n, Querriegel des
Gestelles, an, l, sind die Schaber befestigt, und auf,
n, ruht der Schuh.
M, der im Gestelle angebrachte Behaͤlter, in
welchen der gequetschte Samen faͤllt, m, der
aͤußere, aus dem Gestelle hervorragende und offene Theil desselben, wo der
gequetschte Same herausgenommen wird.
N, der Schuh. p, die Schnur
dieser Seite, woran der ruͤttelnde Theil des Schuhes haͤngt. q, die Welle, woruͤber die Schnur sich
schlaͤgt, und wodurch der Schuh hoͤher oder niedriger gestellt werden
kann, r, der Schuͤttelnagel des Schuhs. u, Sperrrad an der hoͤlzernen Welle fuͤr
die Stellung des Schuhs. v, am Gestelle angebrachter
Sperrkegel, um das Sperrrad und die Welle in der gegebenen Stellung
festzuhalten.
O, der Rumpf.
P, der Schlauch von Leinewand, der dem Rumpfe den Samen
aus einem obern, groͤßern Rumpfe im zweiten Stokwerke zufuͤhrt.
Fig. 26.
Senkrechter Laͤngsdurchschnitt der Muͤhle.
A, und, B, die beiden
Walzen.
C, Gestell. E, Drukhebel der
hintern Seite. e, Nagel fuͤr sein
Hypomochlion.
K, und, L, die Schaber. i, und, k, Federn derselben,
an dem Riegel, l, befestigt.
I, Holzfeder.
M, Behaͤlter fuͤr den gequetschten Samen.
m, offenes Ende desselben.
N, Schuh. o, auf dem Riegel,
n, befestigter Nagel, worauf sich der Schuh mit seinem
eisernen Oehre wendet. p, Stellschnur des Schuhs. q, Stellwelle desselben.
O, Rumpf.
P, Schlauch.
Fig. 27.
Obere Ansicht der Muͤhle.
B, Die obere Welle.
C, das Gestell. D, Riemenrad
zur Betreibung der Muͤhle.
E, und, F, Drukhebel, e, e, Nagel fuͤr die Hypomochlia der Drukhebel,
G, Querstange derselben.
H, Oberer Knopf der Zugstange.
l, Querriegel des Gestelles, woran die Schaber
geschroben sind.
m, Aeußerer Theil des Behaͤlters fuͤr den
gequetschten Samen.
p, p, Stellschnuͤre fuͤr den Schuh. q, die Stellwelle, u,
Sperrrad derselben. v, Sperrkegel.
O, Rumpf.
Fig. 28.
Obere Ansicht des Schuhes und der untern Walze mit ihren Lagern.
A, Untere Walze. a, und, b, Lager derselben.
C, Gestell. c, c, Riegel
desselben fuͤr die Lager.
N, Schuh. o, Nagel, auf dem
Riegel, n, des Gestelles fuͤr das eiserne Oehr
des Schuhes befestigt, r, Ruͤttelnagel des
Schuhes. Er wird durch den gezahnten Rand, s, der Walze,
A, geschuͤttelt, t, Feder, um den Rumpf zuruͤkzuschnellen, wenn der
Ruͤttelnagel ihn ruͤttelt.
Tafeln