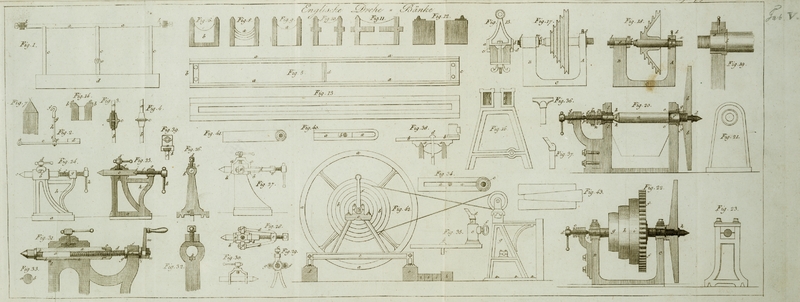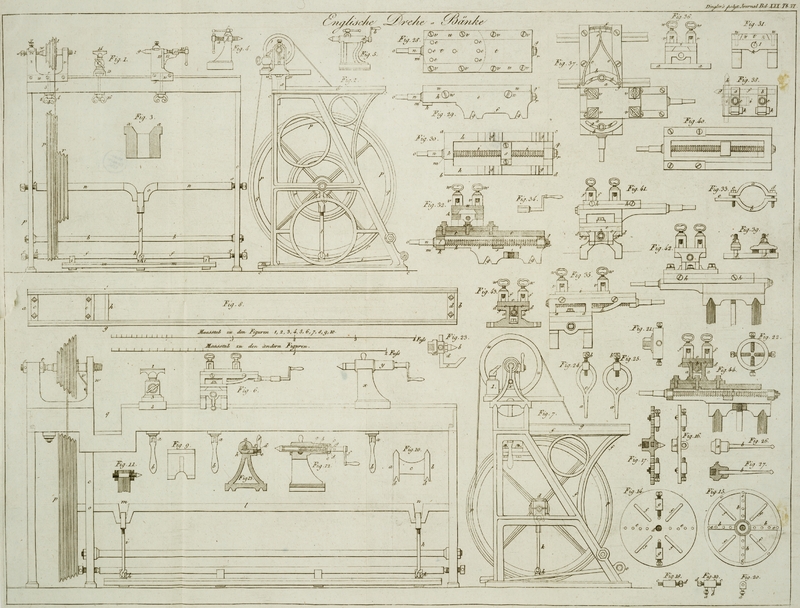| Titel: | Die englische Drehebank, beschrieben von Dr. Ernst Alban. |
| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |
| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. LXII., S. 248 |
| Download: | XML |
LXII.
Die englische Drehebank, beschrieben von Dr.
Ernst
Alban.
Mit Abbildungen auf Tab.
V. und VI.
Alban's englische Drehebank.
Der Hr. geheime Oberfinanzrath Beuth in Berlin hat in den
Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des Gewerbfleißes in Preußen eine
sehr gute Beschreibung einer englischen Drehebank kleinerer Art und vortreffliche
Abbildungen dazu geliefert.Sie sind auch im polytechn. Journ. Bd.
XXIV. S. 214 aufgenommen worden, wo man sie nachsehen kann. (Wir
bedauern sehr, daß wir nicht auch eben so schoͤne geschnittene
Kupferabbildungen, wie die von den Gewerbsverhandlungen liefern
koͤnnen. A. d. R.) Diese Drehebank ist nach dem Maudslay'schen
Principe eingerichtet, und von Rich in London erbaut, und
enthaͤlt eine Menge der vorzuͤglichsten Einrichtungen, wodurch sich
die englischen Drehebaͤnke auszeichnen. Vornehmlich muͤssen wir dem
Hrn. G. O. F. R. Beuth aber Dank wissen fuͤr die
Mittheilung einer Beschreibung und Abbildung der in England so allgemein
gebraͤuchlichen, in Deutschland aber groͤßtentheils noch wenig
bekannten und in Anwendung gekommenen, mechanischen Vorlage.
Da ich in England Gelegenheit gehabt habe, eine Menge Drehebaͤnke von
vorzuͤglicher Construction und in allen moͤglichen Groͤßen zu
sehen und zu zeichnen, und die AufnahmeDiese Aufnahme war gewoͤhnlich mit bedeutenden Schwierigkeiten
verknuͤpft, indem, man mir ein Zeichnen an Ort und Stelle stets
verwehrte, und ich daher nur zu Hause das Aufgefaßte zu Papier bringen
konnte. Dieserhalb war es mir nicht moͤglich, bei einigen der
groͤßeren Drehebaͤnke alle Maße genau. zu geben, vielmehr
konnte ich nur das Princip derselben niederzeichnen. Genau genommen ist
dieses aber auch der Hauptpunct bei der Sache. Man will die Mittel kennen,
diesen oder jenen Zwek in der Drehekunst zu erreichen. Die
Ausfuͤhrung und Anwendung derselben nach bestimmten Regeln wird jeder
Mechaniker schon ohne große Muͤhe von selbst finden, der in seinem
Fache etwas mehr als ein bloßer Handwerker ist. derselben allein in der Absicht von mir unternommen wurde, um meinem
Vaterlande durch Mittheilung derselben nuͤzlich zu werden, so moͤge
mir der Hr. G. O. F. R. Beuth es nicht uͤbel
deuten, wenn ich seiner vortrefflichen Beschreibung und Abbildung in diesem Journale
dasjenige anzureihen mich bemuͤhen werde, was ich zur
Vervollstaͤndigung unserer Kenntnisse in der Drehekunst und der dahin
gehoͤrigen Apparate zu liefern vermag. Das Beduͤrfniß einer
naͤheren Bekanntschaft mit diesen Apparaten wird in Deutschland von Tage zu
Tage groͤßerDas bekannte neuere Werk von Dr. J. H. M. Poppe: die englische Drehebank fuͤr
Arbeiter in Holz, Metall und Horn, ist sehr unvollstaͤndig. Es ist
eigentlich auch nur eine bloße Uebersezung aus Thom. Martins Encyklopaͤdie der mechanischen Kuͤnste
etc.
und fuͤhlbarer
und der wahre Vaterlandsfreund kann daher nicht genug eilen, sein Scherstein zur
Befriedigung desselben darzubringen, und sey es auch noch so gering. Ein
gemeinschaftliches Zusammenwirken fuͤr einen nuͤzlichen Zwek ist ein
Hauptbefoͤrderungsmittel desselben. Sollte meine Mitwirkung zu gering seyn,
so wird mich das Gefuͤhl der reinsten Absicht und des besten Willens
beruhigen muͤssen.
Man kann die in England bei der Maschinenfabrication gebraͤuchlichen
Drehebaͤnke in Hinsicht ihrer Groͤße wohl in 4 Abtheilungen bringen,
d.h. in kleinere, klein mittlere, groß mittlere und große. Erstere beiden Arten
werden in den meisten Faͤllen von dem daran beschaͤftigten Arbeiter
durch einen Fußtritt in Bewegung gesezt, leztere aber entweder durch einen oder
mehrere Menschen, die an einem Schwungrade drehen, oder durch Elementarkraft
betrieben. Alle diese vier Arten, von denen ich die allerkleinsten, in der
Uhrmacherkunst gebraͤuchlichen und mit dem Bogen gedrehten ausnehme, sind
nach sehr verschiedenen Principien gebaut, indem jeder Mechaniker, wie Hr. G. O. F.
R. Beuth sehr richtig bemerkt, dabei seinen
verschiedenen Ansichten folgt. Ich will versuchen, uͤber diejenigen
besonderen Einrichtungen, die die von mir gesehenen Drehebaͤnke unter
einander auszeichneten, zuerst einige Worte im Allgemeinen zu sagen, bevor ich zu
der specielleren Beschreibung der Drehebaͤnke uͤbergehe. Ich erspare
dadurch bei lezterer viele Worte, und erleichtere die Uebersicht uͤber die
dem Baue aller Drehebaͤnke zum Grunde liegenden verschiedenen Principien.
Zugleich will ich mich aber auch hie und da bemuͤhen, so viel ich vermag,
jedem besonderen Principe den ihm gebuͤhrenden Plaz in der Drehekunst
anzuweisen, und dessen groͤßeren oder minderen Werth fuͤr besondere
Faͤlle zu bestimmen.
Die Hoͤhe der englischen Drehebank, d.h. vom Fußboden bis zur Achse des zu
drehenden Koͤrpers gerechnet, ist bei allen vier
Groͤßenverhaͤltnissen fast gleich, naͤmlich 3 Fuß bis 3 Fuß 6
Zoll engl. Maßes; diese Hohe entspricht am besten der mittleren menschlichen
Groͤße. Bei groͤßeren Drehebaͤnken, woran fast
bestaͤndig mit der mechanischen Vorlage gearbeitet wird, ist die Hoͤhe
indessen eher geringer als an kleineren, damit der Arbeiter, den die mechanische
Vorlage an einer genuͤgenden Annaͤherung seines Koͤrpers an den
zu drehenden Gegenstand behindert, den oberen Theil seines Leibes gehoͤrig
uͤber diese neigen koͤnne, um seine Augen der Arbeit naͤher zu
bringen.
Was den Tritt an den kleineren Drehebaͤnken
betrifft, so ist derselbe stets von derjenigen Einrichtung, die Hr. G. O. F. R. Beuth
beschrieben und
abgebildet hat. Die Kurbel der Schwungradwelle liegt meistens in der Mitte der
Drehebank, damit ihre Verbindung mit dem Tritte moͤglichst im Centrum
desselben geschehe. Auf diese Weise hat der Tritt gehoͤrige Staͤrke,
und man mag auf demselben an einer Stelle treten, auf welcher man will, so entfernt
man sich nirgends zu sehr von seinem Aufhaͤngepuncte an der Kurbel, wodurch
ein Wanken desselben verhuͤtet wird. Bei sehr langen Drehebaͤnken
findet man auch wohl 2 Kurbeln nahe an den beiden Enden der Schwungradwelle, von den
2 Zugstangen zum Tritt herunter gehen. Diese Einrichtung gibt dem Tritte viel
Festigkeit in seiner Bewegung. Derjenige Theil des Trittes, der mit den
Fuͤßen beruͤhrt und getreten wird, ist immer von einem harten Holze
gemacht. Er wird an mehrere eiserne Arme angeschroben, die von derjenigen Welle
kommen, welche das Hypomochlium des Trittes bildet, und an dem hinteren und unteren
Theile des Drehebankgestelles, ungefaͤhr 4 Zoll hoch uͤber dem
Fußboden, sich gewoͤhnlich zwischen 2 staͤhlernen Spizen, oder auch
mit Zapfen in kleinen Lagern, bewegt. Der Tritt ist vom Centrum seiner Welle bis zu
Ende des hoͤlzernen Fußtrittes in der Regel 2 Fuß und etwas mehr lang. Die
Verbindungsstange zwischen ihm und der Kurbel haͤngt mit einem Haken in einem
eisernen Oehr seines mittleren Armes. Ihr Aufhaͤngepunct liegt
gewoͤhnlich auf 3/5 der ganzen Laͤnge des Trittes vom Centrum seiner
Welle entfernt. Der vordere Rand des Trittes springt nur um wenige Zolle vor den
Wangen der Drehebank hervor, um das Treten nicht zu erschweren.
Die Verbindungsstange zwischen Tritt und Kurbel hat unten
zur beweglichen Befestigung an den Tritt eben genannten Haken, am oberen Ende einen
gleichen von Rothguß. Dieser ist jedoch breit gearbeitet und haͤngt
uͤber der Warze der Kurbel. Er ist so breit als diese, damit er auf derselben
keinen Spielraum habe. In seinem Koͤrper befindet sich gewoͤhnlich ein
muͤtterliches Gewinde, in welches die Verbindungsstange eingeschroben wird,
durch mehreres oder geringeres Einschrauben kann selbige nach Beduͤrfniß
verlaͤngert oder verkuͤrzt werden.
Bei manchen Verbindungsstangen sieht man anstatt dieser Einrichtung zum Berichtigen
ihrer Laͤnge in ihrer Mitte eine Huͤlse mit 2 Gewinden, von denen das
eine verkehrt laͤuft. Die Verbindungsstange wird auf beiden Enden in diese
Huͤlse hineingeschroben, sie besteht also hier aus 2 Haͤlften. Beim
Drehen der Huͤlse werden beide Enden in der Huͤlse wegen der
verschiedenen Einrichtung der Gewinde entweder genaͤhert oder entfernt. Die
Huͤlse ist von Rothguß und mit einem erhabenen Stellringe zur bequemeren
Handhabung versehen. – Diese Einrichtung hat den Vortheil, daß man die Laͤnge der
Verbindungsstange beliebig veraͤndern kann, ohne den oberen Haken
aushaͤngen zu duͤrfen.
Fig. 2 Tab. V.
sieht man die erstere Art der Verbindungsstange. f, ist
der obere Haken von Rothguß. Er hat bei, g, in seinem
Koͤrper das Gewinde. h, ist die
Verbindungsstange, i, ihr unterer Haken, in das Oehr,
e, des Tritts eingehaͤngt.
Fig. 3 ist
eine aͤußere Ansicht der Huͤlse, Fig. 4 ein Durchschnitt
derselben. a, und, b, sind
die beiden Enden der Verbindungsstange, c, der Stellring
der Huͤlse.
Die Schwungradwelle ist immer von geschmiedetem Eisen und
gut abgedreht. Bei kleineren Drehebanken laͤuft sie auf staͤhlernen
Spizen, und ist an ihren Enden verstaͤhlt. Die Spizen werden bis zur
strohgelben Hize temperirt. Bei groͤßeren hat sie Endzapfen, die in mit
Rothguß ausgebuchsten Lagern des Gestelles laufen. Die Wellen duͤrfen nicht
zu schwach seyn, weil sie sich sonst bei starkem Treten federn oder gar verbiegen
wuͤrden. Der Durchmesser derselben richtet sich theils nach der
beabsichtigten Wirkung der Drehebank, ob stark oder schwach getreten werden muß,
theils nach ihrer Laͤnge im Verhaͤltnisse zu dieser. Kleine
Drehebaͤnke sind gewoͤhnlich 3 bis 4 Fuß, klein mittlere 6–8
Fuß lang. Bei ersteren ist es hinreichend, wenn die Welle einen Durchmesser von 5/4
Zoll hat, bei lezteren geht er nicht selten uͤber 2 Zoll. Diese Art der
Drehebaͤnke hat auch gewoͤhnlich 2 Kurbeln und 2 Verbindungsstangen.
Die Kroͤpfung der Kurbel oder Kurbeln betraͤgt gewoͤhnlich 2
bis 2 1/2 Zoll, sehr selten mehr.
Das Schwungrad ist in der Regel von Gußeisen, und meistens
mit 2 Kraͤnzen, einem groͤßeren und einem kleineren, versehen. Der
groͤßere Kranz ist gewoͤhnlich etwas staͤrker gegossen, und
bildet zugleich den Schwungring. Der kleinere wird fast immer angeschroben. Die
Ruthen oder Gange beider Kranze werden auf der Drehebank ausgedreht, damit sie genau
centrisch laufen. Sie stehen im umgekehrten Verhaͤltnisse zu denen der
Spindelscheibe. Ihrer sind, sowohl am großen als kleinen Kranze, gewoͤhnlich
2 bis 6. Zu beiden Kraͤnzen ist eine besondere Schnur vorhanden. Eine und
dieselbe Schnur paßt immer zu allen Gaͤngen desjenigen Kranzes, zu welchen
sie gehoͤrt. Soll die Spindelscheibe mit dem kleinen Kranze in Verbindung
gesezt werden, so muß ihre Doke so viel auf den Wangen verruͤkt werden, daß
ihre Ruthen perpendiculaͤr uͤber die des kleineren Kranzes zu stehen
kommen.
Zu Schnuͤren bedient man sich allgemein der
Darmsaiten, deren Enden in eine kleine staͤhlerne oder messingene
Huͤlse geschroben und so vereinigt werden. Oft besteht diese Vorrichtung auch
aus 2 besonderen
Huͤlsen, die mit staͤhlernen Haken versehen sind, und auf diese Weise
in einander gehaͤngt werden koͤnnen. Diese Einrichtung hat den
Vortheil, daß man die Enden der Schnur trennen kann, ohne sie aus den Huͤlsen
herausschrauben zu duͤrfen. Da ich diese Einrichtung wohl als allgemein
bekannt voraussezen darf, so will ich ihrer weiter nicht beruͤhren.
Die Gestelle der englischen Drehebaͤnke sind fast
alle von Gußeisen. Sie bestehen aus 2 oder 3 Stendergeruͤsten, auf denen die
Wangen ruhen und durch Schrauben befestigt sind. Sie sind nach unten auf dem
Fußboden festgeschroben, und noch unter sich durch Riegelstangen verbunden, um die
gehoͤrige Festigkeit und Unerschuͤtterlichkeit hervorzubringen. Hinter
den Wangen befindet sich gewoͤhnlich eine Art hoͤlzerner Tischplatten
von 1 Fuß bis 18 Zoll Breite, die an's Gestell mit befestigt wird und zum
Aufbewahren und Weglegen der Dreheinstrumente waͤhrend der Arbeit dient. In
manchen Drehebanken sind die Lager fuͤr. die Schwungradwelle oder ihre
Schizen verschiebbar (d.h. auf und nieder), damit die Schnur immer gehoͤrig
gespannt werden koͤnne. Die Einrichtung einer solchen Stellvorrichtung hat
Hr. G. O. F. R. Beuth deutlich beschrieben, daher ich
davon schweige.
Die Achse der Schwungradwelle liegt nie perpendiculaͤr unter der der Spindel,
sondern immer etwas nach hinten geruͤkt. Die Groͤße dieser Abweichung
wird durch den Aufhaͤngepunct der Verbindungsstange an dem Tritte bestimmt,
welcher Punct mit der Achse der Schwungradwelle stets in einer Linie liegen muß.
Die Wangen oder Bahnen werden in England sehr verschieden
construirt. Die Anwendung eines Prisma statt zweier Bahnen ist daselbst nicht sehr
gewoͤhnlich. Man findet selbiges fast nur n der
Maudslay'schen Werkstaͤtte, hier aber auch
selbst an den groͤßten Drehebaͤnken eingefuͤhrt. Seine
Ausfuͤhrung hat indessen in der That mehr practische Schwierigkeiten, als die
gewoͤhnlichen Einrichtungen. Es erfordert bei seiner Verfertigung mehr Arbeit
und mehr Accuratesse, und hat dennoch nicht den Grad der Festigkeit, wie jene. Zu
seiner Befestigung auf dem Gestelle sind eigene Apparate noͤthig, die die
Menge der zu arbeitenden Theile fuͤr die Drehebank unnoͤthig
vermehren, dieselbe complicirter machen, und ihre Kosten erhoͤhen, da doch
die gewoͤhnlichen Wangen unmittelbar an das Gestelle befestigt werden
koͤnnen. Auch erfordert die Application der Doken und Vorlagen darauf
kuͤnstliche Einrichtungen und Vorrichtungen. Hr. G. O. F. R. Beuth hat alle diese Einrichtungen, so wie die ganze
Drehebank nach diesem Principe sehr genau beschrieben und abgebildet, so daß ich
nichts in der Folge hinzuzufuͤgen vermag, als zu erinnern, daß die
groͤßeren Drehebaͤnke in der Maudslay'schen
Werkstaͤtte ganz und in allen ihren Theilen nach dem naͤmlichen
Principe gearbeitet sind.
Die gewoͤhnlichste Form der Wangen ist diejenige, die Tab. V. Fig. 5 von oben und Fig. 6 im
Querdurchschnitte vorgestellt ist. Die obere Flaͤche, a, derselben ist von beiden Seiten schraͤg oder dachartig abgefeilt
und gerichtet. Sie bildet mit der Grundflaͤche der beiden Abdachungen im
Durchschnitte ein gleichseitiges Dreiek, dessen oberer Winkel etwas flach
abgestumpft ist, wie in Fig. 7 zu sehen ist. Beide
Wangen sind von Gußeisen, und bilden mit den sie verbindenden Endstuͤken, b, und, c, und Querriegeln
oder Bruͤten, d, einen einzigen, aus einem
Stuͤke gegossenen Koͤrper. In Fig. 8 und 9, a, sieht man eine der Bruͤken in verschiedener Form. Zuweilen
finden sich auch 2 derselben unter einander. Die einzelnen Bruͤken dienen zur
innigeren und dauerhafteren Verbindung der Wangen mit einander und sind nach
Beduͤrfniß in groͤßeren oder geringeren Zwischenraͤumen von 3
bis 4 Fuß angebracht. Um den Wangen selbst noch mehr Steifigkeit zu geben, sind hie
und da auch Rippen, sowohl nach innen als nach außen an denselben angegossen, die
z.B. bei den Fox'schen Drehebaͤnken sehr weit nach
innen vorspringen und hier ordentliche Tafeln bilden, welche nur einen geringen
Zwischenraum zwischen sich lassen, worin die Anziehebolzen fuͤr die Doken und
Vorlage liegen. Bei solchen Wangen fehlen nicht selten die Bruͤken ganz. In
Fig. 10
und 11 sieht
man dergleichen mit groͤßeren und kleineren Rippen versehene Wangen im
Durchschnitte.
Hie und da habe ich auch bei groͤßeren Drehebaͤnken Wangen von starkem
Holze gesehen, auf welches prismatische Bahnen angeschroben waren (Fig. 12 im
Durchschnitte).
Alle Doken und Vorlagen haben correspondirende Ausschnitte fuͤr die Bahnen,
mit denen sie auf selbigen hin- und hergleiten. Die Ausschnitte sind sehr
genau auf die Bahnen geschlissen und zuweilen mit Rothguß ausgefuͤttert.
An allen Fox'schen Drehebaͤuken ist nur die eine
Bahn dachfoͤrmig abgeschliffen, waͤhrend die andere flach gearbeitet
ist. Die Zurichtung solcher Wangen ist mit weit weniger Muͤhe verbunden, als
die der vorher beschriebenen. Wenn nur die dachartig gearbeitete gehoͤrig
Flucht halt, so kann die flache Bahn schon eher Seitenbiegungen (aber auch nur
Seitenbiegungen) ohne Schaden machen, da die obere Flaͤche derselben sehr
genau die Horizontallinie halten muß. In Fig. 11 ist ein
Durchschnitt der Fox'schen Wangen dargestellt.
Außer dieser Art von Wangen hat man noch eine andere, a welchen alle Bahnen flach
sind. Die Wangen sind meistens mit den sie verbindenden Endstuͤken aus einem Stuͤke
in der in Fig.
13 bezeichneten Form gegossen. Fig. 14 zeigt einen
Durchschnitt derselben. Die Bahnen liegen an der Außenkante der Wangen, eine nach
oben (Fig.
14, a, a), eine nach der Außenseite, b, b. Sie springen, gegen den Koͤrper der Wangen
gehalten, etwas vor, und werden gleich so gegossen, um desto leichter abgerichtet
und abgeschliffen zu werden. Die Doken und Vorlagen liegen flach darauf, und haben
zu beiden Seiten 2 Streichplatten (Fig. 14, a, und, b) von Rothguß, die
an den Seitenbahnen, c, und, d, gleiten und durch Schrauben an den Doken befestigt sind. Diese Platten
verhuͤten jede Seitenbewegung der Doken, und halten ihren Gang auf den Bahnen
stets genau parallel mit diesen. Einmal sah ich solche Wangen hohl gegossen und
einzeln an die Stendergeruͤste in der Art angebolzt, wie in Fig. 16 dargestellt
ist.
Man findet diese Form von Wangen meist nur bei kleinen und klein mittleren
Drehebaͤnken. Bei kleinen sieht man auch oft den unteren Rand der Bahnen, c, und, d (Fig. 15) abgerichtet, und
dann die Streichplatten mit einer Leiste versehen, die uͤber den Rand greift,
wie in Fig.
15 auf der rechten Seite zu sehen ist. Durch diese Einrichtung wird das
Abfallen der Doken von den Bahnen verhuͤtet, wenn ihre Anziehebolzen
geloͤset werden.
Die Befestigung der Wangen auf die Stendergeruͤste oder gußeisernen
Boͤte (bei groͤßeren Drehebaͤnken) geschieht durch die
Endstuͤke. Hievon jedoch ausfuͤhrlich bei der speciellen Beschreibung
der verschiedenen Drehebaͤnke; so auch von der noͤthigen Entfernung
derselben und ihrer Bahnen von einander, bei der verschiedenen Form und
Groͤße derselben.
Die Spindeldoken bestehen bei den englischen
Drehebaͤnken immer von Gußeisen, und stehen auf einer Platte, wodurch beide
vereinigt werden, und mit welcher sie auf den Wangen ruhen. Fast alle Spindeldoken
mit ihrer Verbindungsplatte (zusammen am besten das Spindelgestell genannt) haben
mehr oder weniger einerlei Form, und so viel der Drehebaͤnke ich gesehen
habe, so konnte ich, hinsichtlich der Aufstellung der Spindel darin, nur 3 Methoden
entdeken, die als wesentlich verschieden angenommen zu werden verdienen.
1) Bei der ersten Fig. 17 und 18 laͤuft die
Spindel vor dem sogenannten Spindelkopfe in einem staͤhlernen Ringe der
inneren Spindeldoke, der in selbige eingesezt und glashart ist, und auf beiden
Seiten der Doke etwas hervortritt. Derselbe ist cylindrisch ausgebohrt, und an der
nach der Spindelscheibe hinsehenden Muͤndung seiner cylindrischen Oeffnung
konisch versenkt, nach Art eines Ventilsizes fuͤr ein gewoͤhnliches
Kegelventil. Die gleichfalls glasharte staͤhlerne Spindel laͤuft mit
ihrem cylindrischen Zapfen in dem cylindrischen Canale des Ringes, und ist genau in
denselben eingeschliffen, fuͤr die konische Vertiefung des Ringes hat sie
aber einen Anlauf, der genau in selbige paßt und gleichfalls eingeschliffen ist.
Dieser Anlauf erleichtert den Gang der Spindel, da sie, wenn der ganze Zapfen
konisch gearbeitet waͤre, sich einklemmen und schwer umlaufen wuͤrde.
Um dem Zapfen der Spindel im Ringe Schmiere geben zu koͤnnen, dringt von dem
obern Theile der Doke ein Schmierloch bis auf den Zapfen, welches mit einem
Metallstoͤpsel verschlossen werden kann. Sehr haͤufig fehlt dieses
Schmierloch aber auch, vorzuͤglich bei kleineren Drehebaͤnken. Man
bringt dann das Fett von außen an die Spindel.
Bei kleinern Drehebaͤnken sind gewoͤhnlich die ganzen Spindeln von
Stahl und ihre Enden glashart, bei groͤßern aber nur von Schmiedeeisen. Auf
den Zapfen ist dann ein glasharter staͤhlerner Ring, mit dem besagten Anlaufe
versehen, geschoben, am entgegengesezten Ende der Spindel aber ein Stuͤk
harten Stahls mit der Versenkung fuͤr die Spize eingesezt.
Das andere Ende der Spindel laͤuft auf einer Spize, die sich an einem
staͤhlernen Cylinder befindet, welcher die aͤußere Doke durchbohrt und
in dieselbe genau eingeschliffen ist. An beiden Enden, wo der Cylinder vor der Doke
vorsteht, hat er Gewinde, und wird hier durch eine Mutter und Gegenmutter an
derselben befestigt. Zugleich erlaubt diese Einrichtung aber auch, die Spize mehr
oder weniger gegen die Spindel an zu stellen.
An manchen kleinern Drehebaͤnken hat die Spindel an diesem Ende eine Spize,
mit welcher sie in der Vertiefung einer staͤhlernen Schraube laͤuft,
die in die Doke eingeschroben wird.
Die erste Art der Spindelaufstellung in dem Spindelgestelle, wobei die Spindel theils
in einem Futter, theils auf einer Spize laͤuft, ist, wie schon bemerkt, in
Fig. 17
und 18
vorgestellt, und zwar Fig. 17 von außen, Fig. 18 im
perpendiculaͤren Langedurchschnitte. A, ist die
innere, B, die aͤußere Spindeldoke. Leztere ist
immer staͤrker als die erstere. Beide sind durch die mit ihnen aus einem
Stuͤke gegossene Platte, C, verbunden, die auf
den Wangen ruht. Die Platte, C, wird auf verschiedene
Weise auf den Wangen befestigt. Die bei Anwendung eines Prisma uͤbliche
Befestigung hat Herr G. O. F. R. Beuth deutlich
geliefert, daher ich davon schweige. Bei der gewoͤhnlichen Art der Wangen mit
dachartigen Bahnen hat die Platte 2 Einschnitte, die der Form der Bahnen
entsprechen. Sie wird durch einen oder 2 Schraubenbolzen an die Wangen angezogen.
Die Bolzen gehen zwischen beiden Wangen abwaͤrts, durchbohren eine quer unter
denselben liegende Platte, und sind unter derselben mit einem Gewinde und einer
Mutter, (bei kleinem Drehebaͤnken einer großen Fluͤgelmutter) zum Anziehen versehen.
Bei den Fox'schen Drehebanken ruht die Gestellplatte
nicht auf den Bahnen der Wangen, sondern auf den inwendigen breiten Rippen
derselben; bei den Wangen mit flachen Bahnen hat sie aber, wie schon oben
beruͤhrt worden, Streichplatten.
Bei, a, Fig. 18 sieht man den in
die innere Doke eingesezten Ring, bei, b, den
cylindrischen Zapfen der Spindel, bei, c, den konischen
Anlauf, bei, d, das Schmierloch. In Fig. 19 ist diese
Einrichtung fuͤr eine groͤßere Drehebank besonders vorgestellt. Man
bemerkt hier bei, a, den auf die Spindel geschobenen
Stahlring mit dem Anlauf, b, als besondern Theil.
Fig. 18, e, ist die Spize der Doke, B,
F, ein cylindrischer in die Doke eingeschliffener Theil derselben, l, und, m, sind Mutter und
Gegenmutter zum Stellen derselben.
Man sieht diese Art der Aufstellung der Spindel im Spindelgestelle am
haͤufigsten und selbst an den groͤßten Drehebanken, jedoch habe ich
bei leztern haͤufig Klagen gehoͤrt uͤber das Wankende solcher
Spindeln, wenn große Ebenen oder Oberflaͤchen auf Platten sehr genau
abgedreht werden sollen. In der That koͤnnen aber auch bei großer
Kraftanwendung auf solchen Drehebanken, und vielem Gebrauche derselben, an der Spize
und der Versenkung fuͤr dieselbe in der Spindel, leicht Unrichtigkeiten
vorfallen. Das allermindeste Abschleifen der Spize, ein hoͤchst unbedeutendes
schiefes Ausschleifen der Versenkung, das geringste Schlottern zwischen beiden
Theilen hebt aber augenbliklich den exacten Gang der Spindel auf und die
Wiederherstellung desselben erfordert viele Muͤhe und Arbeit, und verursacht
unnoͤthigen Zeitverlust. Fuͤr große Drehebaͤnke ist auf alle
Faͤlle
2) Diejenige Methode vorzuziehen, die Herr Fox in Derby
zur Aufstellung feiner Spindeln befolgt. Dieser laͤßt beide Spindelenden in
hartstaͤhlernen und in die Doken eingesprengten Ringen laufen. Die Art, wie
er dieß bewerkstelligt, ist Fig. 20 im
Laͤngedurchschnitte abgebildet. a, ist die
Spindel von geschmiedetem Eisen, b, die große
Drehescheibe. Sie ist auf das Gewinde, c, der Spindel
oder auf den Spindelknopf aufgeschroben und sizt fuͤr immer darauf fest. Bei,
d, kann eine Spize in dieselbe eingeschroben werden.
Durch das Anschrauben der Drehescheibe wird zugleich der glasharte staͤhlerne
Ring, e, auf den Zapfen, f,
der Spindel festgehalten. Er hat bei, g, einen Anlauf,
und arbeitet in dem staͤhlernen glasharten Ringe der Doke, in welchen er
fleißig eingeschliffen ist. Am andern Ende verjuͤngt sich bei, h, die Spindel. Auf den Zapfen, i, (er ist nur 1/3 schwaͤcher als der Zapfen, f) desselben wird gleichfalls der glasharte
staͤhlerne Ring, k, geschoben, der in dem Ringe,
l, der aͤußern Doke laͤuft. Der Ring,
k, wird durch eine starke Mutter, m, angezwaͤngt, die auf das Gewinde, n, des verlaͤngerten Zapfens, i, geschroben wird. Beim gehoͤrigen Anziehen der
Mutter werden beide Anlaufe der Ringe, e, und, k, gegen die in die Doken eingesprengten Ringe
angedraͤngt, wodurch der Gang der Spindel hoͤchst fleißig und sicher
wird. Die Ringe, e, und, k,
sind vor dem Drehen auf dem Zapfen, f, und, i, der Spindel durch kleine, an der Spindel angebrachte
erhabene Leisten geschuͤzt, die in kleinen auf der innern Seite der Ringe
eingeschnittenen Furchen liegen. Bei, o, druͤkt
noch eine Stellschraube mit einer Spize gegen das Ende, p, der Spindel, die durch die Mutter, q, in
der gegebenen Stellung befestigt werden kann, r, ist ein
Getriebe mit seiner Mutter, s, das dazu dient, um die
Bewegung der Spindel auf mehrere Organe der Drehebank zu uͤbertragen. In Fig. 21 sieht
man das Spindelgestell dieser Vorrichtung von einen der beiden Enden.
3) Noch eine dritte Methode der Aufstellung von Spindeln im Spindelgestelle, die sich
vorzuͤglich fuͤr Drehebaͤnke von groͤßtem Schlage
eignet, ist diejenige, wobei die Spindel Fig. 22, A, sich mit 2 Zapfen, a,
und, b, in gewoͤhnlichen mit Rothguß
ausgebuchsten Lagern dreht, die auf den Doken, B, und,
C, angebracht sind. Man sieht diese Art der
Aufstellung in England nur sehr selten, obgleich sie sehr einfach und sicher ist,
auch die Spindel immer in einem exacten Gange erhaͤlt, so daß sie selbst bei
kleinem Drehebaͤnken Anwendung verdient. Um die Spindel vor Hin- und
Herbewegung zu sichern, sind die Zapfen der Spindel mit gehoͤrigen Schultern
versehen, auch reibt sich das mit einem glasharten Stahleinsaze vor Abnuzung
gesicherte Ende, c, der Spindel gegen die
staͤhlerne Stellschraube, d, die zur Sicherung
ihrer Stellung mit einer Stellmutter, e, versehen ist.
Um die Einrichtung der Lager mehr zu versinnlichen, ist in Fig. 23 eine der Doken
mit ihrem Lager von der Seite dargestellt.
Diejenige Spindelscheibe, deren Beschreibung der Herr G.
O. F. R. Beuth faßlich und vollstaͤndig liefert,
ist nur bei den Drehebaͤnken der 2 untersten Classen gebraͤuchlich,
und ihre Form und Beschaffenheit selten bedeutend verschieden. Die Anzahl der Ruthen
daran ist sehr ungleich. Bei klein-mittlern Drehebaͤnken sieht man
statt der Scheiben mit Nuthen oft auch mehrere Riemenscheiben. Die Nuthen sind an
der Scheibe, so wie am Schwungrade, stets scharfwinklicht, so daß die Schnur dadurch
gekniffen und so die Friction zwischen beiden vermehrt wird. Theilscheiben findet
man nur an wenigen Scheiben. Sind sie vorhanden, so sind sie und die dazu gehoͤrige Feder
mit ihrem Stifte ganz so eingerichtet, als Herr G. O. F. R. Beuth angegeben hat.
Bei großen Drehebaͤnken bedient man sich selten der Scheiben mit Muthen, da
diese zum Betrieb derselben nicht hinreichen wuͤrden. Vielmehr hat man große
gezahnte Betriebsraͤder (Fig. 22, f) noͤthig, oder gebraucht auch mehrere große
Riemenscheiben (Fig. 22, g, h, und i), die durch Elementarkraft in Bewegung gesezt werden. Weiter unten mehr
davon.
Auf den Spindelkopf der Spindel werden entweder eine groͤßere oder kleinere
Drehescheibe, nach den verschiedenen Zweken des drehenden Individuums, oder ein
Futter mit einer Spize oder andere Futter zur Befestigung besonders geformter
Koͤrper aufgeschroben.
Die Drehescheiben sind von verschiedenem Durchmesser. Auf
kleinen Drehebanken braucht man sie selten, desto mehr auf den groͤßern. Auf
den groͤßten sind sie gewoͤhnlich unzertrennlich mit der Spindel
verbunden. Wegen ihrer Groͤße Und bedeutenden Schwere wuͤrde ihre
Abnahme von der Spindel und das noͤthige Wiederanschrauben auch mit großen
Umstaͤnden verbunden seyn. Sie sind mit vielen Loͤchern versehen, und
haben hie und da auch langlichte Schlizen. Loͤcher und Schlizen sind immer in
die Radien der Scheiben gesezt. Durch beide Theile werden die Bolzen zur Befestigung
der darauf zu drehenden Maschinentheile gestekt. Hievon jedoch unten
ausfuͤhrlicher.
Will man vor 2 Spizen drehen, so wird ein Futter von Rothguß oder Gußeisen auf den
Spindelkopf geschroben, das mit einer Spize versehen ist, die gewoͤhnlich
konisch in das Futter eingeschoben ist. Dasselbe enthaͤlt zugleich quer durch
seinen Koͤrper eine vierekige Oeffnung, wodurch ein Haken gestekt und durch
eine Stellschraube in seiner Stellung befestigt, werden kann. Er dient dazu, das auf
dem abzudrehenden Stuͤke festgespannte Herz herum zu werfen, und so das
Stuͤk zu drehen. Bei groͤßern und ganz großen Drehebaͤnken
werden die Spizen, wie vorhin schon bemerkt worden, in das Centrum der Drehescheibe
eingeschroben (s. Fig. 20, d, 22, k). Abbildungen von diesen Theilen bei Beschreibung der
einzelnen Drehebaͤnke.
Außer diesem Futter mit der Spize hat man auch noch eines mit einer vierekigen
Oeffnung in seiner Achse, worin Bohrer befestigt werden koͤnnen, wenn auf der
Drehebank gebohrt werden soll. Man sezt dann den zu bohrenden Koͤrper gegen
den durch die Spindel gedrehten Bohrer und druͤkt ihn dadurch gegen diesen
an, daß man die Gegenspize vermittelst ihrer Schraube gegen selbigen stemmt und
fortwaͤhrend anschraubt. Zwischen den zu bohrenden Koͤrper und die Gegenspize schiebt
man etwas hartes Holz oder Blei. Der Bohrer kann dann weder die Spize noch sich
selbst beschaͤdigen, wenn er den Koͤrper durchdringt.
Die Doke fuͤr die Gegenspize hat allemal eine
groͤßere Basis, damit sie gehoͤrige Festigkeit bei ihrer Stellung auf
den Bahnen der Wangen gewinne, und ihre Spize sich immer parallel mit den Bahnen
bewege. Diese Basis bildet daher haͤufig ein Quadrat und ist auf ihrer untern
Flaͤche, wie die Verbindungsplatte des Spindelgestells, nach Maßgabe der Form
der Bahnen verschieden geformt. Der obere Theil derselben ist durchbohrt, und
traͤgt die Gegenspize, welche sich an dem Ende eines staͤhlernen
Cylinders befindet. Dieser ist in die Doke luftdicht eingeschliffen. Fig. 24 und 25 sieht man
eine solche Doke von der gewoͤhnlichen Einrichtung und zwar Fig. 24 im Aufrisse, Fig. 25 im
perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitte, a,
ist die auf den Wangen ruhende Bodenplatte, die durch einen Schraubenbolzen, wie am
Spindelgestelle, an selbige angezogen werden kann; b,
ist der obere Theil der Doke mit dem Canale, worin die Gegenspize, c, mit ihrem cylindrischen Koͤrper stekt. Um
leztere in einer bestimmten Stellung befestigen zu koͤnnen, dient die
Schraube, d, die aber beim Anziehen den Cylinder nicht
selbst beruͤhrt, sondern mittelbar durch eine eiserne Platte, e, auf ihn druͤkt, die von vorne uͤber den
Cylinder in die Doke eingeschoben ist, und uͤber dem Cylinder etwas nach der
Form desselben ausgeschnitten wird. Beim Einschleifen des Cylinders in die Doke wird
dieses Stuͤk Eisen vorher eingesezt und selbiger in den Ausschnitt desselben
mit eingeschliffen. Fig. 26 sieht man die Doke im perpendiculaͤren Querdurchschnitte.
c, ist hier der Cylinder, e, (dunkler schattirt) die eiserne Platte, d,
die Schraube. Bei einigen Drehebaͤnken sieht man andere Vorrichtungen zur
Feststellung des Cylinders, sie sind weniger im Gebrauche, wenn gleich einfach und
zwekmaͤßig genug. Fig. 27, 28 und 29 ist eine dergleichen
abgebildet und zwar Fig. 27 im Aufrisse; Fig. 28 von oben, und
endlich Fig.
29 vom Ende angesehen. a, ist ein
Buͤgel, dessen beide Schenkel b, b, durchbohrt
sind, und den Cylinder der Gegenspize umfassen, c, ist
die Stellschraube. Wird diese gegen den Kopf der Doke angeschroben, so drangt sie
den Buͤgel mit Gewalt aufwaͤrts, und zieht durch den untern Rand der
den Cylinder umfassenden Schenkeloͤffnungen diesen gegen die obere Wand
seines Canals an, wodurch derselbe fixirt wird. In Fig. 30 sieht man den
Buͤgel besonders vorgestellt, und zwar so, daß der Cylinder mit seiner Spize
durch die Schenkeloͤffnungen gestekt ist.
Noch eine andere Vorrichtung zum Feststellen des Cylinders weiter unten.
Um die Spize mit ihrem cylindrischen Koͤrper vorzuschieben, dient eine
Schraube (Fig.
24 und 25, f,) deren Mutter, g, von einer Unterlage, h, getragen wird, die
entweder besonders an die Doke angeschroben, oder mit ihr aus einem Stuͤke
gegossen ist. Die Schraube druͤkt bei, i, mit
einer Spize in die Versenkung des Cylinders. Der Handgriff, k, dient zum Drehen und Anziehen der Schraube. Oft sieht man zu diesem
Zweke auch eine Kurbel angewandt. Statt der Unterlage findet man zuweilen einen
Buͤgel vor, der die Mutter haͤlt, und der an 2 Lappen des Dokenkopfes
angeschroben ist. In Fig. 27 und 28 bezeichnet,
d, d, den Buͤgel, e, die Mutter, f, und, g, sind die Lappen, an welche der Buͤgel fest geschroben ist.
Bei dieser Art des Vorschiebens zeigt sich eine Unbequemlichkeit, die
vorzuͤglich bei sehr großen Drehebanken, wo der Cylinder mit seiner Spize oft
ein bedeutendes Gewicht hat und mit der Hand zu bewegen ist, fuͤhlbar wird.
Man muß naͤmlich bei beabsichtigtem Zuruͤkschieben des Cylinders diese
Function mit der Hand verrichten. Um diese UnbequemlichkeitUnbequemlicheeit zu beseitigen, und durch die Schraube beides. Vor- und
Zuruͤkschieben zugleich bewerkstelligen zu koͤnnen, haben manche
englische Drehebaͤnke folgende schoͤne, jedoch etwas complicirte
Vorrichtung, die in Fig. 31 im perpendikulaͤren Laͤngs- und Fig. 32 im
perpendiculaͤren Querdurchschnitte vorgestellt ist. Der Cylinder, a, ist bei derselben hohl und die Gegenspize wird bei,
b, in die Hoͤhlung desselben eingeschroben.
Nach hinten ist eine Mutter von Rothguß, c, uͤber
den Cylinder geschroben. Sie ist von gleichem Durchmesser mit diesem, um bei
vorkommenden Faͤllen in den Canal der Doke dringen zu koͤnnen. Durch
dieselbe geht eine Schraube, d, (gewoͤhnlich mit
flachem Gewinde), und dringt in die Hoͤhlung des Cylinders, wo sie Spielraum
hat. Der cylindrische Hals, e, der Schraube dreht sich
in der an der Doke mit angegossenen und mit Rothguß ausgebuchsten Huͤlse, f. Er hat bei, g, einen
cylindrischen Ansaz oder eine Schulter. Auf den vierekigen Theil, h, der Schraube wird zuerst die Scheibe, i, gebracht, dann eine Kurbel, m, gestekt, und beide durch eine vorgeschraubte Mutter, n, befestigt. Der Hals der Schraube dreht sich bei
dieser Einrichtung in der Huͤlse auf die Art, daß, g, und, i, sein Ausweichen aus derselben
verhindern. Das Gewinde der Schraube schiebt aber vermittelst der Mutter, c, den Cylinder mit der Spize vor oder zuruͤk, je
nachdem sie vor- oder ruͤkwaͤrts gedreht wird. Damit der
Cylinder sich nicht zugleich mit der Schraube drehe, ist er unten bei, k, etwas flach gefeilt und reibt sich mit dieser
Flaͤche gegen ein Stuͤk Stahl, e, was an
der vordern Muͤndung des Dokencanals nach unten eingesezt ist. Um die Spize, b, gehoͤrig anschrauben zu koͤnnen, ist
sie auf 2 Seiten etwas abgeflaͤcht, wie in Fig. 33, welche die
vordere Ansicht der Spize darstellt, bei a, und, b, zu bemerken ist.
Eine ihrem Principe nach voͤllig gleiche, in Hinsicht ihrer Ausfuͤhrung
jedoch von dieser Einrichtung etwas verschiedene Vorrichtung zum Vor- und
Zuruͤkschieben des Cylinders mit seiner Spize weiter unten.
Die gewoͤhnlichen Vorlagen zum Drehen aus freier
Hand bestehen aus einer geschlizten laͤnglichtvierekigen gußeisernen Platte,
die quer uͤber den Wangen liegt. In dem Schlize spielt der Bolzen zum
Anziehen der Platte an die Wangen. Er hat uͤber demselben einen Knopf, womit
er die Platte pakt, wenn unten angeschroben wird. In Fig. 34 sieht man die
Platte von oben, in Fig. 35 von der Seite. a, ist der Schliz, b, der Knopf des Bolzen. An dem vordem abgerundeten Ende
der Platte steht ein cylindrischer Aufsaz, c, in dessen
senkrechte cylindrische Hoͤhlung die gewoͤhnliche englische Vorlage,
d, gestekt und mit ihrem cylindrischen Zapfen, (e), eingeschliffen ist. In 36 und 37 ist diese Vorlage
besonders vorgestellt, und zwar Fig. 36 von vorne, Fig. 37 aber
von der Seite. Durch die Stellschraube Fig. 35, f, kann die. Vorlage in jeder gegebenen Stellung
befestigt werden.
Bei Wangen mit dachartigen Bahnen liegt auf diesen haͤufig erst eine besondere
solide Platte mit Ausschnitten fuͤr diese Bahnen. Sie ist breiter, als die
der Vorlage und auf derselben ruht erst die Platte der Vorlage. Zur Befestigung der
leztern an die Platte, und dieser an die Wangen dient ein einziger
gewoͤhnlicher Anziehebolzen. Fig. 38, a, ist die Grundplatte, b,
die Vorlageplatte, c, der Bolzen. Sein Knopf, d, liegt uͤber dem Schlize der Vorlageplatte.
Zuweilen findet man die Vorlageplatte auch ohne Schliz. Der Bolzen ist dann an ein
vierekiges geschmiedet eisernes Stuͤk befestigt, das nach Art eines
Schlittens, sich in einem Falze bewegt, welcher an der untern Flaͤche der
Platte angegossen ist. Das Stuͤk ist schwalbenschwanzaͤhnlich in
selbigen eingesezt, und schiebt sich mit Leichtigkeit darin. Fig. 39 bei, a, sieht man die Form des Falzes im Durchschnitte. b, ist der Schlitten mit seinem Bolzen, c. Fig. 40 stellt die untere
Flaͤche der Platte mit dem Falze, a, a, vor. b, ist der Schlitten. Fig. 41 zeigt die obere
Flaͤche der Platte. Der Zwek des Schlizes und des Falzes der Vorlageplatte
ist, die Vorlage in jeder Entfernung von dem in der Drehebank befindlichen und zu
drehenden Koͤrper stellen zu koͤnnen.
Von den mechanischen Vorlagen weiter unten.
Bei den groͤßern Drehebanken sind, wenn sie durch Menschen in Bewegung gesezt werden, die Betriebsraͤder ungefaͤhr wie in Fig. 42
eingerichtet. Durch dieselben werden entweder, wie z.B. bei den
klein-mittlern Drehebaͤnken, die Spindelscheiben, oder wie an den
groͤßer, besondere Vorgelege in Bewegung gesezt, deren verschiedene
Einrichtungen spaͤter angegeben werden. Die Fortpflanzung der Bewegung vom
Dreherade aus geschieht entweder durch Darmsaiten oder Riemen. Gewoͤhnlich
findet man daran fuͤr erstere Nuthen von verschiedenen Durchmessern neben
einander oder mehrere kleinere und groͤßere Scheiben fuͤr die Riemen.
Man sehe Fig.
42, wo, a, das eiserne Schwungrad, b, die Scheibe mit den verschiedenen Nuthen, c, das gußeiserne Gestell bezeichnet, das bei, d, und, e, auf
hoͤlzerne Schwellen geschroben ist; f, ist die
Kurbel. Gewoͤhnlich, vorzuͤglich aber bei großen Drehebaͤnken,
haben dergleichen Raͤder 2 Kurbeln, auf jedem Ende der Welle eine, die Schnur
oder der Riemen werden immer uͤbers Kreuz geschlagen, weil beide so besser
ziehen. g, ist die Drehebank, von klein-mittlerer
Große. Ich habe diese Abbildung vorzuͤglich geliefert, um zu zeigen, wie man
in England bei den verschiedenen Durchmessern der Gange (Nuthen) oder
Riemenscheiben, Schnur und Riemen immer in die gehoͤrige Spannung sezt. Bei,
h, ist naͤmlich eine Schwelle an den Fußboden
angeschroben. Zwischen ihr und der Schwelle, e, werden
keilfoͤrmige Holzstuͤken, (i, i, i)
geschoben, so daß die breite Seite der Keile immer abwechselnd nach einer und der
andern Seite zu liegen kommt, die Schwellen, h, und, d, also immer parallel neben einander bleiben. In Fig. 43 ist
diese Lage der verschiedenen Keile von oben abgebildet. Durch gelindes Antreiben der
Keile kann das Anspannen der Schnur und des Riemens nach jedem Beduͤrfnisse
bewirkt und modificirt werden. Die Schwere des Schwungrades und des Gestelles
verhindert das Aufwippen des leztern hinreichend.
Oft sieht man die Betriebs- oder Dreheraͤder auch unter oder
uͤber der Drehebank in den naͤchsten Stokwerken der Fabriken
aufgestellt, um nicht zu viel Raum in der Werkstaͤtte zu verlieren.
–––––––––
Ich komme nun zur speciellen Beschreibung einzelner Drehebaͤnke selbst, und
hoffe bei derselben von jeder Groͤße die gebraͤuchlichsten und besten
auffuͤhren zu koͤnnen. Die kleine und klein-mittlere konnte ich
genau nach dem Maßstabe aufnehmen, was mir bei den groͤßern Arten leider
nicht vergoͤnnt war; jedoch hat mein gutes Augenmaß so viel wie
moͤglich geholfen, so daß ich die Zeichnungen als ziemlich richtig und in
allen verschiedenen Verhaͤltnissen moͤglichst genau getroffen
empfehlen kann. Um einigermaßen eine Norm der Groͤße des Ganzen und aller
Theile immer vor Augen zu haben, ist bei jeder Zeichnung ein Maßstab gegeben. Jedem Mechaniker, der durch
diese Mittheilung mit dem Principe, wonach die verschiedenen englischen
Drehebaͤnke gebaut sind, bekannt geworden ist, wird es, wenn er mit
praktischem Gefuͤhle und Takt gehoͤrig ausgeruͤstet ist, nicht
schwer werden, das Beste aus meinen Beschreibungen herauszuheben und auf seine
Drehebaͤnke zu verpflanzen.
I. Kleine Drehebank.
Sie ist nach einem andern einfacher Principe als die vom Herrn G. O. F. R. Beuth beschriebene gebaut, und eine von derjenigen Art
und Groͤße, wie man sie in England am haͤufigsten sieht. Sie hat
flache gußeiserne Bahnen und ein Gestell von dem naͤmlichen Metalle. Man
sieht selbige Tab. VI. Fig. 1 von vorne und Fig. 2 vom
rechten Ende angesehen.
Die Wangen sind 3 Fuß 6 Zoll lang, mit ihren an beiden Enden befindlichen
Verbindungen aus einem Stuͤke gegossen, und von derjenigen Construction, die
Tab. V., Fig.
13 und 14 abgebildet worden ist. Einen Durchschnitt derselben zeigt Fig. 3 im
vergroͤßerten Maßstabe. Die Dike der einzelnen Wangen betraͤgt ein
Zoll, die Hoͤhe 3 Zoll und der Zwischenraum zwischen beiden 3/4 Zoll. Die
verschiedenen geschliffenen Flaͤchen der Wangen, als die Bahnen, sind bei,
a, b, und, c,
angedeutet. Sie liegen rund um eine erhabene Leiste, die am obern Rande beider
aͤußern Flaͤchen der Wangen angegossen ist. Die obere Bahn, a, ist nicht so breit als die Wangen. Diese sind
naͤmlich nach dem Zwischenraume hin, also an ihrem inner und obern Rande
etwas abgedacht gegossen. Eine solche Einrichtung ist getroffen, um das Abrichten
und Schleifen der obern Bahn etwas zu erleichtern.
Die Wangen sind durch Bolzen an die gußeisernen Stendergeruͤste, c, c, angezogen, deren einen Bolzen man in Fig. 2 bei, a, punctirt sieht. Hinter den Wangen, jedoch etwas unter
der durch die obere Bahn der Wangen gebildeten Linie, ist ein Brett, d, auf die Stendergeruͤste geschroben, was als
Tisch fuͤr das Werkzeug dient, und zugleich mit zur Festigkeit des ganzen
Gestelles beitraͤgt. Unter der Tischplatte ist oft auch eine hoͤlzerne
Schublade angebracht.
Die Basis der Stendergeruͤste wird auf den Fußboden festgeschroben. Bei (b, Fig. 1 und 2) gleich uͤber
derselben geht noch ein eiserner Querriegel durch das Gestell und ist an beiden
Stendergeruͤsten festgeschroben. Auch er ist bestimmt, dem Gestelle an seinem
untern Theile mehr Festigkeit zu geben.
Bei, e, e, befinden sich die Schrauben mit den Spizen
fuͤr die Welle des Tritts. Diese sieht man Fig. 1, f, der Laͤnge nach, g, und, h, sind die beiden Spizen, worauf sie sich
bewegt, i, i, i, ihre 3 Arme, an dessen Mittlern das
Oehr, k, befestigt ist, woran die Verbindungsstange, l, des Tritts mit der Kurbel haͤngt, m, ist der hoͤlzerne Fußtritt. Den ganzen Tritt
sieht man Fig.
2 von der Seite.
Fig. 1, n, ist die Schwungradwelle mit der Kurbel, o, und dem Schwungrade, p.
Die Kurbel hat 2 Zoll Kroͤpfung, und ist mit der Verbindungsstange, l, auf die oben beschriebene, und Tab. III, Fig. 2
abgebildete Weise verbunden. Das Schwungrad hat 2 Kraͤnze, q, und, r, von Gußeisen. Der
groͤßte Durchmesser des groͤßern, zugleich zum Schwungrade dienenden
Kranzes betraͤgt 2 Fuß, 4 Zoll, der des kleinern 1 Fuß, 2 Zoll. Jeder der
Kranze enthaͤlt 3 Nuthen oder Gaͤnge. s,
und, t, sind die beiden Spizen, worauf die
Schwungradwelle laͤuft.
Alle Doken der Drehebank liegen flach auf den Wangen auf, und haben Streichplatten
von Rothguß, (u, u,) fuͤr die Seitenbahnen
derselben, welche mit einer Leiste an ihrem untern Ende uͤber den Vorsprung
der Bahnen greifen. (Man vergleiche hier Tab. V., Fig. 15. Die
Streichplatten sind durch mehrere Schrauben an den Koͤrper der Doken
festgeschroben, und muͤssen genau an die Seitenbahnen der Wangen
angeschliffen seyn.
Die Aufstellung der Spindel ist von der fruͤher beschriebenen, und auf Tab. V,
Fig. 17
und 18
abgebildeten Art. Die glasharte Spindel arbeitet in der Doke, (v,) in einem staͤhlernen, gehaͤrteten
Ringe, hat aber bei, w, eine Spize, die in einer
Versenkung der Schraube, x, laͤuft. Diese
Schraube kann durch eine Stellschraube, y, in die Doke,
z, befestigt werden. Leztere druͤkt auf ein
von vorne eingeschobenes Eisenstuͤk, tz, in
welches innerhalb des Schraubencanals das Gewinde desselben mit eingeschnitten ist.
Die Spindelscheibe 1 ist von Messing, im groͤßten Durchmesser 6 Zoll, und
enthaͤlt 3 Nuthen, die mit denen des Schwungrades in umgekehrter Ordnung
stehen. Die Durchmesser derselben sind zu denen der Schwungradnuthen so berechnet,
daß seine und dieselbe Schnur fuͤr alle verschiedenen Gaͤnge paßt.
Beim Gebrauche des kleinen Schwungradkranzes ist jedoch eine kuͤrzere Schnur
zu nehmen. Man stellt dann das Spindelgestelle mehr nach innen, so daß die Nuthen
der Spindelscheibe genau uͤber die des kleinen Kranzes treffen. Die
Entfernung der Spindelachse von den Wangen betraͤgt 4 1/2 Zoll, der
groͤßte Durchmesser der Spindel 1 Zoll.
Fuͤr den Spindelkopf (2) dieser kleinen Drehebank sind vorhanden: eine kleine
gußeiserne Drehescheibe, ein Futter mit einer Spize, eines mit einem Haken, eines
zum Einsezen der Bohrer und eine Menge hoͤlzerner, die entweder an der
Drehescheibe befestigt, oder auf den Spindelkopf selbst geschroben werden.
Der Anziehebolzen 3 des, Spindelgestelles hat zur bequemern Handhabung am untern Ende 2
Fluͤgel, 4, 4, und geht durch eine quer unter den Wangen liegende Platte, 5,
gegen welche der Kopf, 6, desselben beim Anziehen sich stemmt; am obern Ende hat er
aber ein Gewinde, womit er in die Verbindungsplatte, 7, der beiden Spindeldoken
eingeschroben wird.
Die Doke zur Gegenspize ist von der einfachsten Form. Ihre Basis (8) ist breiter als
ihr Kopf. Der Cylinder mit der Gegenspize (9) wird durch die Schraube (10)
verschoben, und muß, wenn er zuruͤkgestellt werden soll, mit der Hand
zuruͤkgebracht werden. Die Mutter (11) fuͤr die Schraube ist von
Rothguß, eben so die Unterlage (12), die vermittelst der Platte (13) an die Doke
angeschroben ist. Streichplatten und Anziehebolzen dieser Doke sind ganz wie am
Spindelgestelle.
Die Vorlage (14) zum Drehen aus freier Hand liegt mit ihrer Platte unmittelbar auf
den Wangen. Leztere hat einen Falz, (15) worin sich der Schlitten mit seinem
Anziehebolzen schiebt. Dieser Anziehebolzen ist in dem Schlitten befestigt und hat
an seinem untern Ende ein Gewinde. Zum Anziehen desselben dient die
Fluͤgelmutter (16). Man vergleiche hier Tab. V., Fig. 39, 40 und 41.
Zuweilen haben dergleichen kleine Drehebaͤnke auch mechanische Vorlagen. Die
Unterlage derselben schiebt sich ganz so auf den Wangen, als die Doken, und kann
auch so wie diese durch einen Anziehebolzen festgestellt werden. Die Einrichtung
einer solchen mechanischen Vorlage ist durchaus in nichts verschieden von
derjenigen, die ich bei der klein-mittlern Drehebank ausfuͤhrlich
beschreiben werde.
Ich muß am Schlusse dieser Beschreibung einer kleinen englischen Drehebank noch 2
Variationen in dem Baue der Doken fuͤr die Gegenspize erwaͤhnen, die
haͤufig an solchen Drehebanken vorkommen. Fig. 4 zeigt die eine und
Fig. 5 die
andere. Bei Fig.
4 ist die Gegenspize der aͤußerste Theil einer Schraube, a, deren Mutter der Kopf der Doke, b, selbst ist. Selbige Schraube muß sehr genau in der
Mutter gehen, und doch durchaus in derselben nicht wakeln,Die Englaͤnder nennen das: trunken seyn.
Sie sagen; die Schraube ist trunken. weil sonst das Centrum der Spize nicht feststeht. In der ihr gegebenen
Stellung wird sie durch eine Stellschraube, c, fixirt,
die ganz so eingerichtet ist, wie ich sie eben bei der Spindeldoke, z, Fig. 1 beschrieben
habe.
In Fig. 5
schiebt der Cylinder der Spize sich in einem Canale der Doke, in welchem er
eingeschliffen ist, sein Hinterer schwaͤcherer Theil enthaͤlt ein
Gewinde, das durch die am Ende des Canals angebrachte Mutter, a, geht, und auswendig mit einer Kurbel, b,
versehen ist. Beim Drehen des Cylinders vermittelst der Kurbel, schiebt das Gewinde
der Mutter ihn vor und zuruͤk, je nachdem man vorwaͤrts oder
ruͤkwaͤrts dreht.
Noch muß ich endlich einer besondern Form des untern Endes derjenigen Anziehebolzen
gedenken, die mit einem Gewinde ihres obern Endes in den Koͤrper der Doken
eingeschroben, folglich beim Anschrauben gedreht werden muͤssen. Das untere
Ende (Fig. 6,
a, a, a,) derselben hat naͤmlich ein starkes
Scharnier, in welches eine Art eisernen Handgriffes (b, b,
b,) eingelenkt ist. Fuͤr gewoͤhnlich haͤngt dieser
Handgriff senkrecht herunter und behindert so den Plaz unter den Wangen nicht. Will
man aber die Schraubenbolzen drehen, so bewegt man ihn aufwaͤrts, und zwar
so, daß er mit dem Bolzen in einem rechten Winkel steht, und gebraucht ihn dann als
gewoͤhnlichen Schraubenschluͤssel. Man bekommt auf diese Weise schnell
und ohne besondere Umstaͤnde einen langen und kraͤftigen Hebel zum
Drehen des Bolzen in seine Gewalt. Ein solcher Schraubenschluͤssel kann nie
verloren gehen oder verlegt werden.Gewiß sind manche der bisher beschriebenen Einrichtungen an den englischen
Drehebanken schon theilweise auch in Deutschland bekannt und lange im
Gebrauch, indessen hat mich diese Ueberzeugung nicht abgehalten, sie hier zu
nennen und zu beschreiben, da ich gerne allen Mechanikern, auch den
kleinern, die oft nur geringe Kenntnisse vom Werkzeug zur
Maschinenfabrikation besizen, indem sie groͤßere Werkstaͤtten
nicht besehen konnte, nuͤzlich seyn moͤgte.
Man findet diese Einrichtung selbst an groͤßern Drehebanken,
vorzuͤglich an klein-mittlern. Bei groß-mittlern und ganz
großen hat Herr Fox die Anziehebolzenmutter fuͤr
die Doke der Gegenspize auf den Scheitel der Doke gestellt, was allerdings große
Bequemlichkeiten hat, in so ferne als die Wangen derselben nicht selten dem Fußboden
ganz nahe liegen. Jedoch hievon spaͤter ein Mehreres.
II. Klein-mittlere
Drehebank.
Die davon auf Tab. VI., Fig. 6 und 7 gelieferte Abbildung ist
nach einer Drehebank bester Construction genommen. Man sieht in Fig. 6 die Drehebank von
vorne und in Fig.
7 von der Seite.
Die Wangen sind 7 bis 8 Fuß lang und von der gewoͤhnlichsten Art, d.h. mit
dachartig zugeschliffenen Bahnen, wie ich sie oben beschrieben und auf Tab. V. in
Fig. 6
abgebildet habe. Selbige sind mit den Endstuͤken und der Bruͤke aus
einem Stuͤke gegossen. Die Dike der Wangen betraͤgt 1 bis 1 5/4 Zoll,
die Hoͤhe 5 Zoll, der Zwischenraum zwischen beiden ebenfalls 5 Zoll. Die
Endstuͤken sind gearbeitet, als in Fig. 8 bei, a, und, c, zu sehen ist. Die
Leisten, c, und, d, springen
nach innen hervor, und dienen zum Anschrauben der Wangen an die
Stendergeruͤste, deren diese Drehebank 3, 2 an den Enden und eines in der
Naͤhe des Schwungrades (Fig. 6, c) hat. Zur Befestigung des leztern an die Wangen dient
die Bruͤke, Fig. 8, e, die zu diesem Zweke nach einer
Seite hin mit einer gleichen Leiste als die der Endstuͤken versehen ist.
Endstuͤken sowohl als Bruͤke und Leiste sind 1 Zoll stark.
Die Stendergeruͤste zu dieser Drehebank sind ganz einfach eingerichtet.
Man sieht eines derselben in Fig. 7. Sie sind
saͤmmtlich von Gußeisen, und mit ihrer Basis auf den Fußboden festgeschroben.
Bei, d, sieht man das Zapfenlager fuͤr die
Schwungradwelle, bei, e, die Schraube mit der Spize,
worauf die Welle des Tritts sich dreht. f, ist eine
angegossene Stuͤze fuͤr die hoͤlzerne Tischplatte, g, die durch Schrauben daran befestigt ist.
Der Tritt ist so lang als die ganze Drehebank, und moͤglichst stark
gearbeitet, damit er bei seiner Laͤnge Festigkeit besize und nicht schwanke.
Die Welle desselben ist z.B. 1 1/2 Zoll stark, ihre Arme, deren 4 sind, haben 3/8
Zoll Dike und 1 1/2 Zoll Breite, der Fußtritt hat 1 1/2 Zoll Dike und 5 Zoll Breite.
An dem ersten und vierten Arme befindet sich das Oehr, h, fuͤr die 2 Verbindungsstangen, i, und,
k. Leztere sind von gewoͤhnlicher
Einrichtung.
Die Schwungradwelle, l, hat 2 Kurbeln m, und, n, und dreht sich in
Lagern, wovon eines am mittlern Stendergeruͤste bei (o) sich befindet. Die Kurbeln haben gewoͤhnlich 2 1/2 Zoll
Kroͤpfung. Der Durchmesser der Schwungradwelle, p, haͤlt meist 1 1/2 Zoll. Das Schwungrad ist wie bei der kleinen, eben
beschriebenen Maschine, aber nur mit einem großem Kranze versehen, der der
noͤthigen Schwungkraft halber etwas staͤrker gegossen ist. Der Kranz
hat 3 bis 5 Ruthen.
Bei manchen Drehebaͤnken dieser Gattung geht der Tritt nur vom Schwungrade an
bis zu einem Stendergeruͤste, was gerade in der Mitte der Drehebank
aufgestellt ist, und dieser Laͤnge entspricht dann natuͤrlich die der
Schwungradwelle. Selbige hat dann auch nur eine Kurbel, und ist sammt dem Tritte
leichter gearbeitet. Es schließt diese Einrichtung zwar eine Unvollkommenheit in
sich, die das Drehen am Ende der Drehebank mehr oder weniger verhindert, indessen
scheint man dazu durch die Erfahrung aufgefordert zu seyn, daß große Tritte schwer
und unbehuͤlflich mit den Fuͤßen zu betreiben sind, und daher die
Arbeiter sehr ermuͤden. In den meisten Werkstaͤtten sieht man diese
Gattung von Drehebanken sogar schon ohne Tritt und Schwungrad und laͤßt sie
entweder durch Elementarkraft oder vermittelst besonderer, durch Menschen gedrehter
Betriebsraͤder, deren eines auf Tab. V., Fig. 42 mit der Drehebank
abgebildet ist, in Bewegung sezen. Allerdings kann aber auch ein Arbeiter an einer
solchen Drehebank nicht viel Festigkeit in seiner Hand und in der Haltung seines
Koͤrpers gewinnen, wenn er mit dem untern Theile desselben so kraftvoll und
ausdauernd in Bewegung seyn soll.
An manchen dieser Drehebaͤnke sind die Wangen gleich neben dem Spindelgestelle
in der Art ausgeschnitten, wie man es bei, q, sieht.
Diese Einrichtung ist getroffen, um platte Gegenstaͤnde von groͤßerm
Durchmesser darauf drehen zu koͤnnen. Bedarf man des Ausschnittes nicht, so
werden 2 Einschiebsel durch eine Bruͤke zu einem Ganzen verbunden,
eingeschoben. Diese Einschiebsel sind gewoͤhnlich so eingesezt, wie Fig. 8 bei, f, und, g, zeigt, oder ruhen
auch auf dem dachartig abgeschliffenen Rande (Fig. 6, r,) des Ausschnitts, uͤber welchen ihre untere
Flaͤche mit ihren beiden Enden greift, die eine der Form der Abdachung
correspondirende Vertiefung haben. Wenn die Einschiebsel eingesezt sind, so muß ihre
obere Bahn mit der der Wangen genau Flucht halten. Fig. 9 sieht man ein
Einschiebsel der leztern Art von der Seite, in Fig. 10 vom Ende, a, und, b, sind die
Wangenstuͤke desselben mit ihren untern Ausschnitten, c, Fig.
8, h, die Bruͤke. Mit dem Ausschnitte
Fig. 10,
d, d, ruhen sie auf den Raͤndern Fig. 6, r, des Ausschnittes.
Die Aufstellung der Spindel im Spindelgestelle ist die bei allen kleinern
Drehebaͤnken gewoͤhnliche (s. Tab. V., Fig. 18). Die Mutter, f, und Gegenmutter, t,
fuͤr die Spize waren bei der hier abgebildeten DrehebankEs ist meine Absicht bei diesen Beschreibungen, auch die verschiedenen, in
England uͤblichen Formen der einzelnen Theile einer Drehebank zu
beruͤksichtigen. Diese sind zwar nicht immer wesentlich, jedoch ist
es fuͤr jeden Mechaniker ein großer Gewinn, wenn er auch in dieser
Beziehung vielseitig sich ausbildet, und dadurch in den Stand gesezt wird,
bei seinen Arbeiten und Erfindungen mit dem Nuzen eine angenehme Form zu
verbinden. Der Laie sieht gewoͤhnlich mehr auf die Form als das Wesen
einer Maschine, weil die Auffassung des leztern zu sehr aus seiner
Sphaͤre liegt, und der groͤßte Theil des Publicums besteht aus
Laien. Aber auch selbst der Kunstkenner hat Wohlgefallen an schoͤnen
und mannichfaltigen Formen, und es empfiehlt den Schoͤpfer derselben
sehr bei ihm, wenn dieser sie mit dem Wesentlichen der Maschine so weise zu
verschmelzen wußte, daß eines ohne das andere nicht bestehen zu
koͤnnen scheint, und wirklich auch nicht bestehen kann. von der Form des Dokenkopfes, d.h. cylindrisch, und hatten in ihrem Umfange
einige Loͤcher, in welche man zum Zwek ihres festen Anziehens, den Stiel
eines Hebels steken konnte. Man sehe diese Einrichtung Fig. 11 im
perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitte. Die Spindelscheibe ist mit einer
besondern Theilungsscheibe versehen, die in die innere Hoͤhlung derselben
eingesprengt ist (s. die Beschreibung der englischen Drehebank von G. O. F. R. Beuth Bd. XXIV. S. 214). Zuweilen fehlt sie auch und
statt derselben findet man den Rand Fig. 7, u, der Scheibe etwas groͤßer, und die Theilung
auf diesen aufgezeichnet. Daß die Theilung dann nicht so vollstaͤndig sey, als
bei Anordnung der besondern Theilungsscheibe, kann man sich leicht vorstellen,
indessen reicht sie fuͤr gewoͤhnliche Zweke hin. Sollen aber
Raͤder auf einer solchen Drehebank eingeschnitten werden, dann ist jene
unentbehrlich.
Bei V, Fig. 6,
sieht man die Feder mit dem Stifte. Sie ist an die Doke, w, leicht angeschroben, damit man sie nach verschiedenen Richtungen drehen
koͤnne, je nachdem die Halbmesser der getheilten Kreise groͤßer oder
kleiner sind. Der Stift ist von Stahl, und wird in die Theilungspuncte der Scheibe
gesezt, um leztere in den noͤthigen Stellungen zu fixiren.
Die Spindelscheibe wird sehr einfach auf die Spindel gesezt. Leztere ist
naͤmlich da, wo die Scheibe befestigt werden soll, ein ganz wenig (kaum
merkbar) konisch gearbeitet und auf diesen geringen Anlauf der Spindel wird die
Scheibe mit einer der Form des Anlaufs correspondirenden Oeffnung in ihrer Achse
fest aufgetrieben. Man findet diese Art der Befestigung der Spindelscheibe auf die
Spindel nicht allein bei allen Drehebanken von kleinerer Gattung, sondern selbst bei
groͤßern und ganz großen. Es ist bei derselben nur dahin zu sehen, daß die
Vereinigung beider nicht zwischen zu kleinen Flaͤchen Statt finde, damit die
Zahl der gegenseitigen Beruͤhrungspuncte und die dadurch bewirkte Reibung
groß genug werde, um beide in einer unbeweglichen dauerhaften und sichern Verbindung
mit einander zu erhalten.
Der groͤßte Durchmesser der Spindelscheibe mißt 1 Fuß, der der Spindel 1 5/8
Zoll, der des Spindelkopfes 9/8 Zoll. Die Entfernung der Spindelachse von den Wangen
betraͤgt 7 1/2 Zoll.
Die Anziehebolzen fuͤr saͤmmtliche Doken werden in die Grundplatten
derselben eingeschroben, koͤnnen folglich auch mit vorhin beschriebenem
beweglichen und zum Schraubenschluͤssel dienenden Hebel versehen werden. Hier
in der Abbildung sieht man diesen Hebel in Anwendung. Die Platten fuͤr die
Anziehebolzen liegen quer unter den Wangen.
Die Doke fuͤr die Gegenspize hat die in Fig. 6, x, bezeichnete Form. Sie ist in Fig. 7, x, mit einer der Wangen vom Ende vorgestellt. Der Kopf
derselben hat bei, y, eine cylindrische
Verlaͤngerung, in welcher die Vorrichtung zum Vor- und
Zuruͤkschieben der Gegenspize mit ihrem Cylinder befindlich ist. Selbige ist
Fig. 12
im perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitte dargestellt. Der
staͤhlerne Cylinder der Gegenspize ist hohl, und leztere in die vordere
Oeffnung der cylindrischen Hoͤhlung eingeschroben. Diese Hoͤhlung
verengert sich bei, a, und die Verengerung
enthaͤlt ein Gewinde, das der Schraube, b, zur
Mutter dient. Diese Schraube schiebt den Cylinder vor und zuruͤk, und ihr Hals
dreht sich in der Huͤlse, c, von Rothguß, die auf
die cylindrische Verlaͤngerung des Dokenkopfes geschroben ist. Innerhalb des
Canals dieser Verlaͤngerung hat der Hals, d, der
Schraube einen cylindrischen Ansaz oder eine Schulter, die sich gegen die
Huͤlse reibt, auswendig aber einen vierekigen oder runden Zapfen, worauf die
Kurbel, f, gestekt und durch einen kleinen Keil
befestigt wird, der durch sie und den Zapfen der Schraube dringt. Sie bildet bei,
g, zugleich die aͤußere Schulter fuͤr
den Schraubenhals.
Damit der staͤhlerne Cylinder bei dem Drehen der Schraube sich nicht mit
derselben rund bewegen koͤnne, ist diejenige Vorrichtung angebracht, die ich
oben schon ausfuͤhrlich angegeben habe. (s. Tab. V, Fig. 31 und 32, k, und, l.)
Zur Feststellung des staͤhlernen Cylinders mit seiner Gegenspize dient bei
dieser Drehebank eine Vorrichtung, die in Fig. 13 im
perpendiculaͤren Querdurchschnitte vorgestellt ist. a, ist der Dokenkopf, b, der staͤhlerne
hohle Cylinder fuͤr die Gegenspize, c, ein
cylindrisches, von hinten eingeseztes Stuͤk Eisen, bei, d, mit einem Gewinde versehen, auf welches eine Mutter,
e, mit einem kleinen Handgriffe, f, geschroben ist. Damit das cylindrische Stuͤk
Eisen die zur Sicherung seines Ganges noͤthige Laͤnge gewinne, ist ein
Ansaz, g, Fig. 7, nach hinten an den
Dokenkopf angegossen. Der eiserne Cylinder liegt in solcher Hoͤhe unter dem
staͤhlernen Cylinder fuͤr die Gegenspize, daß dieser in einem obern
halbkreisfoͤrmigen Ausschnitte, h, desselben
ruht. Er wird in selbigen mit eingeschliffen.
Wird der eiserne Cylinder durch die Mutter (e) angezogen,
so kneipt er mit seinem Ausschnitte den staͤhlernen Cylinder, und
druͤkt ihn mit Gewalt gegen die Hintere und obere Wand seines Canals, worauf
er feststeht.
Die Vorlage zum Drehen aus freier Hand, Fig. 6 und 7, 1, steht auf einer
besondern Platte 2, die sich mir untern Ausschnitten auf den Bahnen der Wangen
schiebt. Auf derselben wird die Vorlage mit ihrer geschlizten Platte 3 besonders
festgeschroben, so daß sie vermoͤge des Schlizes alle moͤglichen
Stellungen annehmen kann. Sie ist sonst von gewoͤhnlicher und oben
beschriebener Einrichtung, (s. Tab. V, Fig. 34–38).
Ich komme nun noch zur naͤhern Beschreibung einiger Theile, die zu dieser
Drehebank gehoͤren, und die ich fruͤher nur oberflaͤchlich
angegeben habe. Ich finde mich veranlaßt, sie bei dieser Gelegenheit um so genauer
zu beschreiben, als sie bei einer Drehebank von dieser Gattung am meisten in
Anwendung sind, und in so ferne bei derselben auf die Zwekmaͤßigkeit ihrer
Construction und auf die Vervollkommnung ihrer einzelnen Einrichtungen der meiste Fleiß verwandt
wird. Zu diesen verschiedenen Organen rechne ich:
1) Die gußeiserne Drehescheibe. Selbige ist in Fig. 14 von der
aͤußern, Fig. 15 von der innern, nach der Spindel hinsehenden Seite, Fig. 16 von
vorne, und Fig.
17 im perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitte durch die Achse
derselben vorgestellt. Das Centrum derselben ist nach der Spindel hin durch den
Ansaz, a, verstaͤrkt, in welchem sich die
muͤtterliche Schraube fuͤr die Befestigung der Drehescheibe an dem
Spindelkopf befindet. Von demselben laufen vier Rippen, b, b,
b, b, aus, die auf den Kranz, c, treffen, der
den Umkreis der Scheibe verstaͤrkt. Die aͤußere Flaͤche ist
vollkommen flach abgedreht, und enthalt im Mittelpuncte eine kleine Oeffnung mit
einem Gewinde, wohinein eine Spize geschroben werden kann. Der Durchmesser der
Drehescheibe betraͤgt 15 Zoll, ihre Dike bei dem Kranze und den Rippen 5/4
Zoll, zwischen den Rippen 1/2 Zoll, und die Hoͤhe des Ansazes, a, 2 Zoll, die Tiefe der Oeffnung fuͤr das
Gewinde darin 1 1/2 Zoll.
Die Drehescheibe ist in der Richtung der Rippen mit 4 oder 5 runden Loͤchern,
e, e, e, e, versehen, die dieselbe durchdringen.
Zwischen diesen 4 Loͤcherreihen liegen Schlizen, f, f,
f, f, eben so wie die Loͤcher in der Richtung von Radien. Den Zwek
beider Theile kennen wir von fruͤher her, hier jedoch dienen die
Loͤcher noch zur Befestigung besonderer Vorrichtungen, die zum bequemen
Einspannen verschieden geformter Koͤrper in die Drehebank dienen. Sie
bestehen aus den Ansaͤzen, g, Fig. 14, welche in Fig. 18, 19 und 20, und zwar
Fig. 18
von oben, Fig.
19 von der Seite und Fig. 20 vom Ende
angesehen, vorgestellt sind. Der Koͤrper derselben ist langlicht vierseitig,
seine aͤußere oder obere Seite halbzirkelfoͤrmig abgerundet.
Hoͤhe 1 1/4 Zoll, Breite 1 Zoll, Laͤnge 2 1/2 Zoll. Die Ansaͤze
werden vermittelst 2 Zapfen, a, und, b, befestigt, die an ihren nach der Scheibe hinsehenden
Flaͤchen angebracht sind. Beide Zapfen stehen so weit von einander entfernt,
daß sie durch 2 und 2 Loͤcher der Scheibe passen. Der aͤußere Zapfen,
a, reicht durch die Scheibe, und hat an seinem
hervorragenden Ende ein Gewinde, vermittelst dessen der Ansaz bei Vorschraubung
einer Mutter an die Scheibe angezogen wird. Der andere Zapfen, b, ist so kurz, daß er nur eben durch die Scheibe
reicht. Er dient bloß dazu, den Ansaz in seiner Stellung im Radius der Scheibe zu
erhalten, und jede Drehung desselben nach andern Richtungen zu verhuͤten.
Durch jeden Ansaz laͤuft seiner Laͤnge nach eine Schraube, c, die bei, d, mit einem
Schraubenkopfe versehen ist. In Fig. 16 sieht man die
Ansaͤze mit der Scheibe in Verbindung, Fig. 17 die Scheibe mit
demselben im Durchschnitte.
Solcher Ansaͤze sind 4. Sind alle in die Scheibe gesezt, so kann man vermittelst der 4 Schrauben
jeden noch so verschieden geformten Gegenstand an die Scheibe befestigen, und genau
centrisch stellen, vorzuͤglich wenn er regelmaͤßige Formen hat. Diese
Einrichtung ist also eine Art sehr einfachen Universalfutters, was manche
kuͤnstliche Vorrichtung und Arbeiten zur noͤthigen Einspannung der zu
drehenden Koͤrper erspart. Nach der verschiedenen Groͤße der
einzuspannenden Koͤrper kann man vermittelst der Loͤcher in der
Scheibe die Ansaͤze mit leichter Muͤhe und wenigem Zeitverluste bald
mehr, bald weniger dem Centrum der Scheibe naͤhern, und so sich fuͤr
alle Faͤlle schnell einrichten. Es kann diese vortreffliche Einrichtung nicht
genug zur Nachahmung empfohlen werden.
Eine unvollkommenere Einrichtung der Art sieht man in Fig. 21 von vorne und
Fig. 22
vom Ende. Sie ist nur zum Einspannen kleinerer Gegenstaͤnde bestimmt und
besteht aus einem Futter mit einer offenen Buͤchse, durch dessen
Waͤnde 4 Schrauben in den innern Raum der Buͤchse hineingeschroben
werden koͤnnen. Der zu befestigende Gegenstand wird nach
Zuruͤkschrauben aller 4 Schrauben in die Buͤchse gethan, und dann
durch das Anschrauben derselben in jeder beliebigen Stellung befestigt.
2) Von dem Futter mit der Spize und dem Haken habe ich fruͤher deutlich genug
geredet.
In Fig. 23 ist
eine Abbildung davon geliefert, a, ist das Futter von
Rothguß oder Gußeisen; b, die staͤhlerne Spize,
konisch eingetrieben, c, der Haken. Er geht durch eine
vierekige Oeffnung des Futters und kann durch die Stellschraube, d, in der ihm gegebenen Lage befestigt werden.
3) Ein gewoͤhnliches Herz, wie es gebraucht wird, um an zu drehende
Koͤrper von geringem Durchmesser gespannt zu werden, damit der Haken des
Futters sie herum zu werfen vermoͤge, sieht man Fig. 24 und 25 in
verschiedenen Formen. a, ist der Fortsaz desselben, der
von dem Haken des Futters ergriffen wird. b, die
Stellschraube, die das Ende des zu drehenden Koͤrpers in den Winkel, c, hineinpreßt, und so mit dem Herz verbindet.
Fuͤrchtet man, daß der Koͤrper durch das Anschrauben des Herzes auf
seiner Oberflaͤche verlezt werde, so umgibt man ihn zuerst mit einem Ringe
von Kupferblech, und spannt ihn nun ins Herz, wobei das Kupferblech dann eine
schuͤzende Deke bildet.
Ich habe in Fig.
33 noch eine Vorrichtung abgebildet, die man auch fuͤglich unter
die Kategorie der Herzen bringen kann. Sie besteht aus 2 Baken, a, und, b, mit Schrauben,
c, und, d, versehen,
zwischen welchen der zu drehende Gegenstand befestigt wird. Der Fortsaz, e, wird von dem Haken des Futters gefaßt und bei Drehung
der Spindel mit der ganzen Vorrichtung herumgeworfen.
4) Ein Futter zur Befestigung von Bohrern an der Spindel sieht man in Fig. 26 und 27, und zwar
Fig. 26
im Aufrisse, Fig.
27 im Durchschnitte. a, ist das Futter, b, ein gerade darin befestigter Bohrer, c, zeigt den vierekigen Canal in der Achse des Futters,
worin der Bohrer stekt. Er laͤuft nach innen etwas verjuͤngt zu.
5) Jezt endlich komme ich zur Beschreibung der sogenannten mechanischen Vorlage
fuͤr Drehebaͤnke. Da dieselbe in Deutschland noch im Ganzen so wenig
bekannt ist und angewandt wird, so will ich die Beschreibung derselben recht genau
geben, und mit guten und deutlichen Abbildungen erlaͤutern helfen.Ich bitte mit meiner Beschreibung diejenige des Herrn G. O. F. R. Beuth zu vergleichen, die, so vortrefflich sie
auch geliefert ist, mir im Ganzen doch ein wenig zu kurz und
gedraͤngt scheint, um von jedem Mechaniker, der nie eine mechanische
Vorlage sah und in Haͤnden hatte, begriffen zu werden.
In der Haupteinrichtung sind sich alle verschiedenen in England uͤblichen
Vorlagen ganz gleich, d.h. sie sind alle mit einem doppelten Schiebwerke versehen,
vermittelst dessen der Drehestahl oder Meißel theils der Laͤnge der Drehebank
nach, theils quer uͤber selbige bewegt werden kann. Zugleich sind sie mit
einer Vorrichtung versehen, daß man den laͤngs der Drehebank arbeitenden
Stahl auch in verschiedenen Winkeln gegen die Achse der Spindel schneiden lassen
kann. Was die Ausfuͤhrung dieser verschiedenen Functionen einer Vorlage
betrifft, so findet man im Wesentlichen keine besondern Verschiedenheiten darin, als
nur hie und da in der Form und in der Art der Leitung der Schlitten. Im Ganzen sind
sich alle so ziemlich gleich, und von den groͤßten bis zu dem kleinsten immer
nach einem Hauptprincipe gebaut.
Ich will 2 Arten solcher Vorlagen naͤher beschreiben, die sich nur in Hinsicht
der Stellung der Bahnen fuͤr die Schlitten, also eigentlich in nichts
Wesentlichem unterscheiden.
Beide Arten haben eine Unterlage mit Ausschnitten fuͤr die Wangen. Auf diesen
Wangen koͤnnen sie ganz so geschoben und durch einen Anziehebolzen befestigt
werden, als die Doken. Die Unterlage tritt immer nach vorne mehr hervor, als nach
hinten, und traͤgt bei der erstern Art der Vorlagen auf ihrer obern
laͤnglicht vierekigen Flaͤche die Bahnen fuͤr den Schlitten.
Auf dem Schlitten ist der obere Aufsaz befestigt. Der Koͤrper der Unterlage
ist von Gußeisen, und hat 2 starke Waͤnde, die an beiden Enden verbunden
sind, und so zusammen eine Art Rahmen bilden. Fig. 28, 29, 30, 31 und 32 sieht man die
Unterlage, und zwar Fig. 28 von oben, Fig. 29 von der Seite,
Fig. 30
von unten, Fig.
31 vom vordern Ende angesehen, und Fig. 32 im
perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitte. In lezterer Figur steht der obere Aufsaz
darauf. Fig.
30, a, b, c, d, bezeichnet den Rahmen der
Unterlage, Fig.
29, e, eine ihrer starken Waͤnde. Diese
Wand tritt nach unten bei, f, mehr hervor, und hat an
ihrem untern Rande die beiden Ausschnitte, g, g,
fuͤr die Bahnen der Wangen. Bei, h,
verschmaͤlert sich die Wand, und tritt nach vorne hervor. Durch die ganze
Unterlage, und zwar ihrer Laͤnge nach laͤuft eine Schraube oder
Leitspindel Fig.
30, und, 32, i, mit flachem Gewinde. Da wo
selbige durch die Endstuͤken der Unterlage laͤuft, sind diese nach
unten etwas verstaͤrkt gegossen, damit das Loch fuͤr die Schraube
ihrer Festigkeit keinen Eintrag thue. Die Schraube dreht sich in dem vordern
Endstuͤke, k, Fig. 29, 30 und 31 mit einem
cylindrischen Zapfen Fig. 32, l, der so stark als die ganze Schraube ist. Bei dieser
Einrichtung kann die Schraube bequem durch die Oeffnung des Endstuͤkes
gebracht und in die Unterlage eingesezt werden. Nach außen hat der Zapfen der
Schraube eine Schulter Fig. 28, 29, 30, 32, m. Er verlaͤngert sich nach außen in den
cylindrischen Fortsaz, n, der am vordem Ende, o, vierekig gearbeitet ist, um die zum Umdrehen der
Schraube oder Leitspindel bestimmte Kurbel aufzunehmen. Diese Kurbel ist Fig. 34
besonders vorgestellt. Damit der Schlitten der Unterlage bei seiner Bewegung nach
vorne hinreichend Raum habe, uͤber den aͤußersten vorderen Rand
derselben uͤberzutreten, und bei diesem Herausruͤken nach vorne nicht
durch die Kroͤpfung der Kurbel aufgehalten werde, wird diese Kroͤpfung
von jenem Rande so weit als moͤglich entfernt. Diese naͤmliche
Vorsicht ist bei dem oberen Aufsaze angewandt.
Das hintere Ende der Schraube, i, dreht sich mit einem
duͤnnen Zapfen, p, Fig. 32 in dem hinteren
Endstuͤke der Unterlage, und hat auswendig zuerst einen vierekigen Aufsaz,
worauf eine Scheibe, q, gestekt, und dann durch eine
Mutter, r, befestigt wird, die auf das aͤußere
mit einem Gewinde versehene Ende des Zapfens geschroben wird. Die Schulter, m, und die Scheibe, q,
verhuͤten jede Bewegung der Schraube nach vorne oder hinten, wodurch ihre
Zapfen aus ihren Lagern kommen, und sie selbst aus der Unterlage gebracht werden
koͤnnte. Diese Einrichtung, die selbiger nur erlaubt, sich um ihre eigene
Achse zu drehen, ist noͤthig, damit sie bei dem Vor- und
Zuruͤkschieben des Schlittens, welches sie durch die an demselben befestigte
Mutter, Fig.
30 und 32, s, besorgt, nicht den Bewegungen
desselben folgen koͤnne.
Der Schlitten besteht aus einer gußeisernen, starken Platte, Fig. 28, t, von der Laͤnge der Unterlage. Ihre Breite ist
so viel schmaler als die der Unterlage, daß die Bahnen auf beiden Seiten derselben
noch gehoͤrig Plaz haben. Sie muß auf beiden Flaͤchen, ihrer unteren
und oberen, gut abgerichtet seyn. Ihre Seitenraͤnder sind dachartig
abgeschraͤgt, und
schieben sich zwischen den beiden Bahnen, Fig. 28 und 29, u, u, von Rothguß, die durch mehrere Schrauben, Fig. 28, v, v, v, v, auf die obere rahmartige, gut abgerichtete
Flaͤche der Unterlage befestigt werden. Die Oeffnungen, wodurch die
Anzieheschrauben gehen, sind etwas weniges laͤnglicht, um die Bahnen immer
genau gegen den Schlitten stellen zu koͤnnen, wodurch dessen Gang
hoͤchst fleißig bleibt. Das Stellen der Bahnen versehen 2 Stellschrauben,
Fig. 29,
w, und, x, die in die
Seitenwaͤnde der Unterlage von außen so eingeschroben sind, daß sie mir dem
oberen Theile ihres Kopfes gegen die Bahnen drangen. Die Koͤpfe aller
Schrauben, sowohl der zur Befestigung als der zur genauen Stellung der Bahnen
dienenden, liegen versenkt.
Die sich gegen den Schlitten reibenden Flaͤchen der Bahnen sind genau nach der
Form der Abdachung seiner Seitenraͤnder bearbeitet, so daß sie mit der obern
Flaͤche der Unterlage zusammen eine Art Falz bilden, der im Durchschnitte,
oder vom Ende angesehen, wie in Fig. 31 bei, y, und, z, erscheint. t, ist in dieser Figur der Schlitten, 1, das vordere
Endstuͤk der Unterlage mit der Oeffnung fuͤr die Schraube; u, u, sind die beiden Bahnen mit ihren, in dieser
Abbildung punctirt angegebenen Anzieheschrauben.
Auf der unteren Flaͤche des Schlittens, etwas nach hinten uͤber die
Mitte desselben hinaus, ist die Mutter, Fig. 30 und 32, s, von Rothguß durch 2 Schrauben befestigt, durch welche
die Leitspindel, i, den Schlitten zwischen den Bahnen
nach vorne und hinten hin und her zu schieben vermag, je nachdem sie vor-
oder zuruͤkgedreht wird.
Mitten durch die Unterlage geht noch bei Fig. 32 eine
Bruͤke, die entweder sogleich mit angegossen oder eingesezt wird, und das
Gewinde fuͤr den Anziehebolzen, der die Unterlage an die Wangen der Drehebank
zu befestigen bestimmt ist, enthaͤlt.
Die Unterlage der mechanischen Vorlage enthaͤlt hiernach das untere Schiebwerk
derselben, durch welches eine Bewegung zu dem in die Drehebank eingesezten und zu
drehenden Koͤrper heran und zuruͤk bewirkt wird. Naͤchstdem
bildet sie zugleich eine Basis fuͤr die ganze Vorlage, vermittelst welcher
sie auf der Drehebank ruht und auf selbiger befestigt werden kann. In lezterer
Ruͤksicht kann sie immer nicht stark und sicher genug gebaut werden.
Auf dem Schlitten derselben, und zwar auf dessen vorderen Theile, ist derjenige
Aufsaz befestigt, der das zweite Schiebwerk enthaͤlt, und zugleich zur
Befestigung der Drehestaͤhle oder Meißel dient. Man sieht ihn in Fig. 35 mit
der Unterlage von vorne, in Fig. 36 vom linken Ende
angesehen, Fig.
37 in seiner Verbindung mit der Unterlage von oben, und Fig. 38, A, im perpendiculaͤren Querdurchschnitte. Er ruht auf einer
gußeisernen Platte, dem Sattel, a, die den untern Theil
seines Koͤrpers bildet und mit ihm aus einem Stuͤke gegossen ist. Die
Breite dieser Platte ist der der Unterlage gleich. Ihr vorderer und Hinterer Rand
sind Kreisstuͤke, Fig. 37, b, b, aus dem Mittelpunkte der Platte beschrieben. Sie
ist im Centrum durch eine Schraube, Fig. 38, x, an den Schlitte der Unterlage befestigt. Bei, d, d, Fig. 37, nahe an den
abgerundeten Raͤndern sind Schlizen, gleichfalls in Form eines
Kreisstuͤkes geschnitten, durch welche 2 Stellschrauben gestekt werden, um
den Sattel in jeder ihm gegebenen Richtung und jedem beliebigen Winkel auf den
Schlitten befestigen zu koͤnnen. Die Stellschrauben dringen in den Schlitten
ein. Zu ihrer Aufnahme finden sich gewoͤhnlich mehrere Oeffnungen, Fig. 28, e, e, e, mit Gewinden fuͤr selbige. Alle sind so
gebohrt, daß sie gleich weit vom Mittelpunkte des Sattels entfernt liegen und genau
auf die Schlizen stoßen. Vermoͤge der Schlizen kann der Sattel in jeder
Richtung gewendet werden, wobei die zu seiner Befestigung an den Schlitten der
Unterlage dienende, und in sein Centrum gestellte Schraube die Wendungsachse
vertritt. Dadurch, daß man die Stellschraube den Bahnen der Unterlage naͤher
bringen und fixiren kann, gewinnt die Drehebarkeit des Sattels mehr Spielraum.
Um die Grade des Winkels bestimmen zu koͤnnen, unter welchen man den oberen
Aufsaz mit dem darauf befestigten Drehestahle gegen die Achse des zu drehenden
Koͤrpers richten will, ist nach hinten am Sattel ein Zeiger, Fig. 37, e, angebracht, der an einem kleinen, auf dem Schlitten
der Unterlage vorgezeichneten Gradbogen, f, die Grade
des Winkels bemerkt. Der Zeiger paßt mit einem Paar Oeffnungen, g, seiner beiden Schenkel uͤber 2 Stifte des
Sattels, und wird durch diese so an selbigen befestigt, daß er genau die
gehoͤrige Richtung behaͤlt, und doch bei vorkommenden Faͤllen
leicht abgenommen werden kann.
Der auf dem Sattel ruhende Aufsaz hat mit seinem Schiebwerke im Ganzen sowohl, als
auch in allen seinen Theilen, ganz die Einrichtung der Unterlage. Indessen ruht
selbiger, anstatt auf den Wangen, auf dem Sattel und ist unzertrennlich mit diesem
verbunden. Ueberdem liegt er parallel mit der Achse des zu drehenden Gegenstandes,
indem sein Schiebwerk bestimmt ist, den Drehestahl laͤngs desselben
hinzufuͤhren. Die Seitenwaͤnde seines Koͤrpers, der ebenfalls
eine Art Rahmen bildet, sind gefenstert (s. Fig. 35) und treten nach
der rechten Seite bei, h, hervor. Der Schlitten, die
Bahnen mit ihren Anziehe- und Stellschrauben, und die Schraube oder
Leitspindel mit der Kurbel verhalten sich alle ganz so wie an der Unterlage, nur daß
sie in allen ihren Dimensionen um ein sehr Geringes kleiner als an jener sind. Auf
dem Schlitten ist eine Platte Fig. 35, 36, 37, 32, u, von Rothguß durch Schrauben befestigt, die kreuzweis
gefensterte Stuͤke, v, von eben diesem Metalle
traͤgt, in welchen die Drehestaͤhle festgeschroben werden. Um lezteres
zu bewerkstelligen, dringt eine Stellschraube, w, durch
die Deke der Stuͤken, und druͤkt den seitwaͤrts durch eines der
Fenster gestekten Drehestahl gegen die untere Platte, wodurch er fixirt wird.
Gewoͤhnlich findet man 4 solcher Stuͤken auf der Platte, u, oft aber auch nur 2. Erstere Einrichtung hat den
Vortheil, daß der quer zu befestigende Stahl so gut durch 2 Stuͤken gestekt,
und so doppelt befestigt werden kann, als der parallel mit der Drehebank zu
stellende. Er gewinnt auf die Weise mehr Festigkeit und Sicherheit. Die in meiner
Zeichnung dargestellte Vorlage hat 4, die vom Herrn G. O. F. R. Beuth gelieferte aber nur 2 Stuͤken.
Ich muß hier noch einer anderen Vorrichtung erwaͤhnen, die man zuweilen auf
englischen Drehebanken, vorzuͤglich auf den Fox'schen, statt der Stuͤken, w, angewendet
findet. Sie ist in Fig. 38 von oben, Fig. 39 von der Seite,
und zwar mit der sie tragenden Platte allein dargestellt, und besteht aus einem
Paare breiter, in der Mitte gelochter Stuͤke, a,
und, b, von geschmiedetem Eisen. Zwei Schraubenbolzen,
c, c, die in die Platte bei, d, d, von unten konisch eingesezt, und auf diese Weise befestigt sind,
gehen durch die Oeffnungen der zwei Stuͤken, und sind uͤber denselben
mit Muttern, e, e, versehen, durch welche die
Stuͤke an die Platte oder die darauf gelegten Drehestaͤhle angezogen
werden koͤnnen. Beide Stuͤke wirken als Kneipen, wodurch die
Drehestahle festgehalten werden. Sollen leztere parallel mit der Drehebank gestellt
werden, so geschieht dieß auf die in Fig. 38 bei, f, punctirt angedeutete Weise; g, ist dann der Drehestahl. Beide Kneipen, a,
und, b, sind quer auf die Platte gestellt und fassen
uͤber denselben. Bei, h, sieht man hingegen den
Drehestahl in der Querlage. Die Kneipe, a, ist dann wie
bei, i, parallel mit der Drehebank gestellt, und faßt
ihn allein ohne Mitwirkung der anderen. Damit der Drehestahl von den Kneipen
moͤglichst sicher gepakt werde, umwikelt man ihn zuweilen an der gepakten
Stelle mit einem Streifen von Kupferblech oder einer Bleiplatte, oder legt auch
einige Stuͤke weichen Eisenbleches unter denselben. Um aber die Kneipe beim
Paken moͤglichst in horizontaler Lage zu erhalten, bringt man auf die leere
Seite derselben ein Stuͤk Holz oder Eisen, was in Fig. 38 und 39 bei, k, dargestellt ist.
Ich komme jezt zu der zweiten Art der mechanischen Vorlage. Sie findet sich seltener
in England als die vorhergehende, und zeichnet sich, wie ich schon oben bemerkt
habe, allein durch die Stellung ihrer Bahnen fuͤr die Schlitten vor der ersteren
aus. Diese sind naͤmlich nicht an dem Koͤrper der Unterlage und des
oberen Aufsazes, sondern an der unteren Flaͤche des Schlittens befestigt. Der
Koͤrper der Unterlage sowohl, als des Aufsazes, hat am oberen und
aͤußeren Rande seiner Seitenwaͤnde genau abgerichtete
Reibungsflaͤchen fuͤr die Bahnen. Sie liegen schraͤg, und so,
daß der obere Theil derselben mehr hervortritt. In Fig. 40 ist die Unterlage
einer solchen Vorlage von unten abgebildet, Fig. 41 stellt aber eine
Ansicht der ganzen Vorlage von vorne, Fig. 42 dieselbe von der
rechten Seite, Fig.
43 einen perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitt des Aufsazes,
und Fig. 44
einen gleichen der ganzen Vorlage vor. Man wird in allen diesen Figuren, die in
einem Maßstabe gegeben sind, nach welchem man die Vorlagen gewoͤhnlicher
klein-mittlerer Drehebaͤnke immer gearbeitet findet, den geringen
Unterschied dieser Art der Vorlage vor der zuerst beschriebenen nicht verkennen. Ich
will daher auch nur die wenigen Abweichungen darin naͤher zu bezeichnen
suchen. Diese betreffen vorzuͤglich den Bau des Unterlagen- und
Aufsazkoͤrpers. Man sieht bei beiden den oberen Theil, Fig. 41, 43 und 44, a, der Seitenwaͤnde naͤher zusammentreten,
so daß der dadurch gebildete Rahmen nur so viel Breite behaͤlt, um den durch
die Leitspindeln bewegten Muttern, Fig. 41, 43 und 44, b, der Schlitten darin eben Spielraum genug zu ihrer
Hin- und Herbewegung zu geben. Die Form der am oberen Rande des
Koͤrpers angebrachten Reibungsflaͤchen fuͤr die an den
Schlitten angeschrobenen Bahnen sieht man am deutlichsten in Fig. 41, 43 und 44 bei, c, c: d, sind in diesen Figuren die Bahnen, e, ist der Schlitten, auf dem, d.h. bei dem des obern
Aufsazes unmittelbar die gefensterten zur Befestigung der Drehestaͤhle
bestimmten Stuͤken, (f, f,) stehen. Bei, g, g, sieht man die Anzieheschrauben fuͤr die
Bahnen punctirt angegeben. Die Stellschrauben fuͤr die Bahnen liegen
seitwaͤrts am Schlitten. (S. Fig. 41 und 42, h, h) Die in Fig. 42 angegebenen
stellen die des Schlittens der Unterlage, die in 41 bezeichneten aber die des
Aufsazes vor. Bau und Zwek derselben sind ganz so, wie fruͤher angegeben
worden ist.
Daß diese Art der Vorlage, die wegen der zwekmaͤßigeren, vor jeder
Verunreinigung mehr gesicherten Stellung ihrer Bahnen gewiß große Vorzuͤge
vor der zuerst beschriebenen hat, in England noch so wenig im Gebrauche ist,
ruͤhrt wohl vorzuͤglich von dem Umstande her, daß ihr Princip noch
eine neuere Erfindung ist. Ich sahe selbige zum ersten Male beim Herrn Wright, dem Erfinder der Knoͤpfnadelmaschine, und
einer neuen und sehr beruͤhmt gewordenen Art Krahn, die vorzuͤglich in
den Westindiendoks angewandt wird. Herr Wright konnte die
Vorzuͤge derselben nicht genug ruͤhmen.
Ich lasse mich uͤber den Zwek und den Nuzen solcher mechanischen Vorlagen
weiter nicht aus, da selbige sattsam bekannt sind. Auch hoffe ich, daß jeder
Mechaniker aus der beschriebenen Construction derselben uͤber die Art ihrer
Handhabung voͤllig Licht erhalten haben wird, wenn er aus derselben weiß, daß
der Drehestahl durch die zwei Schlitten, den der Unterlage und den des Aufsazes, in
zwei verschiedenen Hauptrichtungen hin und zuruͤk bewegt werden kann; einmal
gegen den zu drehenden Koͤrper au und zuruͤk, und zweitens
laͤngs desselben hin und her. Daß beide Bewegungen combinirt werden
koͤnnen, um der Arbeit der Drehestaͤhle eine schraͤge oder
schiefe Richtung zur Hervorbringung aller moͤglichen Formen an den zu
bearbeitenden Koͤrpern zu geben, leuchtet ebenfalls von selbst ein. Wie man
durch Stellung des oberen Aufsazes in verschiedenen Winkeln gegen die Achse des zu
drehenden Gegenstandes arbeiten koͤnne, zeigt der Bau dieses Aufsazes und der
fuͤr diesen Zwek bestimmten Nebentheile desselben.