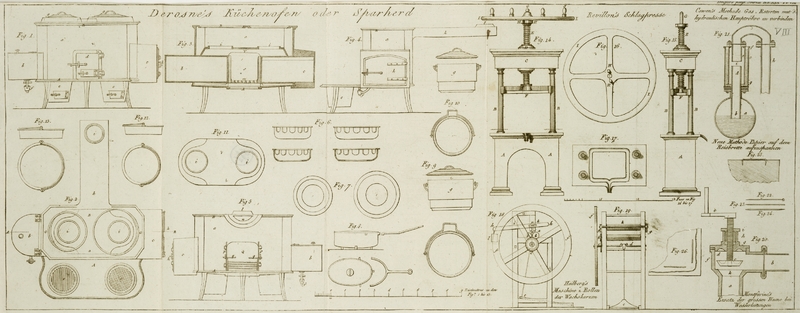| Titel: | Vorrichtung zum Ersaze der großen Hähne an Wasserleitungen. Von Hrn. Moulfarine, Mechaniker zu Paris. |
| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. CV., S. 405 |
| Download: | XML |
CV.
Vorrichtung zum Ersaze der großen Haͤhne
an Wasserleitungen. Von Hrn. Moulfarine, Mechaniker zu Paris.
Aus dem Recueil industriel, N. 19. S.
62.
Mit Abbildungen auf Tab.
VIII.Dieser Aufsaz befindet sich auch im Industriel.
Moulfarine's Vorrichtung zum Ersaze der großen Haͤhne an
Wasserleitungen.
(Die Schwierigkeit, welche bei dem Oeffnen und Schließen großer Haͤhne an
Wasserleitungen Statt hat, ist allgemein bekannt, und Hr. Moulfarine hat dieselbe auf eine sehr sinnreiche
Weise beseitigt.)
Fig. 20 zeigt
diese Vorrichtung im senkrechten Durchschnitte durch die Achse. Das Wasser, welches
durch eine Roͤhre herbeistroͤmt, wird in groͤßerer oder
geringerer Menge in eine andere gelassen, die mit der vorigen einen rechten Winkel bildet. Statt des
gewoͤhnlichen, nur mit Muͤhe zu drehenden Hahnes geschieht dieß
mittelst einer kegelfoͤrmigen Klappe, die man mittelst einer Kurbel mehr oder
minder oͤffnen kann.
a, Roͤhre, durch welche das Wasser zufließt.
b, zweite Roͤhre unter einem rechten, oder irgend
einem anderen Winkel auf, a, die das Wasser aufnimmt,
und an irgend einen beliebigen Ort leitet.
c, kegelfoͤrmige Klappe aus Kupfer, die der
groͤßeren Leichtigkeit wegen ausgehoͤhlt ist. Sie ist so vorgerichtet,
daß sie sich frei um einen Zapfen am Ende einer kupfernen Schraube, d, drehen kann, an deren anderem Ende eine Kurbel
angebracht ist, e.
Die Klappe, c, liegt frei, so daß sie auf allen Seiten in
der kreisfoͤrmigen Buͤchse, f, die den
Kopf der Roͤhre, a, bildet, freies Spiel hat.
g, ist eine Scheibe aus Kupfer, die auf einer Dille, h, aufgestekt ist. Diese Scheibe dient als Mutter
fuͤr die Schraubenspindel, d, und ist innenwendig
durch eine Kehle frei: sie schraubt sich innenwendig oben auf die Buͤchse,
f, auf, und eine Scheibe von Pappendekel ist
zwischen dem Rande der Buͤchse, f, und der
Scheibe, g, eingeschlossen.
In die Dille, h, schraubt sich noch eine Roͤhre
mit einem vielekigen Kopfe, i, auf welchen ein
Schluͤssel paßt, mit welchem man die Roͤhre in der Dille einschrauben
oder aus derselben herausnehmen kann. Die Schraube, d,
laͤuft in der Roͤhre, i, ganz frei, und
schraubt sich nur in der Scheibe, q.
Aus dieser Beschreibung ergibt sich das Spiel dieser Vorrichtung von selbst. Man
seze, daß die Roͤhre mittelst eines Schluͤssels in die Dille, h, so eingeschraubt wurde, daß der Kopf der
Roͤhre auf dem Rande der Dille aufliegt (wie die Figur zeigt): wenn man nun
die Kurbel, e, in einer gewissen Richtung dreht, so wird
die Schraube, d, so weit hinabsteigen, daß die Klappe,
c, vollkommen in die kegelfoͤrmige Oeffnung,
k, die die Muͤndung der Roͤhre, a, bildet, eintritt, und in derselben fest
niedergedruͤkt wird. Da nun diese Oeffnung auf die Klappe genau zugeschliffen
wurde, so muß, sobald die Schraube, d, sich nicht mehr
drehen kann, die Klappe, c, die Oeffnung, k, hermetisch schließen, und dem Wasser jeden Zutritt in
die Buͤchse, f, verwehren. Wenn man aber im
Gegentheile die Kurbel, e, in entgegengesezter Richtung
dreht, so wird die Schraube, d, in die Hoͤhe
steigen, folglich auch die Klappe, c, in die
Hoͤhe steigen, die die Oeffnung bei, k, schließt,
und dem Wasser der Roͤhre, a, erlauben, sich in
die Buͤchse, f, zu stuͤrzen und in die
Roͤhre, b, uͤberzugehen, oder in jede andere
Roͤhre, die man an dem Umfange der kreisfoͤrmigen Buͤchse, f, angeschraubt hat. Es ist offenbar, daß das Wasser in
groͤßerer oder geringerer Menge in die Buͤchse, f, gelangen wird, je nachdem man die Klappe mehr oder minder von der
Muͤndung, k, entfernt. Man kann folglich hiernach
die Menge Wassers reguliren, die durch die Roͤhre, b, laufen muß, je nachdem man die Entfernung der Klappe, c, von der Oeffnung, k,
bestimmt hat. Um nun diese Entfernung bestimmen zu koͤnnen, hat man die
Roͤhre mit der Schraube in der Dille, h,
angebracht. Wenn die Klappe bis zu jener Hoͤhe gehoben ist, wo die verlangte
Menge Wassers ausfließt, hebt man die Roͤhre, bis ihr Kopf, i, an die Kurbel anstoͤßt. In dieser Lage kann
die Klappe nicht mehr tiefer hinabsteigen, und kann keine groͤßere Menge
Wassers ausfließen lassen, bis man die Roͤhre nicht wieder anders gestellt
hat.
Tafeln