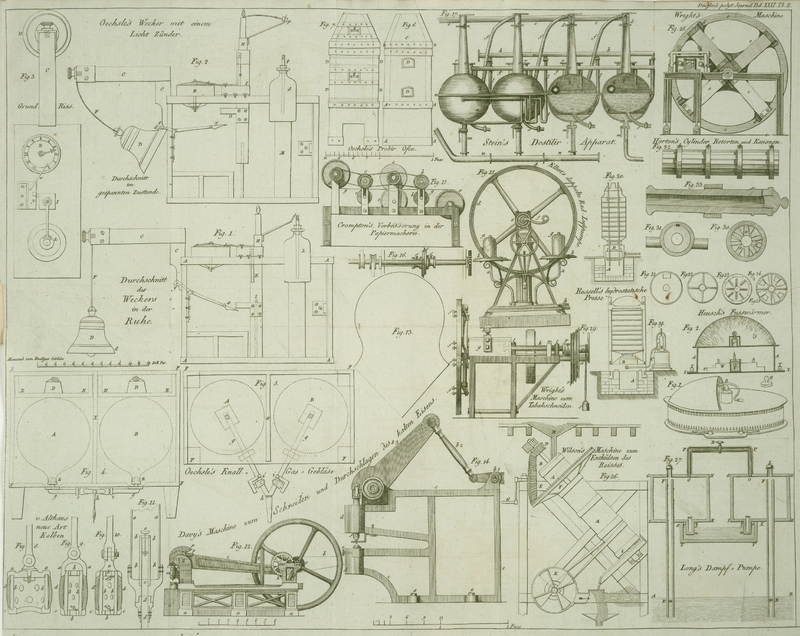| Titel: | Gefahrloses Knallgas-Gebläse von Ferdinand Oechsle in Pforzheim. |
| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. XXV., S. 93 |
| Download: | XML |
XXV.
Gefahrloses Knallgas-Geblaͤse von
Ferdinand Oechsle
in Pforzheim.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Oechsle's gefahrloses Knallgas-Geblaͤse.
Um das Knallgas-Geblaͤse gefahrlos zu machen, muͤssen beide
Gasarten in besondern Behaͤltern aufbewahrt werden, damit keine Explosion
veranlaßt werden, und der Experimentator ohne Angst vor diesem Apparat sizen und
seine Arbeit verrichten kann. Alle Mittel, welche man bisher zur Verhinderung einer
Explosion des Knallgases anwandte, z.B. Oehlbehaͤlter, Drathneze, enge
Roͤhren und dergl., moͤgen ihren Zwek erfuͤllen, wenn der
Apparat richtig construirt ist und von einem geuͤbten Chemiker gehandhabt
wird, aber das geringste Versehen kann Gesundheit und Leben in Gefahr bringen, und
der vorsichtige und besonnene Chemiker gehet doch mit einer gewissen Scheue und
Zaghaftigkeit mit dem Knallgas-Geblaͤse um.
Um meinen beabsichtigten Zwek zu erreichen, bediente ich mich der einfachsten Mittel,
und construirte folgenden Apparat:
Zwei große Rindsblasen mußten die Gase aufnehmen, und wurden daher mit Roͤhren
und Haͤhnen versehen; beide Roͤhren liefen in eine gemeinschaftliche,
an welcher eine abwaͤrts gebogene Loͤthrohrspize stekte, zusammen. Die
Vermischung der Gase erfolgte daher gerade hinter der Loͤthrohrspize. Beide
Blasen mit ihren Roͤhren wurden in einem Kasten mit einer Scheidewand befestigt. In
jedes Fach dieses Kastens wurde ein kleineres Kaͤstchen eingepaßt, das mit
dem erforderlichen Gewicht beladen werden konnte, welches die Blasen druͤkte,
und bei geoͤffneten Haͤhnen die Gase ausstroͤmen ließ. Die
groͤßte Schwierigkeit fand ich in dem Reguliren der Hahnoͤffnungen, um
immer ein Volum Sauerstoff- mit zwei Volum Wasserstoff-Gas
ausstroͤmen zu lassen. Die Haͤhne wurden deßhalb mit Stellschrauben
versehen, damit man die Gase schnell oder langsam ausstroͤmen lassen konnte,
und eine Reihe Versuche war erforderlich, um das richtige Verhaͤltniß der
ausstroͤmenden Gase zu finden. Folgendes Verfahren fuͤhrte mich auf
kuͤrzestem Wege zum Ziele.
Jede Blase wurde mit dem Munde aufgeblasen, und mit dem Hahne gesperrt. Auf jede
druͤkte ein zehn Pfund schweres Gewicht; es wurde eine lange
gekruͤmmte Roͤhre an die Stelle des Loͤthrohrs gestekt, und in
eine Wasserwanne geleitet. Nun ließ ich die Luft aus einer Blase in eine umgekehrte,
mit Wasser gefuͤllte Bouteille stroͤmen, und so oft sich die Bouteille
mit Luft gefuͤllt hatte, wurde jedes Mal in dem Kasten ein Zeichen gemacht,
wie tief sich das kleinere Kaͤstchen mit dem Gewicht senkte. So wurde
fortgefahren bis die ganze Blase leer war. Mit der zweiten Blase wurde auf gleiche
Weise verfahren. Ich erhielt auf diese Art eine Scale, an welcher zu erkennen war,
wie viel Luft jede Blase verloren hatte. Nun wurden beide Blasen mit Luft bis an den
ersten Strich der Scale, welcher mit o, bezeichnet war,
angefuͤllt. Beide Haͤhne wurden gleichzeitig geoͤffnet und an
der Scale beobachtet, welcher Hahn am meisten Luft durchgehen ließ, waͤre aus
einer Blase ein Volum, und aus der anderen zwei Volum Luft zu gleicher Zeit
entwichen, so haͤtten die Haͤhne keiner weiteren Correktion bedurft;
da aber dieß ein seltner Zufall ist, so mußte durch die Stellschrauben der beiden
Haͤhne die Oeffnung so lange veraͤndert werden, bis in derselben Zeit
aus einer Blase eins, aus der anderen zwei Volum Luft ausstroͤmten, was nur
durch die vorbereitete Scale beobachtet werden konnte.
Hat man das richtige Verhaͤltniß der ausstroͤmenden Luft gefunden, so
fuͤllt man die Blasen auf folgende Weise: Die Blase, welche zwei Volum
Wasserstoff-Gas abgibt, wird moͤglichst luftleer gemacht; alsdann
fuͤllt man eine gewoͤhnliche Weinbouteille zur Haͤlfte mit
verduͤnnter Schwefelsaͤure, wirft einige Loth Zink hinein, sezt eine
elastische Roͤhre auf die Bouteille, verbindet das andere Ende der
Roͤhre mit der Muͤndung des Gasrohres, und laͤßt so viel
Wasserstoff-Gas in die Blase, bis sie voll ist, worauf man den Hahn
verschließt. Die andere Blase, welche ein Volum Sauerstoff-Gas aufnehmen muß,
wird ebenfalls zuerst moͤglichst luftleer gemacht und dann vermittelst eines Korken
eine kleine glaͤserne Retorte an das Gasrohr befestigt. In diese Retorte
bringt man ungefaͤhr ein halb Loth chlorsaures Kali (Kali muriaticum oxydatum) mit eben so viel Braunstein abgerieben; lezterer
verhindert das starke Aufblaͤhen und Uebersteigen. Man erhizt sodann die
Retorte mit einer Weingeistlampe, um das Sauerstoff-Gas aus dem chlorsauren
Kali auszutreiben; dabei muß man sich aber vor zu schnellem Erhizen derselben
huͤten, weil das Gas schon bei maͤßiger Hize entweicht und ein zu
starkes Feuer die Retorte aus dem Korke treiben und zerbrechen koͤnnte. Ist
nun diese zweite Blase mit Sauerstoff-Gas gefuͤllt, so verschließt man
den Hahn.
Will man eine Schmelzprobe, z.B. mit Platinna machen, so legt man ungefaͤhr
ein bis drei Gran davon auf eine Kohle, in die man zuvor ein Gruͤbchen
gemacht hat. Man oͤffnet den Wasserstoff-Gas-Hahn,
zuͤndet das Gas mit einem Fidibus an, und oͤffnet dann auch den
Sauerstoff-Gas-Hahn; sobald lezterer Hahn geoͤffnet wird,
verkuͤrzt sich die Flamme auffallend. Das zum Schmelzen bestimmte Metall auf
der Kohle wird nun an die Spize der abwaͤrts brennenden Flamme gehalten. So
wenig die Flamme an der Tageshelle leuchtet, so sehr wird diese Leuchtkraft steigen,
wenn die Flamme einen festen Koͤrper trifft. Hat man die rechte Entfernung
von der Loͤthrohrspize getroffen, so wird die Lichtstaͤrke so heftig,
daß die Augen eben so sehr geblendet werden, wie wenn man in die unbewoͤlkte
Sonne sieht. Diese Schmelzproben erfordern aber eine gewisse Uebung und
Behendigkeit. Kleine Cylinderchen von Thonerde schmelzen zu einer gelblichten
Glasperle. Silber verdampft und verbreitet einen feinen Staubregen um die Kohle.
Graphit zerknistert anfaͤnglich, endlich aber schmilzt er zu einem schwarzen
Glase. Platinna schmilzt mit Funkenspruͤhen, wie schweißendes Eisen oder
Stahl.
Erklaͤrung der Zeichnung.
Fig. 5.
Grundriß, F, F, F, F, hoͤlzerner Kasten mir einer
Scheidewand, X. A, B, zwei große Rindsblasen mit
messingenen kegelfoͤrmigen Muͤndungen, welche in Fig. 3, z, z, deutlicher zu sehen sind. g, g, zwei Roͤhren, die in h,
zusammenlaufen. i, i, Haͤhne mit Stellungen, die
zum Reguliren der Oeffnungen dienen. Bei h, ist ein
abwaͤrts gebogenes kleines Loͤthrohr angestekt.
Fig. 4, zeigt
den Kasten im Aufriß, alle Theile mit gleicher Bezeichnung. K, K, zeigt die kleinen Kaͤstchen, mit den zwei Gewichten, D, D, jedes von zehn Pfund, welche auf die Blasen, A, B, druͤken.
(Preis dieses Apparats Fl. 34.)
Tafeln