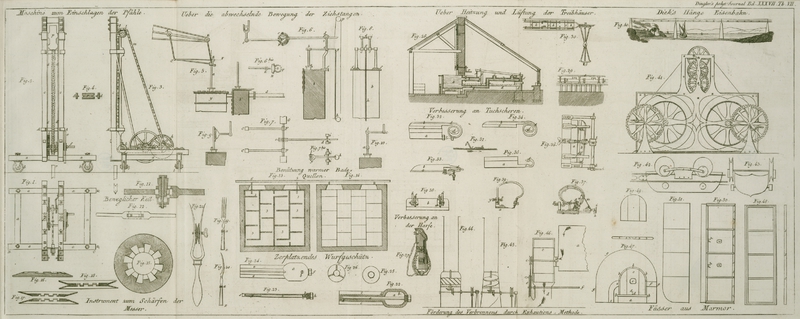| Titel: | Bestimmung der abwechselnden Bewegung der Ziehstangen, Schieber und Klappen, durch welche an einer Dampfmaschine von gewöhnlichem Baue die Verbindung zwischen dem Kessel, dem Cylinder und dem Verdichter hergestellt wird; Bestimmung des Spieles dieser Theile unmittelbar aus der abwechselnden Bewegung des Schwung- oder Wagebalkens. Von Hrn. Verdam. |
| Fundstelle: | Band 37, Jahrgang 1830, Nr. LXXXIII., S. 325 |
| Download: | XML |
LXXXIII.
Bestimmung der abwechselnden Bewegung der
Ziehstangen, Schieber und Klappen, durch welche an einer Dampfmaschine von
gewoͤhnlichem Baue die Verbindung zwischen dem Kessel, dem Cylinder und dem
Verdichter hergestellt wird; Bestimmung des Spieles dieser Theile unmittelbar aus der
abwechselnden Bewegung des Schwung- oder Wagebalkens. Von Hrn. Verdam.
Aus der Correspond. mathém. et phys.Diese Correspondance
mathématique et physique, welche heftweise erscheint, und
in Deutschland wenig bekannt ist, verdient die Aufmerksamkeit der deutschen
Zeitschriften fuͤr Mathematik, indem sie manches Gute
enthaͤlt. A. d. Ue. T. W. 4e livr. p. 255 im Bulletin d. Scienc. technol. Mars. p.
261.
Mit Abbildungen aus Tab.
VII
Verdam, uͤber Bewegung der Ziehstangen, Schieber und Klappen
etc.
Unter gewissen Umstaͤnden muß diesen Theilen ihr Spiel auf eine andere Weise,
oder durch andere Theile der Maschine mitgetheilt werden! Gewoͤhnlich
geschieht dieß mittelst einer excentrischen Scheibe, die an der Achse des
Schwungrades angebracht ist. Um diese excentrische Scheibe bewegt sich in einer
Kehle ein kupferner Ring, an welchem platte Staͤngelchen angebracht sind,
die, von der Achse des Flugrades auslaufend, an dem anderen Ende der Maschine
zusammentreffen, und an einer horizontalen Stange befestigt sind, welche mittelst
Kurbeln und Stoßstangen den Schiebern und Klappen etc. eine Bewegung hin und her
mittheilt. Wer den Bau einer Dampfmaschine kennt, weiß, daß man oͤfters, um
die Bewegung der excentrischen Scheibe diesen Theilen mitzutheilen,
vorzuͤglich wenn sie aus laden oder Schiebern bestehen, die man mit Recht den
Klappen vorzieht, starker und langer Stoßstangen bedarf. Abgesehen von diesen
lezteren fordert der excentrische Apparat auch noch platte Stangen, die eben so lang
sind, als die Maschine, und daher sieht man nicht selten excentrische Scheiben an
starken Maschinen mir Stangen von 8 Metern Lange und daruͤber. Wenn man nun
diese langen Stangen vermeiden, und die Anzahl der uͤbrigen Stoßstangen
vermindern, dafuͤr aber einen anderen, wenn auch nicht einfacheren, doch
gedraͤngteren und weniger unbequemeren Mechanismus anbringen kann, so ist es
klar, daß die Maschine dadurch wohlfeiler wird. Dieß ist nun bei folgendem
Mechanismus der Fall, welchen man in vielen Faͤllen wird anwenden
koͤnnen. Indessen kann man denselben mehr als Aufloͤsung eines
Problemes der angewandten Mathematik, denn als eine wichtige Vereinfachung
betrachten.
Es sey AB (Fig. 5.) ein Theil des
Schwung- oder Wagebalkens; ABCD das
Parallelogramm, an welchem die Stange a des arbeitenden
Staͤmpels angebracht ist, der sich in dem Cylinder, y, bewegt; b der Kasten oder die Abtheilung,
in welchem die Schieber sich bewegen, und in welchen der Dampf sich begibt, wenn er
aus der Dampfroͤhre, d, herbeifließt. Man weiß,
daß das Hauptstuͤk, durch welches das Ende D des
Parallelogrammes beinahe der Senkrechten folgt, eine horizontale Stange, CE, ist, die sich um den feststehenden Zapfen E dreht etc. Man weiß ferner, daß der Punkt E sich gewoͤhnlich auf der Seite von BD befindet, wenn AB in der horizontalen Lage ist, d.h., daß die Punkte E (denn es gibt deren zwei, zu jeder Seite des
Wagebalkens einen) sich in derselben verticalen Ebene befinden, die durch die Stange
a laͤuft, und senkrecht auf die Laͤnge
des Wagebalkens ist. Man weiß ferner, daß dieser Punkt E
auf jeden beliebigen Punkt der horizontalen Linie uͤbertragen werden kann,
wenn man anders die Laͤnge AB oder die
Breite AC des Parallelogrammes gehoͤrig
wechselt; alles dieß geschieht mittelst eines sehr einfachen Mechanismus, der
wahrscheinlich allen Dampfmaschinen-Fabrikanten bekannt ist.
Man seze nun der Punkt E sey nach F uͤbertragen, etwas vor dem Parallelogramme, und die Stangen CF (siehe Fig. 6 und 7., die
horizontalen und verticalen Entwuͤrfe des Mechanismus) drehen sich nicht um
Zapfen, sondern seyen an einer runden Stange FF
befestigt, die sich in zwei Lagern, GG, dreht.
Diese Stange wird also, durch die abwechselnde Bewegung der Stangen, CF, eine abwechselnde kreisfoͤrmige
Bewegung erhalten; sie hat eine nur wenig bedeutende Last zu tragen, kann also, ohne
daß sie sich deßwegen beugen duͤrfte, so duͤnn seyn, als ihre
Laͤnge es nur immer gestattet.Wenn man die Lage der Zapfen E (Fig. 5.) nicht
veraͤndern wollte, so koͤnnte man die Stange, FF, mittelst eines kleinen
gezaͤhnten Bogens, H, Fig. 6. bis sich
drehen lassen, der an der Verlaͤngerung von CE befestigt ist, und in ein auf der
Achse, FF, angebrachtes Rad eingreift.
Dadurch werden, aber die Theile des Mechanismus auf eine unnuͤze
Weise vervielfaͤltigt, indem kein Grund vorhanden ist, warum der
Umdrehungspunkt der Stangen CE vielmehr in
E als in F seyn
soll. A. d. O.
In der Mitte von FF ist ein kleiner excentrischer
Kreis, e, befestigt, der von einem Ringe umfaßt wird, in
welchem er sich frei bewegen kann, wie dieß bei der gewoͤhnlichen
excentrischen Scheibe geschieht. Die Stange, ed,
dieser excentrischen Scheibe ruht auf einem Halsbande, d, (Fig.
5, 6 und 7.) (Fig. 7. ist ein Seitenaufriß) in der Mitte einer kleinen Achse, ii, an deren Enden sich die senkrechten Hebel, ic, befinden, welche gleichfalls auf der
horizontalen Achse, cc, befestigt sind; so daß die
Achse, cc, sich drehen wird, wann die Hebel,
ic, in Bewegung gesezt werden. In der Mitte von
cc ist der Arm des Hebels cb befestigt, der zulezt noch an der Stange, ab, der Laden oder Schieber haͤngt.
Aus dieser Beschreibung erhellt, daß durch die abwechselnde Umdrehung der Achse, FF, die excentrische Scheibe in ihrem Ringe sich
schwingen, und ihre Stange, ed, eine Bewegung hin
und her erhalten wird, wodurch die Stange, ab, und
folglich auch die Schieber, ihre Bewegung von oben nach abwaͤrts und von
unten nach aufwaͤrts erhalten. Wir wollen nun einige Bemerkungen
beifuͤgen.
1) Da die Schieber sich sowohl nach aufwaͤrts, als nach abwaͤrts
bewegen muͤssen, waͤhrend der Staͤmpel Einen Lauf vollendet, so
kann man diese Bewegung ohne excentrische Scheibe nicht einfacher hervorrufen; wenn
die Bewegung von ab gleichzeitig mit jener der
Stange des arbeitenden Staͤmpels waͤre, so koͤnnte man CF uͤber F
hinaus bis nach b verlaͤngern, und die Stange ab unmittelbar an CF befestigen; allein, das Gesez der Bewegung der Schieber erlaubt eine so
einfache Vorrichtung nicht. Da die excentrische Scheibe an der Achse FF angebracht ist, so wird die Ursache klar, warum
der Punkt E, Fig. 7., auf F uͤbertragen werden muß; denn sonst waͤre
die excentrische Scheibe durch die horizontale Achse, D,
welche in ihrer Mitte die Staͤmpelstange fuͤhrt, in ihrer Bewegung
gehindert. Die excentrische Scheibe kann außerordentlich klein seyn, selbst an den
staͤrksten Maschinen, und man wird begreifen, daß die Excentricitaͤt
die Laͤnge von ed, und die Laͤnge
der Hebel sich leicht so reguliren laͤßt, daß die Schwingungen der
excentrischen Scheibe genau jenen Lauf erzeugen, welchen die Schieber nehmen
muͤssen, indem derselbe von den Dimensionen der Maschine abhaͤngt, und
bei Maschinen von mittlerer Starke, von der Kraft von 12 bis 24 Pferden, kaum mehr
als ein Decimeter betraͤgt. Ich bleibe daher nicht laͤnger bei den
Laͤngen der Stuͤke stehen, die immer ohne Vergleich kleiner und
weniger der Anzahl nach seyn werden, als bei der gewoͤhnlichen
Einrichtung.
2) Die Achse ii ist frei, die Achse cc aber feststehend; es muͤssen demnach auf
der Hoͤhe cc zwei feststehende
Stuͤzen vorkommen. Die großen Maschinen mit zwei Saͤulen, so wie die
Maschinen mit sechs Saͤulen, die tragbar sind, bieten beinahe immer leichte
Mittel dar, diese Stuͤzen auf dem oberen Gestelle der Maschine, oder auf den
Saͤulen zu befestigen. Was aber die tragbaren Maschinen mit zwei
Saͤulen betrifft, so muͤssen diese Stuͤzen mittelst zweier
kleinen Saͤulen, cf, Fig. 6 und 3 am Dekel der
Abtheilung b befestigt werden.
3) Die Stange, ab, muß eine vollkommen verticale
Bewegung, oder wenigstens eine solche erhalten, die derselben so viel nur immer
moͤglich gleich kommt. Dieß geschieht auf folgende Weise:
a) Wenn der Arm des Hebels, cb, Fig.
6 und 7.
bis, sich in eine Gabel endet, die an jedem Ende mit zwei Loͤchern
zur Aufnahme eines Joches versehen ist, an welchem die Stange, ab, haͤngt, und wenn diese Loͤcher
eifoͤrmig sind, und weiter als der Durchmesser des Joches (wie Fig. 6.
zeigt); so ist es klar, daß, durch dieses Spiel, die Abweichung des Endes b der Senkrechten keine Abweichung von ab veranlassen kann. Diese Vorrichtung
waͤre unvollkommen, und die ovalen Loͤcher wuͤrden sich bald
abnuͤzen, wenn der Lauf von ab sehr groß
waͤre; da er aber sehr klein ist, so bin ich geneigt zu glauben, daß man
diese Vorrichtung an großen Maschinen eben so gut, als an mittleren, anbringen
koͤnnte.
b) Man koͤnnte indessen an großen Maschinen den
Arm cb mit der Stange ab verbinden, und zwar mittelst einer Zwischenstange, ab, Fig. 10., mit zwei
Gliederungen a und b.
c) oder was noch besser waͤre, ein kleines
Parallelogramm an dem Arme, bc, anbringen. Dieses
Parallelogramm macht keine Schwierigkeiten, in dem es sehr klein ist, fordert aber
einen fixen Punkt mehr. Endlich koͤnnte man auch noch eine andere Vorrichtung
anbringen, wie Stoßstangen, durch welche sich die verlangte Verticalitaͤt
erhalten ließe.
d) Die Verticalitaͤt erhaͤlt man auch
mittelst eines gezaͤhnten Bogens (Fig. 9.), der in die
Stange, ab, eingreift, welche, zu diesem Ende, in
einen Zahnstok auslaͤuft. Da die Bewegung von ab sehr langsam ist, und die Zaͤhne des Zahnstokes beinahe nichts
zu nagen haben, wegen des Gegengewichtes, gh, Fig. 6., so
ist es offenbar, daß die Bewegung genau und leicht seyn wird, und die Zahne sich
durch die abwechselnde Veraͤnderung der Bewegung nicht viel abnuͤzen
werden. Man kann aber nicht sagen, daß diese Vorrichtung die einfachste ist.
e) Wenn man endlich dem Arme, cd, die Laͤnge Eines Meter geben kann, so
wird der beschriebene Bogen sich nicht viel an seinem Ende, b, von der Senkrechten entfernen, und man wird immer eine Gabel b, (Fig. 6 und 7. bis) mit
ovalen Loͤchern, und selbst mit runden (die sich beinahe gar nicht merklich
abnuͤzen) anwenden koͤnnen, wenn die Laͤnge von ab wenigstens auch Ein Meter betraͤgt.
4) Das Gegentheil gh muß nach abwaͤrts
verlaͤngert werden, damit der Maschinist dasselbe ergreifen kann, um die
Maschine in den Gang zu sezen. Zugleich muß er die Stange aus der
Excentricitaͤt ihres Halsbandes, d (Fig. 6 und
8.)
bringen, was mittelst eines gabelfoͤrmigen Stokes, oder mittelst einer Schnur
geschehen kann, die uͤber eine Ruͤksendungsrolle, p, laͤuft.
Tafeln