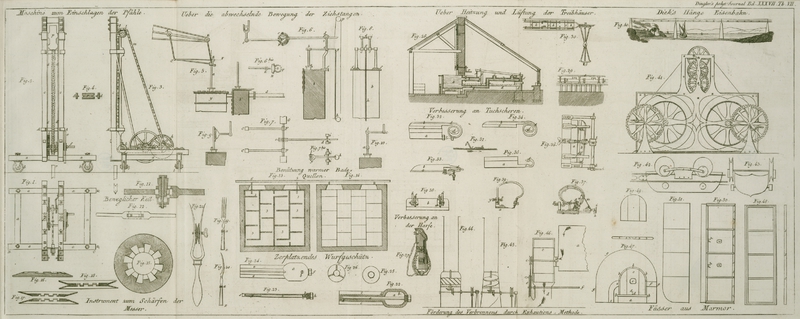| Titel: | Fässer aus Marmor zur Aufbewahrung des edlen Unger-Weines. Auszug eines Schreibens an den Hrn. Grafen St. Priest, dd. Pesth 27. Dec. 1829. |
| Fundstelle: | Band 37, Jahrgang 1830, Nr. CI., S. 356 |
| Download: | XML |
CI.
Faͤsser aus Marmor zur Aufbewahrung des
edlen Unger-Weines. Auszug eines Schreibens an den Hrn. Grafen St. Priest, dd. Pesth 27. Dec. 1829.Wir haben schon vor mehreren Jahren in unseren Blaͤttern, und erst vor
Kurzem wieder, den edlen Ungern vorgeschlagen, zur alt-roͤmischen
Sitte zuruͤck zu kehren, und ihre herrlichen Weine, die im Fasse so sehr
leiden, nach der alten classischen Methode in thoͤnernen Gefaͤßen
aufzubewahren; wir haben es einem jungen Toͤpfer aus Wien an das Herz
gelegt, seine lieben Nachbarn mit den classischen Amphoris, Cadis Doliisque aus Thon zu versehen. Es freut, uns, daß,
wie wir hier sehen, einige Magnaten unsere Idee im Großen ausgefuͤhrt,
und dem Jacchus Pannonicus einen, seiner
Goͤttlichkeit wuͤrdigen Altar aus Marmor erbaut haben. Wo man mit
solchen Beispielen vorausgeht, wird es an Nachfolgern nicht fehlen, und Europa
wird vielleicht von den Ungern wieder die alte Sitte lernen, seinen Wein in
thoͤnernen Faͤssern aufzubewahren, wie es in Spanien hier und da
noch heute zu Tage Sitte ist. Lernten doch die groͤßten und besten
Landwirthe Frankreichs, die ehrwuͤrdigen Ternaux, erst vor 12 Jahren, ihr Getreide nach der besten Methode von
der Welt, nach der ungrischen, in Silos aufbewahren. A. d. Ue.
Aus dem Bulletin des Scienc. techn. Avril
1830.
Mit Abbildung auf Tab.
VII.
St. Priest, Faͤsser aus Marmor zur Aufbewahrung des edlen
Ungerweines.
Es gibt bisher zwei Faͤsser auf Marmor in Ungarn: das eine zu Ofen
gehoͤrt Hrn. Margofi, und ist mit Ofner
gefuͤllt; das andere haben Sie bei mir gesehen: es ist gegenwaͤrtig
mit dem besten alten Tokayer gefuͤllt. Beide Faͤsser sind nach
derselben Idee gebaut, und gewaͤhren folgende Vortheile:
1) da Marmor im Keller so kalt bleibt, wie dikes Glas, so wird der Wein nicht zu
warm; die Gaͤhrung geht in marmornen Faͤssern ruhiger und
regelmaͤßiger von Statten, als in hoͤlzernen.
2) ein marmornes Faß, gehoͤrig verfertigt, schuͤzt den Wein eben so gut
vor der Kellerluft, als eine gute Flasche; es verduͤnstet auch nicht ein
Tropfen, und man erspart das Nachfuͤllen, das bei hoͤlzernen
Faͤssern so bedeutend ist. Es ist daher
3) aus Obigem offenbar, daß der Wein sich laͤnger und besser in Marmor
haͤlt, als in dem poroͤsen Holze; daher sind auch Faͤsser aus
Marmor vorzuͤglich fuͤr edlere ungrische Weine zu empfehlen. Die alten
Roͤmer bewahrten ihren Wein in steinernenMit Erlaubniß des hochgebornen Hrn. Verfassers waren die Amphoren bei den Roͤmern keine steinernen
Gefaͤße sondern irdene. Amphora cepit
institui, currente rotâ cur urceus exit! fragt Horaz. Wir wissen auch aus Plinkus, daß nicht bloß die Amphorae,
sondern selbst die Faͤsser bei den Alten, von Toͤpfern aus
Thon verfertigt wurden: „etiam fictilibus
doliis ad vina excogitatis, et ad aquas. Propter quae Numa rex
septimum collegium figulorum instituit. Quin et defunctos sese multi
fictilibus doliis condi maluere, sicut M. Varro.“
Glaͤserner Amphorae finden wir nur bei
Petronius erwaͤhnt, und diese scheinen
mit Gyps uͤberzogen gewesen zu seyn, damit sie nicht so leicht
brechen; denn er nennt sie gypsatae. Einer
steinernen Amphora, der einzigen, die man in der
classischen Welt kennt, erwaͤhnt Plinius
als eines Weltwunders: „Onychem etiamnum in
Arabiae montibus, nec usquam aliubi nasci putavere veteres: sudines in Germania. Potoriis primum vasis inde
factis, dein pedibus lectorum sellisque. Cornelius Nepos tradit
fuisse magno miraculo, cum P. Lentulus Spinter amphoras ex eo
chiorum magnitudine cadoruio ostendisset.“ Wie groß
ein Cadus ehius war, wissen wir nicht; der
roͤmische Cadus hat 72 Sextarios gehalten. Die roͤmische Amphora war 48 Sextarii. Ein Sextarius wird
fuͤr ein halbes Quart (Noͤßel) gehalten. Obschon das Wort Amphora (Gefaͤß mit zwei Henkeln) auch
von den classischen roͤmischen Auctoren, seines griechischen
Ursprunges ungeachtet, gebraucht wurde, so hatten die Roͤmer doch ein
echt lateinisches Wort fuͤr Amphora,
naͤmlich Quadrantal; und es ist
merkwuͤrdig, die zwei lezten Sylben dieses
alt-roͤmischen Wortes Quadrantal
noch heute zu Tage in der ungrischen Sprache als Antal erhalten zugehen. Man mißt und kauft den Tokayer in Ungarn
nicht Faß- oder Flaschen-Weise, sondern Antal-Weise. Man sagt, daß Pannonien seine Reben durch Probus erhalten habe; da aber die Roͤmer
schon fruͤher Pannonien besaßen, so laͤßt es sich leichter
erklaͤren, wie dieses Wort in die ungrische Sprache kam, als wie es
sich in derselben erhielt. Wenn des ehrwuͤrdigen guten Reynier de Lausanne Bemerkung richtig ist, daß
dort, wo der. Wein in kurzen Neben an kurzen Weinsteken gezogen wird, die
Rebe durch Griechen, und wo der Wein in langen Reben an Baͤumen und
Treillagen gezogen wird, durch Roͤmer zuerst hingepflanzt wurde (was
fuͤr Italien und fuͤr das suͤdliche Frankreich Reynier allerdings guͤltig erwiesen hat)
so haͤtte Pannonien seine Weine durch die Griechen, und nicht durch
die Roͤmer, erhalten. A. d. Ue. Gefaͤßen, und die Geschichte lehrt uns, daß die italiaͤnischen
Weine sich in diesen Amphoren weit besser erhielten, als
heute zu Tage in den Faͤssern.
4) Wenn die Reife abspringen oder los werden, oder wenn irgend ein Loch im
hoͤlzernen Fasse entsteht, so rinnt der Wein aus. Diese Nachtheile haben bei
marmornen Faͤssern nicht Statt.
5) Wenn ein hoͤlzernes Faß leer wird, nimmt es sehr oft einen uͤblen
Geschmak an, der dasselbe fuͤr die Zukunft ganz unbrauchbar macht: Marmor
hingegen nimmt nie einen Geruch an.
6) Da ein marmornes Faß nie nachgefuͤllt werden darf, so kann der
Eigenthuͤmer sein Faß siegeln und seinen Keller Jahre lang geschlossen
halten, ohne fuͤrchten zu duͤrfen, daß der Wein durch die
Nachlaͤssigkeit seiner Hallsleute leidet, oder durch ihre Untreue weniger
wird.
7) Bei einem marmornen Fasse ist keine Reparatur noͤthig. Die einzige Sorgfalt, die man
fuͤr dasselbe haben muß, ist diese, daß es keine heftige
Erschuͤtterung erleidet.
Hier folgt nun eine genaue Zeichnung und Beschreibung des oben erwaͤhnten und
gegenwaͤrtig mit Tokayer gefuͤllten Fasses.
Fig. 47.
zeigt das Faß von der Vorderseite.
Damit die zu große Schwere die weiche Erde nicht eindruͤkt, ist aaa die Grundlage aus dichten festen Steinen, auf
welchen das marmorne Faß, bbbb, ruht. In der
Abtheilung c, ist die Ziffer I, und befinden sich nach unten zu zwei Oeffnungen, dd. Durch die obere dieser Oeffnungen laͤßt
man den reinen Wein ab, durch die untere den Bodensaz, der sich in derselben bildet.
Auf einer Seite sind der ganzen Laͤnge des Fasses nach fuͤnf steinerne
Stuͤzen angebracht, ee, welche tief in die
Erde eingelassen sind. Auf der entgegengesezten Seite, g, sind fuͤnf Steine in dem Gewoͤlbe angebracht, auf welche das
Faß sich stuͤzt. Diese ganze Vorrichtung ist in allen ihren Theilen so fest
verbunden, daß nur eine sehr heftige Erschuͤtterung im Stande waͤre
sie zu beschaͤdigen.
Fig. 48.
zeigt den unteren Theil dieses marmornen Fasses, der in zwei Theile getheilt
ist.
Fig. 49. ist
eine der drei Abtheilungen, durch welche dieses Faß in vier Abtheilungen gebracht
ist. Denn es waͤre unmoͤglich ein solches Faß, das zur Aufbewahrung
des besten Tokayers bestimmt ist, in Einem Jahre mit solchem Weine von derselben
Guͤte zu fuͤllen.
Fig. 50.
zeigt die Ausdehnung der vier Abtheilungen, und die Oeffnungen, dd, der zwei mittleren Abtheilungen, Nro. 2 und 3, bei dd.
Fig. 51.
stellt die Außenseite der Laͤnge nach dar.
Die gegenuͤberstehende Seite ist wie in Fig. 47., nur muß in der
mittleren Abtheilung c die Ziffer 4 statt 1 kommen.
Nach oben zu hat jede Abtheilung eine eigene Thuͤre aus Marmor, damit man in
das Faß einsteigen kann, wenn es leer ist. Diese Thuͤren sind mit einem
leichten Kitte verstrichen, damit keine Luft eindringen kann. In der Mitte einer
jeden derselben befindet sich eine kleine Oeffnung, durch welche man den Wein in das
Faß laͤßt, und etwas davon herausnehmen kann, wenn man denselben kosten
will.
So groß aber auch immer die Vortheile dieser Marmorfaͤsser sind, so kann man
dieselben doch nur reichen Weinguͤter-Besizern empfehlen, die ihre
Weine Jahre lang uͤber gut aufbewahren wollen. Die Anschaffung und
Aufstellung derselben kommt theuer, und wenn man sie einmal hat, lassen sie sich
nicht so leicht transportiren und handhaben, wie hoͤlzerne Faͤsser.
Wir muͤssen noch uͤberdieß bemerken, daß man diese Faͤsser erst
dann fuͤllen darf, wenn der ganze Apparat hinlaͤnglich dicht geworden
ist.
Um allen Oehlgeruch vollkommen zu beseitigen, ließ man das Faß, ehe man es mit
Tokayer fuͤllte, 9 Monate lang im Keller, und man uͤberzog den Kitt an
den Thuͤren der Abtheilungen mit Kolophonium und mit weißem Peche.So gut diese marmornen Faͤsser in jeder Hinsicht sind, so scheint es
uns doch, daß sie auf eine noch weit einfachen, wohlfeilere Weise
vorgerichtet werden koͤnnen; auf eine Weise, die auch die Reinigung
der Faͤsser ohne Vergleich mehr erleichtert. Die edlen reichen
Ungern, die leicht, wie einst die alten Roͤmer, groͤßere
Keller, als andere Leute Felder, besizen koͤnnten („quorum agri“ sagt Plinius L. 36. c 15.
von den besiegten Voͤlkern „quoque
minorem modum obtinuere, quam cellaria Romanorum“),
koͤnnen in Italien, besonders im Florentischen, in den Oehlkellern
lernen, wie man Fluͤssigkeiten in Marmor aufbewahrt. Mehrere
vierekige Marmortroͤge neben einander hingestellt, und an ihrem
oberen Rande mit einem Falze versehen, in welchen man eine Marmortafel
einschiebt, die man dann bloß an dem Falze mit grauem Thone zu verstreichen
braucht, den man dann mit Harz uͤberzieht (Wein-Bassins),
wuͤrden hinreichen.Wer mit seinen Augen gesehen hat, was in Ungern Faͤsser kosten, wie
schlecht sie sind, und wie geistig der ungrische Wein ist; wie dieser
folglich in dem Maße schlechter werden muß als die schlechtesten Weine, als
das Faß schlecht ist, in welchem er aufbewahrt wird) der wird die
Nothwendigkeit fuͤhlen, die ungrischen Weine nach Art der alten
Roͤmer in Faͤssern aus Thon, und nicht in Faͤssern aus
Holz aufzubewahren. Wenn das Gurkenwasser mit herbem Weinsteine und
Gallapfelsaure, das als sogenannter Oesterreicher, Wuͤrzburger,
Rheinwein gekeltert wird, in Faͤssern aufbewahrt werden kann, durch
welche er verduͤnstet, so geschieht dieß dadurch, daß hier kein
Alkohol verloren geht; denn diese schlechten, Magen und Bauch verderbenden
Limonaden haben nur wenig Alkohol; sie verlieren nur ihr Wasser, und werden
dadurch nur weniger waͤsserig, aber nicht weniger, geistig. Der
Ungerwein hingegen, der lauter Alkohol ist, verliert seinen Alkohol in
Faͤssern um so leichter, als Alkohol leichter als Wasser verdunstet.
Dieß ist der Grund, warum der Ungerwein, wie man allgemein klagt, sich nicht
so gut in Faͤssern verfuͤhren laͤßt, wie die schlechten
Weine. Wuͤrden die Ungern ihren Wein in Flaschen verfuͤhren,
wie die Burgunder und Bordelaisen, so wuͤrde man den Ungerwein in N.
America und im Peter- und Paulshafen eben so gut trinken
koͤnnen, als man ihn zu Oedenburg, Rust, St. Goͤrgen, Erlau,
Keszthely, Sexard, und in ganz Syrmien trinkt. Der beste Tokayer, und der
dem Tokayer weit vorzuziehende Karólysche Méneser, wird, in Faͤßchen verfuͤhrt,
schlecht: in Flaschen kann er eine Reise um den Erdball machen, und wird
eben so geistreich wieder heimkehren, als er ausfuhr. Wenn die Ungern ihre,
urspruͤnglich griechischen und roͤmischen, Weine nach
alt-griechischer und roͤmischer Weise behandeln werden, in cadis, doliis amphoris fictilibus, so werden
ihre Weine eben so classisch werden, als es ihre Reben sind. Die Ungern
koͤnnen alle Latein; sie duͤrfen nur Varro, Colunella, Plinius
lesen, und thun, was diese guten Alten uns sagten, deren classische Weisheit
wir in unserer modernen Albernheit, die wir fuͤr Allwissenheit
halten, vergessen haben. A. d. Ue.
Tafeln