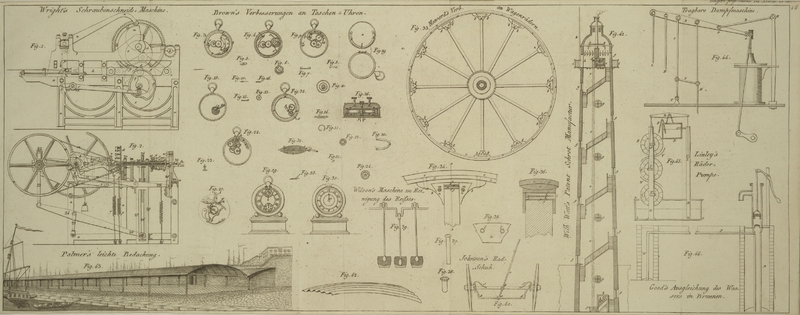| Titel: | Verbesserungen an Taschenuhren, worauf Isaac Brown, Uhrmacher in Gloucester Street, Clerkenwell, Middlesex, sich am 23. Sept. 1829 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 38, Jahrgang 1830, Nr. XCVICXVI., S. 362 |
| Download: | XML |
XCVICXVI.
Verbesserungen an Taschenuhren, worauf Isaac Brown, Uhrmacher in
Gloucester Street, Clerkenwell, Middlesex, sich am 23.
Sept. 1829 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts, N. 23., und dem
Repertory of
Patent-Inventions, N. 64.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.Wir liefern Hrn. Brown's
Patent auf Uhren, die man ohne Schluͤssel ausziehen kann, etwas
spaͤter, weil dasselbe in dem Handwerker bereits fruͤher, N. 100. im Julius
erschien, und weil wir bereits mehrere, und sogar alte, Vorrichtungen besizen,
Uhren ohne Schluͤssel aufzuziehen, dergleichen wir eine, auf welche Hr.
Berolla sich ein
Patent geben ließ, im XXXI. Bd. des polyt. Journ.,
S. 296. beschrieben haben. Erst
kuͤrzlich hat ein beruͤhmter Uhrmacher in Stuttgart, Hr. Hildenbrandt, Uhren, die
man ohne Schluͤssel aufziehen kann, nach einer neuen von ihm erfundenen
Vorrichtung verfertigt.Da der Handwerker a. a. O. in einer gegen uns (als
Reclamanten unseres Eigenthumes) gerichteten Note S. 192. sagt: „wir
legen darauf keinen Werth, ob wir etwas zuerst uͤbersezen, sondern
nur darauf, daß wir gut waͤhlen fuͤr unser Publikum und
richtig uͤbersezen;“ so haben wir die Uebersezung dieser
Patent-Erklaͤrung des Hrn. Brown im Handwerker
N. 100. mit dem Originale verglichen, und
uͤberdieß noch durch einen Dritten unsere
Uebersezung mit dem Originale und mit der Uebersezung im Handwerker vergleichen
lassen, und die Abweichungen und Weglassungen in lezterem in Anmerkungen
beigefuͤgt, damit der Leser mit eigenen Augen sehen mag, wie richtig
oͤfters selbst in jenen Blaͤttern uͤbersezt wird, die nur
darauf Werth legen, daß sie richtig uͤbersezen.A. d. Ue.
Brown, Verbesserungen an Taschenuhren.
Die Verbesserungen des Patent-Traͤgers sind: 1) eine Methode, das
Uhrwerk einer Taschenuhr oder eines Chronometers ohne Uhrschluͤssel, bloß
durch eine Verbindung des Ringes, welcher das Uhrglas haͤlt, (besel of the case) mit dem gehenden Federhause
(Cylinder) (going barrel) oder mit der gehenden Schneke
(going fusee) aufzuziehen. 2) gewisse Weisen, diese
Uhren oder Chronometer mit einem Weker zu verbinden, um lezteren zu jeder beliebigen
Zeit laut werden zu lassen. 3) eine Vorrichtung, wodurch ein Uhrgehaͤuse ein
niedlicheres Ansehen erhaͤlt, indem dadurch das Knoͤchelgefuͤge
wegfallt, mittelst dessen es gewoͤhnlich geoͤffnet wird.
1) Aufziehen ohne Schluͤssel. Wenn die Taschenuhr,
welche aufgezogen werden soll, eine sogenannte gehende Schneke hat; so ist meine
Verbesserung an derselben, wie in Fig. 3., wo eine
Taschenuhr mit einer sogenannten gehenden Schneke und mit meiner Erfindung an
derselben dargestellt ist: das Zifferblatt ist abgenommen, damit man das neue Werk
sehen kann. a ist das Rad des Federhauses, oder
Cylinders (barrel ratchet), welches die Federkraft der
unterhalt. Es ist großer als gewoͤhnlich, um mehr Kraft zu gewinnen. b der Sperrkegel, der in das Rad des Federhauses
eingreift, und den Ruͤkgang desselben verhindert. c ist die Feder des Sperrkegels. dd ist der
Aufzieher, der mit den Zaͤhnen des Rades des Federhauses correspondirt. Er
besteht aus einem kreisfoͤrmigen Ringe, mit einem inneren
kreisfoͤrmigen Zahnrade a.
Der Aufzieher ist gewoͤhnlich aus Stahl, ungefaͤhr halb so dik, als der
Raum zwischen der Saͤulenplatte und dem Zifferblatte; er kann aber auch aus
Messing, oder aus irgend einem harten dauerhaften Metalle seyn. Der Aufzieher ist in
den Ring des Gehaͤuses, welcher das Glas haͤlt, (in den sogenannten
BeselWir erlauben uns dieses altsaͤchsische Wort wieder in die deutsche
Sprache des 19ten Jahrhundertes, statt seiner Umschreibung und der
zweideutigen Synonyme Fassung, aufzunehmen. Besikel sind niederdeutsch Brillen.A. d. Ue.) eingelassen, und wenn dieser gehoͤrig an dem Gehaͤuse
angebracht ist, muß der Aufzieher gerade noch von der Saͤulenplatte frei
stehen;„Just free of the pillar
plate.“ Im Handwerker und Kuͤnstler heißt es: „die Saͤulenplatte beinahe
beruͤhren;“ was nicht richtig
uͤbersezt ist, und zu, Irrungen Veranlassung geben
koͤnnte.A. d. R. er ist an dem Besel mittelst Schrauben und Stifte befestigt, oder kann, wie
es am bequemsten ist,„As most convenient.“ Ist
im Handwerker bloß durch „oder auch“ uͤbersezt, d. i.
so viel als foͤrmlich weggelassen.A. d. R. eingekittet werden. Die Viereke, eee, sind
kleine Zapfen, zur Stuͤzung des Zifferblattes, um dasselbe in
gehoͤriger Entfernung von der Saͤulenplatte zu halten.„To support the dial from the pillar
plate.“ Im Handwerker
heißt es: „Stuͤzen, welche die
Saͤulenplatte in gehoͤriger Entfernung vom
Zifferblatte halten.“ Dieß ist nun durchaus nicht
der Fall. Die Saͤulenplatte ist durch ihre Saͤulen befestigt und gestuͤzt; das Zifferblatt wird hier durch diese Zapfen
gestuͤzt.A. d. R. Die kleinen Kreise in der Naͤhe obiger Viereke stellen die
Loͤcher zur Aufnahme der Fuͤße des Zifferblattes vor: leztere
koͤnnen auf die gewoͤhnliche Weise mit stiften befestigt werden, oder
das Zifferblatt kann auch mit Schrauben, die durch die Vorderseite desselben laufen,
aufgeschraubt werden. Die Verbindung des Besels und die Form des Gehaͤuses
sieht man deutlicher in Fig. 31., wo ich einen
Durchschnitt desselben zur besseren Einsicht dargestellt habe.
In dieser Figur ist aa der Besel, unten mit einem
hervorstehenden Rande, oo, dessen aͤußere
Kante schief in Form eines Schwalbenschwanzes zugedreht ist, und in die Furche des
Gehaͤuses, ii,ii ist weder im London Journal noch im Repertory
angedeutet. Es waͤre sehr zu wuͤnschen gewesen, daß diese
Zusammenfuͤgung der beiden Gehaͤusedekel deutlicher abgebildet
und beschrieben worden waͤre. Es waͤren dadurch auch die
Mißverstaͤndnisse im Handwerker
erspart.A. d. Ue. paßt. Der Besel ist hier als aus der Furche des Gehaͤuses ausgehoben
dargestellt, damit man ihn deutlicher sieht.
Um zu verhuͤten, daß der Besel nicht aus seinem Lager aufsteigt, wenn die Uhr
geschlossen ist, sind drei oder mehr Schrauben angebracht, wie man bei p sieht: sie laufen in gleichen Abstaͤnden durch
das Gehaͤuse.
Die Spizen derselben kommen gegen die schiefe Kante oder den Schwalbenschweif des
unten hervorragenden Randes des Besels, und hindern das Aufsteigen desselben,
waͤhrend zu gleicher Zeit dem Besel freie Umdrehung gestattet ist.
Ich bediene mich zuweilen dreier staͤhlerner Zaͤpfchen, g, g, g, Fig. 5., die an der Platte
angeschraubt werden, und uͤber den Ach zieher so hervorragen, daß derselbe
sich frei und leicht bewegen kann.„I sometimes use three steel studs, as
represented at
ggg, Fig.
3., which are screwed to the plate, and project over the
winder so, as to let the winder move easy.“ Dieß ist
im Handwerker so uͤbersezt: „Ich bediene mich manchmal dreier
staͤhlerner Kloͤbchen, wie sie bei ggg dargestellt sind, um den Aufzieher
niederzuhalten, indem sie sich uͤber denselben her erstreken,
doch so, daß sich derselbe leicht bewegen
laͤßt.“ Es ist im Originale kein Wort davon:
„um den Aufzieher
niederzuhalten;“ wohl aber von freier und leichter (easy) Bewegung.A. d. R.
b, Fig. 31. ist das Rad des
Federhauses; cc, der Aufzieher; d die Platte des Gehewerkes (movement plate); e, der Boden des
Gehaͤuses; g, das Glas. Wenn man nun Fig. 3.
untersucht, so wird es klar werden, daß, wenn der Besel des Gehaͤuses, hh, (an welchem der Aufzieher befestigt ist) von
der Rechten zur Linken im Kreise umher bewegt wird, die Zaͤhne des Aufziehers
in die Zaͤhne des Rades, a, eingreifen werden,
welches auf dem vierekigen Theile der Spindel oder des Zapfens befestigt ist, und
dadurch auch diesen lezteren drehen, und so die Hauptfeder aufziehen werden.
Wenn meine Vorrichtung aber zum Aufziehen einer Uhr mit einer Schneke gebraucht wird,
so gibt dieß einen wesentlichen Unterschied, wie aus Fig. 4. deutlich erhellen
wird.
In diesem Falle ist aa der Aufzieher mit
einwaͤrts gekehrte Zaͤhnen des Rades. b
ist das aufziehende Rad, welches sich auf einem kleinen hohlen Cylinder dreht, der
sich aus einer Stahlplatte erhebt, die in die Saͤulenplatte der Taschenuhr
eingelassen, und mit drei Schrauben befestigt ist, so daß dieser Cylinder
uͤber die Platte um nicht mehr als um die Dike des Bodens des Aufzieherades
emporragt. Fig.
5. stellt die Stahlplatte mit ihrem Cylinder im Perspective dar. Fig. 6. zeigt
das Aufzieherad mit seinem Sperrkegel und mit seiner Feder einzeln und abgenommen,
und Fig. 7.
dasselbe im Durchschnitte.
Man wird nun bei Vergleichung von Fig. 4. wahrnehmen, daß
der vierekige Theil der Schneke durch den Cylinder kommt, um welchen sich das
Aufzieherad dreht, und so viel uͤber denselben emporragt, als noͤthig
ist, um das Sperrrad des Aufzieherades, c, aufzunehmen,
welches auf dem vierekigen Theile aufgesezt ist, und daselbst mittelst eines durch
das Ende durchlaufenden Stiftes festgehalten wird.
Ich muß hier bemerken, daß das Sperrrad des Aufzieherades von dem Aufzieherade
vollkommen frei ist, so daß, wenn der Sperrkegel des Aufzieherades beseitigt oder
aus den Zaͤhnen des Sperrrades, c, ausgehoben
ist, der Schneke nach jeder Richtung freie Bewegung gestattet wird. Es ist nun
offenbar, daß, wenn der Besel der Taschenuhr, an welcher der Aufzieher angebracht
ist, von der Rechten zur linken herumgedreht wird, die Zaͤhne des Aufziehers,
die in das Aufzieherad eingreifen, dasselbe veranlassen werden sich um den Cylinder
zu drehen. Der Sperrkegel des Aufzieherades wird nun in das Sperrrad desselben
fallen, so daß dieses auch zugleich mit herumgefuͤhrt werden wird, und da
lezteres auf dem vierekigen Theile der Schneke fest sizt, wird es die Hauptfeder der
Taschenuhr aufwinden.
Wenn die Uhr auf diese Weise aufgezogen ist, so wird sie nicht ehe gehen
koͤnnen, als bis der Sperrkegel des Aufzieherades b aus dem Sperrrade desselben c ausgehoben
wird. Ich hebe daher denselben auf folgende Weise aus. dd sind zwei staͤhlerne Klammerchen, von welchen eines in Fig. 3. von der
Seite dargestellt ist. Sie sind auf der Platte aufgeschraubt, und stehen
uͤber das Aufzieherad in einer schiefen Richtung hervor, wie man in Fig. 4. sieht,
so daß ihre Spizen von dem Sperrkegel des Aufzieherades frei bleiben. Die
Vorspruͤnge der Spizen dieser Klaͤmmerchen liegen leicht auf dem Boden
des Aufzieherades auf, und verhuͤten das Aufsteigen desselben von dem
Cylinder. Es ragt ferner von der Spize des Sperrkegels eine zarte
kreisfoͤrmige Feder hervor, deren Ende von dem Mittelpunkte weiter absteht,
als der Sperrkegel oder die Sperrkegelfeder (wie man in Fig. 6. sieht); diese
zarte Feder wird also waͤhrend des Auswindens, so wie sie vor einem oder dem
anderen Klaͤmmerchen voruͤberzieht, einwaͤrts gebogen; wenn
aber der Besel in entgegengesezter Richtung gedreht, wird, von der Rechten zur
linken, so greift der Vorsprung eines jeden dieser Klaͤmmerchen innerhalb der
besagten Feder ein, und hebt den Sperrkegel aus dem Sperrrade des Aufzieherades aus,
und wenn die Spize des Klaͤmmerchens mit der Spize oder mit dem Ende des
Sperrkegels in Beruͤhrung kommt, so geht er in dieser Richtung nicht mehr
weiter. Ich bringe auch in kleiner Entfernung von dem Sperrkegel einen Stift in dem
Aufzieherade an, um zu verhindern, daß es nicht zu hoch gehoben wird.
Man sieht aus Fig.
6., daß die kleine, von dem Sperrkegel hervorspringende, Feder in der
Naͤhe der Spize des Sperrkegels etwas breiter wird, so daß, wenn der
Vorsprung des Klammerchens vor dieser Erweiterung voruͤbergezogen ist, er
nicht so leicht wieder zuruͤk kann: dieß geschieht vorzuͤglich darum,
um den Aufzieher gegen eine ruͤkgaͤngige Bewegung zu sichern, wenn die
Uhr in der Tasche getragen wird. Ich ziehe aber ein Hammerwerk vor, so wie es
gewoͤhnlich an den meisten Taschenuhren mit Hemmwerk angebracht ist, und das sich an
irgend einem bequemen Theile anbringen laͤßt.But I prefer a stop work, such as is generally used
to most stop watches, which may be introduced at any convenient
part. Dieß ist im Handwerker
uͤbersezt: „indeß ziehe ich ein Hemmwerk vor, wie es an den
meisten Uhren angebracht ist, deren Gang sich beliebig aufhalten
laͤßt.“
A. d. R.
g in Fig. 4. zeigt ein solches
Hemmwerk: die Spize des Armes greift in die Zahne des Aufziehers, wodurch der Besel
gehindert wird sich waͤhrend des Tragens der Uhr zu drehen.
Ich richte nicht immer den Aufzieher so ein, daß sich derselbe waͤhrend des
Aufziehens nach einer und derselben Richtung dreht, sondern ich befolge zuweilen
folgenden Plan, der einfacher und wohlfeiler ist, als der so eben beschriebene. aa, Fig. 9. ist eine
Zahnstokvorrichtung zum Aufziehen, welche sich um einen Schraubenzapfen oder um eine
Stuͤze bei g dreht. In der Naͤhe der
aͤußeren Kante dieser Vorrichtung, bei h, sind
zwei Stifte, und ein kurzer aus dem Besel hervorstehender Arm bei n kommt zwischen diese beiden Stifte zu liegen, so daß,
wenn man den Besel dreht, sich diese Vorrichtung auf ihrer Stuͤze
vorwaͤrts und ruͤkwaͤrts bewegt. Der Umfang dieser Bewegung
wird durch die Laͤnge des Aufziehezahnstokes, b,
bestimmt. Dieß kann auch durch einen zweiten, bei i aus
dem Besel hervorstehenden. Arm geschehen, und durch die zwei Aufhaͤlter oder
Stifte, p, q, die in die Platte eingelassen sind. Wenn
der Aufziehezahnstok in der in der Zeichnung dargestellten Lage sich befindet, mit
seinem hinteren Ende gegen den Rahmen ruhend, wie bei s,
so bildet er ein vollkommenes Segment von dem Drehezapfen oder Stuͤzpunkte
bei g aus, und ist mittelst zweier Arme, uu, mit dem Rahmen verbunden. Ein Ende eines jeden
dieser Arme ist mit dem Zahnstoke, das andere mit dem Rahmen mittelst
Schraubendrehezapfen verbunden, auf welchen sie sich leicht drehen: die Arme stehen
in etwas schiefen Richtungen gegen die Stuͤze bei g.
Es ist nun offenbar, daß, wenn der Besel des Gehaͤuses von der Rechten zur
Linken bewegt wird, er den Aufziehezahnstok sammt seinem Rahmen in derselben
Richtung mit sich ziehen muß, und daß die Zahne des Zahnstokes, die in die
Zaͤhne des Sperrrades des Aufzieherades, c,
eingreifen (welches auf dem vierekigen Theile der Schneke befestigt ist), dieses
Sperrrad um so viele Zaͤhne herumfuͤhren werden, als Zaͤhne im
Zahnstoke in Thaͤtigkeit gesezt wurden; wenn aber der Rahmen wieder
zuruͤkgedreht wird, und die geneigte Seite der Zaͤhne des Zahnstokes
gegen die geneigte Seite der Zaͤhne des Sperrrades kommt, wird der Zahnstok
in die Hoͤhe getrieben, und wieder zuruͤklaufen, ohne has Sperrrad zu
treiben.
An dem Zahnstokrahmen ist eine feine Feder bei x
angeschraubt, dem Spize
gegen das Ende des einen der Arme druͤkt, der etwas uͤber, den
Schraubenzapfen hervorragt. Diese Feder soll den Zahnstok in seine Ruhe bei s zuruͤkfuͤhren, nachdem er uͤber
das Sperrrad hinausgezogen ist. Auf diese Weise kann durch eine abwechselnde
Bewegung des Besels hin und her, vorwaͤrts und ruͤkwaͤrts, die
Uhr aufgezogen werden, worauf der Besel zuruͤk bewegt werden muß, bis der Arm
i dicht an den Haͤlter p kommt, wo dann der Zahnstok von dem Sperrrade ganz frei werden und die
Uhr gehen lassen wird.
Um den Zahnstok desto leichter aus dem Sperrrade aufsteigen zu lassen, wenn der Besel
auf diese Weise zu seinem Haͤlter p
zuruͤkgefuͤhrt ist, bringe man einen Stift in das Ende des Zahnstokes
bei o, der in eine Segmentfurche in der Platte bei d hervorragt, welche Furche bedeutend breiter als der
Stift, und so lang ist, daß der Stift in dem Zahnstoke gegen das Ende etwas
fruͤher ansteht, als der Arm i des Besels den
Haͤlter p erreicht. Auf diese Weise wird der
Zahnstok aus den Zahnen des Sperrrades geworfen, und wird in dieselben einfallen,
wann die Uhr aufgezogen ist. Es muß aber auch hier ein Haͤmmerwerk von
derselben Art angebracht werden, wie das bei g in Fig. 4.
dargestellte, damit der Besel sich nicht bewegen kann, wenn die Uhr in der Tasche
getragen wird.
Ich wende auch folgende Methode zum Aufziehen einer Taschenuhr mit einer Schneke an,
die vielleicht noch einfacher ist, als irgend eine der vorhergehenden. Man wird sie
aus Fig. 32.
begreifen. aa ist der Aufzieher, der an dem Besel
befestigt ist, wie in Fig. 4. b ist das Aufzieherad, das an der Spindel der Schneke
befestigt ist. c ist ein Zwischenrad, welches sich um
einen Drehezapfen dreht, der in den Arm oder Hebel d
eingeschraubt ist, welcher seinen Stuͤzpunkt in e
hat, Das Ende dieses Armes kann etwas uͤber die Außenseite des
Gehaͤuses hervorstehen, oder mit einem Schieber an der Kante des
Gehaͤuses verbunden seyn, so daß, wenn man das Ende des Hebels oder Schiebers
bewegt, das Zahnrad mit dem Aufzieherade in oder außer Umtrieb gesezt werden kann:
nach der Lage des Stuͤzpunktes des Hebels wird es jedoch immer mit dem
Aufzieher, aa, in Wirkung bleiben. Nenn die Uhr
aufgezogen werden soll, wird das Rad c in Umtrieb mit
dem Aufzieherade b gebracht, und wenn dann der Besel
gedreht wird, wird die Uhr aufgezogen werden. Hierauf wird das Zwischenrad wieder
außer Umtrieb gebracht, indem man den Schieber in entgegengesezter Richtung
bewegt.
Man wird begreifen, daß die Besel dieser lezten zwei Aufzieher in die Furche oder in
das Bett auf dieselbe Weise eingeschraubt werden, wie es oben bereits beschrieben
wurde. Ich muß auch bemerken, daß ich die Gangraͤder in der Zeichnung Fig. 3, 4, 9. bloß
deßwegen auffuͤhrte, um die Lage der Raͤder zu zeigen, indem ich nicht
im Sinne habe, irgend eine Veraͤnderung weder in der Groͤße noch in
der Zahl der gewoͤhnlich gebrauchten Theile vorzunehmen.Dieser Saz fehlt gaͤnzlich im Handwerker S.
181., wo es dafuͤr heißt: „es versteht sich von selbst, daß
der obere Gehaͤusring bei diesen beiden zulezt beschriebenen
Aufziehewerken ebenfalls eine schwalbenschwanzfoͤrmige
ausgekehlte Leiste hat, in der die Spizen von Schrauben liegen, bei
welcher Einrichtung sich der Gehaͤusring, wie gesagt, drehen
laͤßt, waͤhrend er doch mit dem unteren Theile des
Gehaͤuses gehoͤrig verbunden ist.“
A. d. R.
Um jedoch die Taschenuhr mit einer gehenden Schneke (going
fusee) so flach zu machen, als moͤglich, nehme ich das
bestaͤndige Sperrrad und die Gehefeder (going
spring) zwischen dem großen Rade und dem Messing der Schneke (fusee brass) oder dem Spiralfederhause (spiral barrel), wo sie sonst immer hingesezt werden)
heraus, und bringe sie an die untere Seite des großen Rades. Der Plan, den ich
hierbei befolgte, ist folgender, und erhellt aus der Zeichnung. Fig. 10. ist die untere
Seite des großen Rades. ee ist die Vertiefung oder
die kreisfoͤrmige Hoͤhlung zur Aufnahme des bestaͤndigen
Sperrrades: sie ist tief genug, um zu verhindern, daß die Zaͤhne des
Sperrrades nicht uͤber die Oberflaͤche des Rades emporsteigen, wie man
aus dem Durchschnitte dieses Rades in Fig. 14. sieht. Das
Sperrrad dreht sich um eine Roͤhre, die, wie gewoͤhnlich, aus dem Rade
ausgedreht ist. Innerhalb dieser Vertiefung ist eine Furche b zur Aufnahme der Gehe- oder Hauptfeder, Fig. 11., deren eines
Ende mittelst eines Stiftes in dem großen Rade befestigt ist, und das andere in dem
bestaͤndigen Sperrrade. Fig. 12. ist das
bestaͤndige Sperrrad, (perpetual ratchet), mit
seinen Sperrkegeln und Federn, dessen Zaͤhne an der unteren Seite
emporsteigen, und nicht, wie gewoͤhnlich, an der Kante. Fig. 15. zeigt dasselbe
im Durchschnitte. Fig. 13. ist das Sperrrad der Schneke. Fig. 16. ein Durchschnitt
desselben.
Die Schneke ist auf folgende Weise zusammengesezt. Erstlich wird das große Rad auf
die Schneke gebracht; zunaͤchst kommt die bestaͤndige Feder in ihre
Furche b; hierauf wird das bestaͤndige Sperrrad
aufgesezt, und zulezt endlich das Sperrrad der Schneke, welches mittelst eines
Stiftes an der Spindel der Schneke befestigt ist, damit das bestaͤndige
Sperrrad nicht zu fest angehalten wird.
Die Weise, nach welcher der Federvorfall (spring detant)
auf die bestaͤndige Feder wirkt, (Fig. 17. zeigt den
Federvorfall von der Seite) ist durch Fig. 18. dargestellt, wo
man diejenige Seite der Platte sieht, die dem Zifferblatte zugekehrt ist. Die
Schneke sieht man durch die Vertiefung fuͤr das dritte Rad. a, ist das große Rad. b, das
bestaͤndige Sperrrad mit seinen Sperrkegeln und Federn. c, das Sperrrad der Spindel. Der Federvorfall ist in
eine Furche in der Platte bei d eingelassen, so daß der Haken der Feder leicht
auf den Zaͤhnen des bestaͤndigen Sperrrades aufliegt. Hieraus erhellt
offenbar, daß der Federvorfall das bestaͤndige Sperrrad in Einer Richtung
laufen lassen wird, nicht aber in der anderen, indem der Haken die Zahne fassen, und
so den Ruͤkgang des Rades hindern wird. Auf diese Weise gewinne ich so viel
Hoͤhe in der Schneke, als die Dike des bestaͤndigen Sperrrades
betraͤgt.Die beiden Saͤze: „indem der
Haken“ und „auf
diese Weise etc.“ sind im Handwerker weggelassen. Dafuͤr heißt es daselbst aber:
„Auf diese Weise kann ich, ohne die Uhr diker zu machen, die
Schneke um die Staͤrke des fortwaͤhrend wirkenden
Sperrrades erhoͤhen.“
A. d. R.
Ich will hier die Weise erklaͤren, nach welcher meine Uhren, die man ohne
Schluͤssel aufziehen kann, zusammengesezt und zerlegt werden: sie ist
folgende. Nachdem das Gehewerk der Uhr (the movements)
auf die gewoͤhnliche Weise zusammengesezt wurde, befestige ich dasselbe in
dem Gehaͤuse mittelst Schrauben oder auf eine andere Weise, worauf ich (wenn
die Uhr eine Schnekenuhr ist) die kleine Stahlplatte mit ihrem Cylinder anschraube,
durch welchen der vierekige Theil der Schnekenspindel kommt. Hierauf seze ich das
Aufzieherad auf den Cylinder, und befestige es an seiner Stelle mittelst seiner zwei
Zapfen; zunaͤchst befestige ich mittelst eines Stiftes das Aufziehesperrrad
an die Spindel der Schneke, und zulezt seze ich den Besel mit seinem Aufzieher auf,
der auf die oben beschriebene Weise gegen das Aufsteigen aus seiner Furche gesichert
ist. Endlich wird das Zifferblatt mit seinen Zeigern aufgesezt, und das Glas in den
Besel eingeschnappt.
Wenn die Uhr wieder in Stuͤke zerlegt werden soll, nehme ich zuerst das Glas
heraus, indem ich einen kleinen Drath durch ein Loch in die Hoͤhe schiebe,
das durch den Besel gegen die Kante des Glases gebohrt wurde, wie man bei o in Fig. 29. sieht. Hierdurch
wird das Glas herausgeworfen. Hierauf nehme ich die Zeiger, und dann das Zifferblatt
ab etc.
Damit das Gehaͤuse gleichfoͤrmig und nett ausfaͤllt, indem kein
Gefuͤge an dem schiebbaren Besel ist, beseitige ich das aͤußere
Gefuͤge des Bodens des' Gehaͤuses, indem ich eine Vorrichtung
anbringe, die ich Knoͤchelfeder (spring knuckle)
nennen will, die man von außen nicht sieht.
Diese Vorrichtung ist in Fig. 19. dargestellt. a, ist der Boden des Gehaͤuses, welcher die
Knoͤchelfeder enthaͤlt. bb, ist die
Feder, welche halbkreisfoͤrmig nach der Groͤße des Gehaͤuses
gemacht ist. Gegen die Enden hin ist sie etwas dik, wo sie an dem Boden des
Gehaͤuses entweder mittelst Schrauben, oder auf eine andere Weise befestigt
ist. Der andere Theil der Feder ist etwas duͤnn, bis er in die Naͤhe
des Knoͤchels
kommt, so daß er bei einem sehr kleinen Druke nachgibt. Der Knoͤchel steht
hoͤher als die Feder, und wird in solcher Hoͤhe verfertigt, wie es die
Dike des Gehaͤuses fordert: er ist aus dichtem Stahle, welcher Federharte
besizt. Fig.
20. zeigt die Knoͤchelfeder im Perspektive. c ist der Zapfen, der auf dem Boden des Gehaͤuses aufgeschraubt
ist, und etwas uͤber die Feder vorsteht: er soll verhuͤten, daß das
Gehaͤuse nicht zu weit geoͤffnet wird, und die Feder keine Gewalt
erleidet. Fig.
21. zeigt diesen Zapfen von der Seite. dd ist das Gefuͤge oder der Knoͤchel des
Gehaͤuses.
Meine Erfindung besteht ferner in einer neuen mechanischen Vorrichtung und Verbindung
von Werken, die sich uͤberall anwenden laͤßt, wo ein Weker gesperrt
oder losgelassen, oder auch ein Schlagwerk an einer Stokuhr, das ganze und
Viertelstunden schlaͤgt, gestellt werden soll.
Fig. 22.
stellt dasjenige vor, was man gewoͤhnlich das Zifferblatt oder Zeigerwerk
(dial-work) an einer Uhr nennt, an welcher
meine Erfindung angebracht ist. Zuerst das, was den Weker betrifft, a ist die Wekerschneke, deren hintere Spindel durch
beide Platten des Gehewerkes oder der Uhr durchlaͤuft. Die vordere Spindel
kommt durch den Mittelpunkt des Zifferblattes des Wekers, a, Fig.
29., und fuͤhrt den Wekerzeiger. An dem Ende der hinteren Spindel
ist ein geraͤndelter Kopf oder ein geraͤndeltes Niet, welches dicht an
die Platte kommt, und so die Schneke an dem Aufsteigen aus ihrer Stelle hindert,
zugleich aber auch zur Stellung des Wekerzeigers dient. Es ist offenbar, daß die
Zeiger des Wekers auf jeden beliebigen Theil des Zifferblattes desselben mittelst
des geraͤndelten Kopfes gestellt werden kann.Dieser Saz ist im Handwerker weggelassen.A. d. R. Dieser leztere ist, zugleich mit der Schneke, in Fig. 23. dargestellt.
Der Nuzen der Kerbe an der Kante der Schneke wird unten erklaͤrt werden: eine
Seite der Kerbe steht senkrecht auf den Mittelpunkt, die andere schief. b ist das Wekerrad, von derselben Groͤße und
Nummer, wie das Stundenrad h; die Zaͤhne des
Wekerrades greifen in die Zaͤhne des Stundenrades, und ersteres dreht sich
folglich in derselben Zeit herum, d.h., in zwoͤlf Stunden. Es ist hier als
durchbohrt dargestellt, um die Wirkung des Aushebehebels auf die Schneke des Wekers
zu zeigen. Es laͤuft auf der vorderen Spindel der Wekerschneke, und eine
kreisfoͤrmige Feder hindert dasselbe, sich zu leicht auf dieser Spindel zu
bewegen. Diese Feder druͤkt gegen die Spindel, wie man in dem abgenommenen
Wekerrade sieht: Fig. 24. cc ist der Aushebehebel,
dessen gekruͤmmte Spize auf der Kante der Wekerschneke ruht, und der Schweif
liegt dicht an dem Halse des Haͤngezapfens oder Griffes der Uhr. Eine Feder, d, welche gegen einen kleinen hervorstehenden Arm dieses
Hebels druͤkt, haͤlt denselben in seiner Lage.
Es ist nun offenbar, daß, da das Wekerrad ziemlich fest auf der Spindel der Schneke
aufsizt, es die Schneke mit sich umdrehen muß, so daß durch den Gang der Uhr die
Kerbe in der Kante der Wekerschneke zu dem gekruͤmmten Theile des
Aushebehebers alle zwoͤlf Stunden herumgefuͤhrt werden muß, und sobald
die senkrechte Seite der Kerbe vor der gekruͤmmten Spize des Aushebehebers
vorbei ist, wird sie mittelst der Feder, d, in die Kerbe
eingetrieben, und der Schweif des Hebels aus dem Halse des Gehaͤnges
herausgeworfen; die schiefe Seite der Kerbe wird aber den Hebel wieder in seine
vorige Stellung heben.
Die Vorrichtung, das Schlagwerk einer Uhr zu stellen, ist folgende. e in Fig. 22. ist ein
Triebstok von derselben Nummer, wie der gewoͤhnliche. Die Spindel desselben
laͤuft durch beide Platten und hat ein geraͤndeltes Haupt an seinem
Ende, gerade so, wie die Schneke des Wekers. Dieser Triebstok ist mit dem
Minutenrade, g, mittelst eines Zwischenrades, f, verbunden, welches irgend eine erforderliche Anzahl
von Zaͤhnen eingeschnitten haben kann, indem es bloß dazu bestimmt ist, die
Richtung des Triebstokes, e, zu andern. Hieraus erhellt
offenbar, daß der Triebstok, e, in derselben Zeit seine
Umdrehung vollendet, als der Roͤhrentriebstok (cannon
pinion), d.h. in Einer Stunde.
An dem Triebstoke, e, ist ein Arm mit einem Stifte in der
Naͤhe der Spize angebracht, der unter dem unteren Arme der Gloke eingreift,
h aushebt, und dieses so oft hebt,An arm with a pin near the point, that takes under
the lower arm of the clock, discharges h, and lifts it every time it
comes round. Dieß ist im Handwerker so
uͤbersezt: „ein Arm und in der
Naͤhe der Spize des lezteren ein Stift angebracht, welcher
den unteren Arm des Schlagwerkaushebers
h
greift, und diesen, so oft er herum koͤmmt,
in die Hoͤhe hebt.“
A. d. R. als er herum kommt (in der Zeichnung ist es zum Theile gehoben dargestellt).
Wenn aber der untere Arm des Glokenaushebers von dem Stifts in dem Atme des
Triebstokes e abfallt, wird der obere Arm des Aushebers
nach dem Halse des Gehaͤnges oder Griffes der Uhr mittelst einer Feder, k, zuruͤkgefuͤhrt die gegen einen kurzen
hervorstehenden Arm des Aushebers druͤkt.
Mittelst des geraͤndelten Hauptes an dem Ende der Spindel des Triebstokes, e, kann dem Roͤhrentriebstoke Bewegung
mitgetheilt, und auf diese Weise die Uhr auf die Zeit gestellt werden. Um aber jedem
Zufalle vorzubeugen, der durch eine Ruͤkbewegung des Minutenzeigers uͤber die Stunde
entstehen koͤnnte, mache ich den unteren Am des Glokenaushebers so, wie er in
Fig. 25.
dargestellt ist, d.h., auf dieselbe Weise, wie die Passirfeder eines Chronometers,
wodurch der Stift in dem Arme des Triebstokes e
zuruͤk kann, ohne daß der Ausheber bewegt wird.
Das Zifferblatt des Meters ist ein kleines Zifferblatt, von derselben Groͤße,
als jenes des Secundenkreises. Es ist mit dem Wekerrade mittelst einer kleinen
Roͤhre verbunden, welche aus dem Mittelpunkte des Wekerrades hervorsteht, und
in den Mittelpunkt des Zifferblattes fest paßt. Das Zifferblatt ist mit den Stunden
so) wie das Zifferblatt einer kleinen Taschenuhr, bemahlt (wie Fig. 29. zeigt), und in
dem Zifferblatte der Taschenuhr befindet sich eine kreisfoͤrmige Oeffnung,
durch welche man das Zifferblatt des Wekers sieht, wie a
in Fig.
29.Diese lezten beiden Saͤze: „durch
welche etc.“ sind im Handwerker weggeblieben.A. d. R.
Der Wekerzeiger muß in eine solche Lage gestellt werden, daß er genau auf den
Mittelpunkt des Gehaͤnges oder Uhrgriffes weiset, wann der Aushebehebel
faͤllt, oder aus dem Gehaͤnge herausgeworfen wird, und wenn XII auf
dem Zifferblatts des Wekers in dem Mittelpunkte des Gehaͤnges oder Uhrgriffes
steht, muß der Stunden- und Minuten-Zeiger so gestellt werden, daß er
in derselben Richtung weiset, d.h. XII Uhr.
Man wird nun sehen, daß, wenn der Minutenzeiger einen Umlauf vollendet hat, und
wieder auf das Gehaͤnge weiset, der Stundenzeiger auf I Uhr deuten wird, und dann wird I auf dem
Zifferblatte des Wekers nach dem Gehaͤnge zeigen, u.s.f. mit allen
uͤbrigen Stunden. Wenn man nun einen Punkt auf dem Zifferblatte der Uhr dem
Mittelpunkte des Gehaͤnges oder Uhrgriffes gegenuͤber bestimmt; so
wird er die Stunde des Tages auf dem Zifferblatte des Wekers andeuten; und da der
Zeiger des Wekers und das Zifferblatt desselben sich zugleich bewegen, und der
Aushebehebel jedes Mal ausgeworfen wird, wann der Zeiger des Wekers nach dem
Gehaͤnge oder Uhrgriffe zeigt, so ist offenbar, daß, der Zeiger des Wekers
mag auf was immer eine Stunde auf dem Zifferblatte des Wekers gestellt werden, der
Aushebehebel aus dem Gehaͤnge genau zu dieser Stunde ausgeworfen werden
wird.
Ich bringe auch einen kleinen Schieber an der Kante des Gehaͤuses an, auf
derselben Seite des Gehaͤnges, auf welcher der Aushebehebel sich befindet, so
daß, wenn kein Weker gebraucht wird, er dicht unter den Schweif des Hebels hinauf
geschoben werden, und den Druk der gekruͤmmten Spize der Kante der Wekerschneke
aufnehmen kann, so daß er im Gange der Uhr kein Hinderniß erzeugt.So that, when the alarum is not wanted, it may be
pushed up close to the tail of the lever, and take the pressure of the
curved point of the edge of the alarum snail, that it may be no
hinderante to the going of the watch. Dieß ist im Handwerker so uͤbersezt: „so
daß, wenn der Weker nicht gebraucht wird, man den Schieber dicht an den
Schwanz des Hebels druͤkt; daher der krumme Theil des Hebels von
dem Rande der Wekerschneke abgeruͤkt ist.
A. d. R.
Ich will nun die Art beschreiben, wie das Weker- und Gloken- oder
Schlagwerk mittelst des Aushebehebels und des Glokenaushebers auf einander wirken;
muß aber vorher bemerken, daß ich einen Durchschnitt oder eine Seitenansicht des
Gloken- und Wekerwerkes zusammen, aber abgenommen und mit der Zeigerplatte,
in Fig. 26.
gegeben habe. Der Rahmen, aa, welcher das
Raͤderwerk umfaßt, ist kleiner, als die Zeigerplatte, b, damit die Gloke, cc, die Werke
bedekt.That the bell,cc, may cover the
works; heißt im Handwerker:
„damit Plaz fuͤr die Gloke, cc, bleibt.“
A. d. R. Die Gloke ist auf einen Zapfen, d,
aufgeschraubt, welche in dem Mittelpunkte der oberen Platte befestigt ist. Durch die
Gloke fuͤhren, den Spindeln der Federhaͤuser gegenuͤber, zwei
Loͤcher, damit das Werk entweder mittelst eines besonderen
Schluͤssels, oder durch geraͤndelte aufgeschraubte Koͤpfe auf
den Spindeln, wie man dieselben in ee sieht, auf
gezogen werden kann.
Der Weker besteht aus einem sogenannten gehenden Federhause oder Cylinder (going barrel), mit einem staͤhlernen Rade an
einem Ende, das in Zahne eines Sperrrades ausgeschnitten ist um den Hammer zu
treiben: an dem anderen Ende ist das große Rad, welches das Raͤderwerk
treibt. Das Raͤderwerk besteht gewoͤhnlich aus drei Raͤdern und
vier Triebstoͤken; ich verfertige aber zuweilen das Wekerwerk mit einem
sogenannten Sorgenrade (contrite wheel) am Ende des
gehenden Federhauses, welches einen Triebstok mit einer Hemmung (balance) oder mit einem Kronenrade (crown wheel) treibt; wo dieß in Thaͤtigkeit
tritt, treibt eine Ruthe (verge) den Hammer, der auf der
Spindel der Ruthe befestigt ist.Dieser ganze Saz, von „ich
verfertige“ bis „befestigt ist,“ ist im Handwerker gleichfalls weggelassen.A. d. R.
Das Gloken- oder Schlag-Werk hat gleichfalls ein gehendes Federhaus mit
derselben Anzahl von Raͤdern und Triebstoͤken, nebst einem
Schlaghammer mit seiner Feder: alles ist hier so vorgerichtet, wie bei den meisten
modernen Schlagwerken. Die beiden Drathschweife, gg, welche durch die Zeigerplatte b
hervorstehen, sind, der eine mit dem Wekersperrer, der andere mit dem
Stundenregulir-Hebel verbunden, die man am deutlichsten in Fig. 27. sieht, wo a der Stundenregulirungs-Hebel ist, der auf einem Drehezapfen
wirkt, welcher in die Platte eingeschraubt ist. b ist
der Schweif des Drathes. x ist die Regulirfeder. Leztere
ist zunaͤchst an der Stelle, wo sie an dem Hebel aufgeschraubt ist, sehr
duͤnn, und an dem anderen Ende ist ein Haken, der in das Sternrad, e, eingreift, und dasselbe jedes Mal treibt, wo der
Hebel von dem Glokenwerk-Ausheber gehoben wird. Man sieht diese Feder von der
Seite in Fig.
28.
Aus der Gestalt dieses Hakens ist es klar, daß, wenn der Regulirhebel mittelst seiner
Feder, c, zuruͤkgefuͤhrt wird, nachdem die
Gloke geschlagen hat, der, schief niedersteigende Theil des Hakens, wenn er in
Beruͤhrung mit den Zahnen des Sternrades kommt, (welches gleichfalls auf der
Seite schief abgedacht ist), auf eine schiefe Flaͤche wirken, und die Feder
so heben wird, daß der Haken daruͤber weggehen wird ohne das Rad zu bewegen,
und bereit seyn wird, das Sternrad um eine andere Abtheilung herumzudrehen, sobald
der Hebel wieder gehoben wird. Der Huͤpfer, d,
mit seiner Feder sichert das Sternrad, daß es sich nie um mehr als eine Abtheilung
auf ein Mal bewegt.
Das Sternrad, e, ist in zwoͤlf Zaͤhne
ausgeschnitten, und auf einem hohlen Cylinder zugleich mit der Schneke der Gloke,
g, befestigt: beide stehen in geringer Entfernung
von einander. Es dreht sich um einen Drehezapfen, der in den Mittelpunkt der Platte
eingeschraubt ist. Der Cylinder ist von solcher Laͤnge, daß er etwas durch
die Zeigerplatte hervorsteht, und fuͤhrt den Zeiger, wie man bei a, Fig. 30. sieht.
Der Haken des Zahnstokes, h, hat einen gekruͤmmten
Schweif, der mit einem kurzen Arme des Regulirhebels in Beruͤhrung kommt,
wodurch, so oft der Hebel durch den Glokenausheber gehoben wird, der Haken aus dem
Zahustoke, i, gehoben wird, und der Zahnstok wieder
durch seine Feder, k, zuruͤkgetrieben wird. Der
Arm des Zahnstokes faͤllt gegen die Schneke und regulirt das Schlagen. n ist der Vorfallfluͤgel (gathering pallet), der den Zahnstok aufzieht, wie die Uhr
schlaͤgt.
Bei p ist ein Stift in dem Regulirhebel, der durch eine
Oeffnung in der Platte hervorragt, und mit einem Stifte in einem der Raͤder
in Beruͤhrung kommt, so oft der Hebel gehoben wird, wodurch die Gloke vor dem
Schlagen geschuͤzt wird, bis der Hebel zuruͤkfaͤllt. Der
Wekerhammer ist bei v dargestellt, und s ist seine Feder.
Wenn nun die Gloke Viertelstunden schlagen soll, so braucht man nichts mehr, als das
Sternrad in 48 Zaͤhne zu schneiden, und die Glokenschneke so zu verfertigen,
wie sie bei den meisten modernen Schlagwerken vorkommt, welche Viertelstunden
schlagen; ferner den Triebstok,
e, in der Taschenuhr, der in Fig. 22. dargestellt ist,
mit vier Armen, statt mit Einem, auszustatten, und die Uhr wird bei ihrem Gehen
Viertelstunden schlagen. Man kann sie auch ihre Kraft wiederholen, d.h., repetiren
machen, wenn man eine Verbindung von dem Zahnstokhaken zu einem Zapfen oder Knopfe
an irgend einem bequemen Theile des Untersazes, wie bei b, Fig.
29., anbringt, der mit dem Finger oder auf irgend eine Weise
niedergedruͤkt werden kann, und so den Zahnstokhaken aushebt.
Der Wekersperrer bekommt, wie man bei t, Fig. 27., in punktirten
Linien sieht, einen Elbogen; er ist auf einer Spindel befestigt, die mit einem
Drehezapfen versehen ist, und wirkt innerhalb der Platten des Gehewerkes: es wird
etwas von der Kaste der Platte weggefeilt, damit der Drachschweif, u, durch die Zeigerplatte durch kann. An dem anderen
Ende des Sperrers ist ein Stift, der gegen die Kante des Flugrades, o, ruht, das gleichfalls einen Stift in seiner Kante
fuͤhrt, und gleichfalls durch punktirte Linien dargestellt ist. Er wird in
dieser Lage mittelst einer feinen Feder, w, erhalten,
welche gegen den unteren Arm des Sperrers druͤkt, so daß der Weker nicht los
gehen kann, bis der Stift des Sperrers von der Kante des Rades entfernt wird,
welches jedes Mal geschieht, wann der Aushebehebel aus dem Gehaͤnge oder
Uhrgriffe ausfaͤllt, wo er in Beruͤhrung mit dem Drathschweife, u, des Wekersperrers kommt, und diesen aus dem Flugrade,
o, hebt.
Die Weise, wie die Taschenuhr mit dem Weker- und Schlags Werke verbunden wird,
ist folgende. Fig.
30. ist ein Untersaz aus Holz oder Metall. Das Wekerwerk und
Gloken- oder Schlag-Werk ist ruͤkwaͤrts in den Untersaz
ungefaͤhr bis in die Haͤlfte desselben mit der Zeigerplatte
eingelassen, um an der Vorderseite zu weisen, wie man in Fig. 30. sieht. a ist ein kleines Zifferblatt auf der Mitte der Platte,
auf welchem die Stunden gemahlen sind, wie man in der Figur sieht. Die Oeffnung an
der Vorderseite ist so groß, daß die Taschenuhr mit dem Gehaͤuse in dieselbe
paßt, wenn sie mit Leder oder Felbel ausgefuͤttert ist. Der Boden des
Gehaͤuses der Taschenuhr wird von der Zeigerplatte mittelst eines ledernen
Ringes, b, etwas entfernt gehalten, so daß er den Zeiger
nicht beruͤhrt.„So daß,“ etc. fehlt im Handwerker.A. d. R. Die beiden Drathschweife des Wekersperrers und des Regulirhebels ragen in
diese Oeffnung durch die Zeigerplatte uͤber XII hervor, und kommen etwas
uͤber das Gehaͤnge oder den Uhrgriff: sie stehen in solcher gleichen
Entfernung von einander, daß sie das Gehaͤnge oder den Griff zwischen sich
durchlassen. Es ist ferner eine Vertiefung fuͤr den Knopf des Gehaͤnges oder
Uhrgriffes ausgeschnitten, damit die Uhr immer in derselben Lage gehen muß.
Um nun die Taschenuhr so anzubringen, daß sie die Stunden richtig schlaͤgt,
muß der Zeiger in der Richtung 1, 2, 3 u.s.f. auf die Stunde gestellt werden, welche
die Uhr zulezt schlug. Es sey nun z.B. die Stunde auf der Uhr halb Ein Uhr; so steht
der Zeiger, so wie er in a, Fig. 30. dargestellt ist,
richtig. Wenn aber die Stunde auf der Uhr Drei Uhr
voruͤber ist, so muß der Zeiger auf III gestellt werden, und, wenn
die Uhr so angebracht ist, wie Fig. 29. zeigt, so wird
die Gloke die Stunden schlagen, wie die Uhr fortgeht.Der Saz: „Wenn aber“ bis
„fortgeht“ ist im
Handwerker weggelassen.A. d. R. Wenn der Weker gebraucht werden soll, so ist nichts anderes nothwendig, als
den Zeiger des Wekers auf die Stunde zu stellen, an welcher er nach dem Zifferblatte
des Wekers losgehen soll, den Weker in den Untersaz zu sezen, und denselben
aufzuziehen.
Die Punkte, auf welche ich mein ausschließliches Recht und Privilegium an den obigen
Erfindungen gruͤnde, sind; 1) die neuen Verbindungen des Mechanismus, durch
welche der Aufzieheapparat hervorgebracht wird. 2) die Schneke und das Rad des
Wekers mit dem Aushebehebel und mit seiner Feder. 3) der Mechanismus fuͤr das
Schlagwerk, wie er in Fig. 22. dargestellt ist,
in Verbindung mit dem Stundenregulirungs-Hebel, wie man bei a in Fig. 27. sieht. 4) der
Mechanismus, der mit der gehenden Schneke und mit dem Federausfall, d, Fig. 18., verbunden ist.
5) endlich die Weise, wie der Boden des Gehaͤuses mittelst einer
Knoͤchelfeder geoͤffnet wird, wodurch die Hervorragung außen an dem
Gehaͤuse uͤberfluͤssig wird.
Tafeln