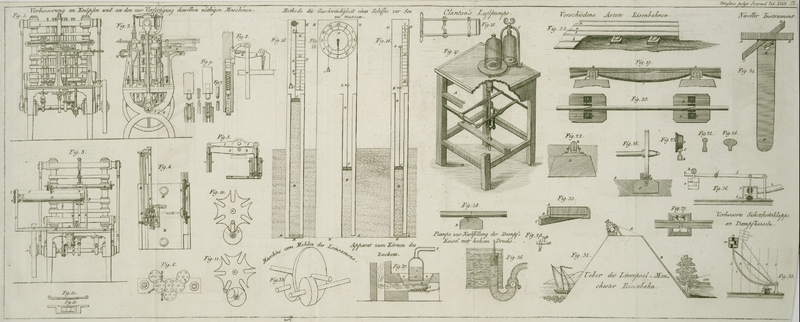| Titel: | Verbesserung an Knöpfen und an den zur Verfertigung derselben nothwendigen Maschinen, worauf Wilh. Church, Gentleman zu Birmingham in Warwickshire, sich am 26. März 1829 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 39, Jahrgang 1831, Nr. LXII., S. 174 |
| Download: | XML |
LXII.
Verbesserung an Knoͤpfen und an den zur
Verfertigung derselben nothwendigen Maschinen, worauf Wilh. Church, Gentleman zu Birmingham in
Warwickshire, sich am 26. Maͤrz 1829 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. N. 29. 1830. S.
239.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Church, Verbesserung an Knoͤpfen und an den zur Verfertigung
derselben nothwendigen Maschinen.
Diese Verbesserung bezieht sich auf eine fruͤhere Verbesserung in Verfertigung
der Knoͤpfe, welche der Patent-Traͤger Hrn. Th. Tyndall mittheilte (Vergl. London
Journ. of Arts III. Bd. S. 126. II. Series.
Polyt. Journ. Bd.
XXXIV. S. 8.), indem er damals außer Landes war. Bei der fruͤheren
Verbesserung handelte es sich um Verfertigung von Knoͤpfen einer ganz eigenen
Art, die den gewoͤhnlichen seidenen Knoͤpfen an
Maͤnnerroͤken aͤhnlich sind: hierzu bediente man sich einer
sich drehenden Achse, welche alle Theile des Mechanismus in Bewegung sezte, um die
Materialien zu sammeln, zu verbinden und so den Knopf zu vollenden.
So sinnreich auch dieser Apparat jedem Mechaniker erscheinen mußte, so besaß er doch
gewisse Theile, die so verwikelt waren, daß die Maschine nicht mit der
gehoͤrigen Leichtigkeit arbeiten konnte, ihre Arbeit weniger vollendet
lieferte, und leichter in Unordnung gerieth, als bei einer sicheren und
kraͤftigen Maschine nie der Fall seyn darf. Um diesen Nebeln abzuhelfen, um
die gelieferte Waare zu verbessern, den Mechanismus zu vereinfachen, wurden
gegenwaͤrtige Verbesserungen von dem Patent-Traͤger sehr sinnreich
angenommen. Der Bau der Maschine ist im Ganzen derselbe, wie an der vorigen, die
einzelnen Theile sind aber sehr verschieden.
„Meine Verbesserungen,“ sagt Church in
seiner Patent-Erklaͤrung, „an Knoͤpfen und
an den Maschinen und Apparaten zur Verfertigung derselben bestehen in gewissen
Abaͤnderungen und Zusaͤzen an einem Knopfmacherapparate, auf
welchen sich in Folge einer Mittheilung von mir, als ich im Auslande war, Thom.
Tyndall, Esqu. zu Birmingham, am 4. Dec. 1827 ein
Patent ertheilen ließ, auf welches ich mich hier beziehe. Meine
gegenwaͤrtigen Verbesserungen an der fruͤheren Maschine bestehen
in Folgendem: 1) in dem Mechanismus und in der Art, wie die sogenannten Muscheln
(shells) oder Grundlagen der Knoͤpfe
bereitet werden; 2) in einer neuen Art von Oehren an der Hinterseite der
Knoͤpfe, d.h., in einer neuen Maschinerie oder in einer neuen Vorrichtung
hierzu; 3) in der Einrichtung, wodurch der Florentiner Taffet oder der Zeug,
welcher die Oberflaͤche des Knopfes bedeken soll, in die Maschine
geleitet wird; 4) der Apparat, um die Kanten des Florentiner Taffetes
uͤber die Muschel des Knopfes zusammen zu sammeln, ehe das
Oehrstuͤk daran befestigt wird; 5) die Art, wie die Raͤder
getrieben werden, welche die verschiedenen Theile des Knopfes fuͤhren,
woraus der Knopf gebildet und zusammengesezt wird. Das Detail hiervon ist in den
beigefuͤgten Zeichnungen treulich und vollkommen dargestellt, und wird
aus folgender Beschreibung leicht begreiflich. Dieselben Buchstaben bezeichnen
dieselben Gegenstaͤnde.“
„Fig.
1. zeigt eine vollendete Maschine zum Knopfmachen mit den
gegenwaͤrtigen Verbesserungen von der Vorderseite; Fig. 2. zeigt sie von
der Endseite, und zwar links von Fig. 1. Die Kraft,
welche die Maschine treibt, muß an der horizontalen Achse, AA, angebracht werden, entweder mittelst der
Hand, oder der Laufscheibe und des Laufbandes von einer Dampfmaschine her oder
von irgend einer Triebkraft: ein Flugrad regulirt die Bewegung. Auf der
erwaͤhnten Achse ist ein abgestuzt kegelfoͤrmiges Rad, B, befestigt, das in ein aͤhnliches Rad, C, an dem unteren Ende der kurzen senkrechten Achse.
D, eingreift; an dem oberen Ende ist eine Kurbel
E. Von dieser Achse D aus entwikelt sich die Triebkraft, welche die Wagen oder Schlitten
in Thaͤtigkeit sezt, die die Materialien herbeifuͤhren aus welchen
der Knopf verfertigt wird.“
„Oben auf einem schiebbaren Pfeiler, F, sind
ein Paar Federklauen G aufgezogen, welche ein
duͤnnes Metallblatt halten, woraus die Muscheln oder Grundlagen der
Knoͤpfe mittelst der schneidenden Praͤgestaͤmpel auf die
unten anzufuͤhrende Weise verfertigt werden. Ein anderer schiebbarer
Pfeiler, H, fuͤhrt ein aͤhnliches
Klauenpaar I, das ein Metallblatt haͤlt,
woraus die uͤbrigen Scheiben geschnitten werden, welche die
Oehrstuͤke geben, d.h. den hinteren Theil des Knopfes mit seinem Oehre.
Auf der entgegengesezten Seite der Maschine, also auf der Hinterseite derselben,
die in Fig.
3. dargestellt ist, ist die Walze k
angebracht, welche den Florentiner Taffet fuͤhrt oder uͤberhaupt
den Stoff, der als Ueberzug fuͤr die Knoͤpfe dient. Diese Walze
haͤngt auf Zapfen, die in dem schiebbaren Rahmen, LL, gelagert sind.“
„Die Theile des Mechanismus, die auf der Tafel der Maschine liegen, sind
in der horizontalen Ansicht oder in dem Grundrisse, Fig. 4., dargestellt,
und erklaͤren die Bewegungen der verschiedenen Zahnstoͤke,
Triebstoͤke, Faͤnger, die mit dem oben erwaͤhnten
Speisungsapparate verbunden sind.“
„Die Umdrehung der Kurbel E macht, daß der
Hebel O (siehe Fig. 4.) sich
schwingt. Dadurch wird der Fang, P, hin und her
bewegt, und da dieser Fang bei jedem Schlage des Hebels in einen Zahnstok, Q, eingreift, welcher an dem schiebbaren Wagen oder
Gestelle, L, befestigt ist, so bewegt er diesen
Zahnstok, Q, und zugleich auch den schiebbaren
Wagen, L, um die Weite eines Zahnes. Das Schieben
dieses Wagens, Rahmens oder Gestelles macht, daß der daran befestigte Zahnstok
R einen Triebstok S
an dem hinteren Ende des Schaftes T treibt. Dieser
Schaft, oder diese Spindel T (die in Fig. 4. gebrochen
dargestellt ist) laͤuft quer uͤber die Tafel der Maschine, und hat
zwei andere Triebstoͤke an ihren gegenuͤberstehenden Enden, wovon
jeder einzeln in die Zahnstoͤke V und U eingreift, die an jene schiebbaren Platten
befestigt sind, auf welchen die Pfeiler F und mit
den Speisungsapparaten angebracht sind.“
„Es wird auf diese Weise klar, daß die Umdrehung der Kurbel E, mittelst der Dazwischenkunft des Hebels O und des Sperrkegels P
die schiebbare Stange L zum Eintreiben des Cylinders
bewegt, und diese schiebbare Stange treibt durch ihren Zahnstok R den Triebstok und die Achse S, T, welche mittelst der Triebstoͤke und Zahnstoͤke VU den Speisungsapparat treibt, um die beiden
Metallblaͤtter herbeizuschaffen, aus welchen die Muscheln und die
Oehrstuͤke der Knoͤpfe verfertigt werden.“
„Man seze nun, daß das Metallblatt, aus welchem die Muscheln gebildet
werden sollen, in den Klauen G gehalten wird, und
durch den Ausschnitt der Punzenbuͤchse W
durch ist, in welcher die Scheibe zum Knopfe ausgeschnitten wird. Auf eine
aͤhnliche Weise wird das andere Metallblatt zur Bildung des Oehres in den
Klauen I gehalten, und durch den Ausschnitt in
der Punzenbuͤchse x zu demselben Ende
durchgelassen.
„Der Bau der Messer zum Ausschlagen der Scheiben fuͤr die Muscheln
und fuͤr die Oehrstuͤke ist sehr aͤhnlich, und sie sind nur
in der Groͤße etwas verschieden, wie man in der einzelnen Figur 5 sieht. a ist ein Stift, der durch den Hebel b und durch den Pfeiler c laͤuft, welcher, wie man in Fig. 2. sieht, auf der
Platte d befestigt ist.“
„An einem Ende des Hebels b ist die Stange e befestigt, welche sich nach abwaͤrts
erstrekt, und unten mit dem Klopfhebel, f, verbunden
ist, der an dem Buͤgel g haͤngt.
Dieser Hebel, f, wird von einem excentrischen Rade
an der Hauptachse, A, getrieben; so wie also das
excentrische Rad, h, herumlaͤuft, wird der
Klopfheber f gehoben, welcher die Stange, e, und den Schweif des Hebels, b, hebt, wodurch der Punzen an dem entgegengesezten
Ende des Hebels niedergedruͤkt, und so die Scheibe aus dem Metallblatte
ausgeschnitten wird.“
„Die besondere Einrichtung dieses Punzens ist in der Durchschnittsfigur 5
angegeben. W ist die oben erwaͤhnte
Punzenbuͤchse, in welcher sich ein Einschnitt befindet, durch den man das
Blatt Metall nach der Kante einschieben kann. Der schneidende Punzen, i, ist eine cylindrische Roͤhre aus Stahl,
welche, nachdem sie auf die oben angegebene Weise durch Einwirkung des Hebels,
b, hinabgedruͤkt wurde, gegen das untere
Messer, j, eine Scheibe aus dem Metallblatte
ausschlaͤgt, welche durch das Messer in die Vertiefung von j hinabgetrieben wird. Es ist dort ein
Staͤmpel k, der innerhalb der schneidenden
Roͤhre i wirkt, welche mit einem Hebel l verbunden ist, der auf einer Achse in dem Pfeiler
c aufgezogen ist. Das entgegengesezte Ende
dieses Hebels l ist an einer Stange, m, befestigt, welche mit der Stange e zu dem excentrischen Rade h hinabsteigt, wo ein aͤhnlicher Klopfhebel, wie f, welcher innenwendig arbeitet, von dem
excentrischen Muschelrade unmittelbar in Thaͤtigkeit gesezt wird, sobald
die Scheibe ausgeschnitten wurde, und so den Punzen noͤthigt, die Scheibe
durch die Vertiefung k zu treiben oder den Zugblok
(drawing block) j,
und die Kanten nach aufwaͤrts zu drehen (was man technisch durchziehen (drawing
through) nennt, wodurch dann die auf diese Weise gebildete Muschel in
einer der Vertiefungen des Fuͤhrungsrades (Carrying wheel) n, abgesezt
wird.“
„Die Scheiben fuͤr die Oehrstuͤke, welche nicht gar so groß
sind, wie jene fuͤr die Muscheln, werden auf eine aͤhnliche Weise,
wie diese lezteren, geschnitten und gezogen. Die Punzenbuͤchse zum
Schneiden der Oehrstuͤke ist in Fig. 1 und 2. in o dargestellt, und p ist
die hohle Stange, die das Messer und den in derselben enthaltenen
Staͤmpel enthaͤlt, welche von den Klopfhebeln, q, in Thaͤtigkeit gesezt werden, die von einem
correspondirenden Muschelrade auf der Hauptachse in Thaͤtigkeit gesezt
werden. Auch diese Scheiben werden in einem der Fuͤhrungsraͤder,
r, abgelegt, und sind so bereit durch die
Maschine umhergefuͤhrt zu werden, um die in der fruͤheren
Patent-Erklaͤrung beschriebenen noͤthigen Manipulationen
mit den Knoͤpfen vorzunehmen.
„Fig.
6. stellt das System von Laufraͤdern dar, horizontal und
abgenommen von den uͤbrigen Theilen der Maschine. Es sind deren um zwei
mehr, als im fruͤheren Patente, n und r: sie dienen, wie man oben bemerkte, zur Aufnahme
und Herumfuͤhrung der Muschel- und Oehrstuͤke. Diese
Fuͤhrungsraͤder sind auf einer senkrechten Achse aufgezogen, und
werden von einem darunter befindlichen Zahnraͤdergetriebe in
Thaͤtigkeit gesezt.“
„Nach meiner gegenwaͤrtigen Methode das Oehr des Knopfes zu bilden,
wird das Oehrstuͤk von den Fuͤhrungsraͤdern zu den
verschiedenen Punzen gefuͤhrt, wie in der fruͤheren
Patent-Erklaͤrung. Wenn man nun annimmt, daß das Oehrstuͤk
in dem Fuͤhrungsrade r im Loche N. 1. abgesezt wurde, so wird es nach 3 Bewegungen
in der Maschine in der Lage von N. 4. kommen,
unmittelbar unter ein Loch in dem Rade s: zu dieser
Zeit kommt aber das erste Paar von Praͤgestaͤmpeln in
Thaͤtigkeit, um ein Kreuz durchzustechen und herzustellen, welches das
Oehr bildet. Diese Praͤgestaͤmpel sind in verschiedenen Figuren
dargestellt, zum Theile im Durchschnitte (in der Platte im Viertel ihrer
Groͤße.)“
„Fig.
6. zeigt das erste Paar Praͤgestaͤmpel, wodurch das
Stuͤk Metall in der Form eines Kreuzes durchbohrt und kugelfoͤrmig
erhoben wird. Nachdem das Oehrstuͤk bis zum naͤchsten Standpunkte,
N. 5., gekommen ist, wird eine kleine Zange
angebracht, um die Kanten an einem der Zaͤngelchen des Kreuzes oder des
Oehres abzurunden. Diese Zaͤngelchen sind mit einem der niedersteigenden
Punzen verbunden, und in Fig. 7. einzeln
abgenommen dargestellt. Die Zangen, aa, sind
zwischen dem hohlen Punzen fest gehalten; ihre Faͤnge werden von einer
Feder so lang offen gehalten, bis sie das Kreuz, b,
umfaßt haben; ein keilartiges Stuͤk uͤber denselben wirkt auf die
Schweife der Zangen, noͤthigt sie sich zu schließen, und das
Zaͤngelchen des Oehres in eine rundliche drathartige Form zu
druͤken. Das keilaͤhnliche Stuͤk wird durch gegliederte
Heber, cd, wie man in Fig. 8. sieht,
niedergedruͤkt, und mit der senkrechten Stange w, verbunden, wie man in Fig. 3. sieht: auf
diese Stange wirkt das sich drehende excentrische Muschelrad, x, auf der Hauptachse. Die naͤchste Bewegung
der Maschine bringt das Oehrstuͤk in die Lage N. 6., wo eine aͤhnliche kleine Zange die von denselben Hebeln
und Stangen getrieben wird, die andere Stange des Queroͤhres kneipt, und dem Oehre im Loche
N. 7. die Vollendung gibt. Die
Praͤgestaͤmpel, Fig. 8., werden hier
auf dieselbe Weise, wie oben angegeben wurde, in Thaͤtigkeit
gesezt.“
„Die Weise, wie ich die Punzen in dieser Maschine arbeiten lasse, ist
derjenigen sehr aͤhnlich, die in der vorigen
Patent-Erklaͤrung gegeben wurde, d.h., die obere Reihe der Punzen
ist an dem oberen beweglichen Bloke yy
befestigt, und die untere Reihe derselben an dem unteren beweglichen Bloke, zz, welche beide mittelst der Seitenstangen,
die mit den Kurbeln auf der Hauptachse, AA,
verbunden sind, auf und nieder gelassen werden. In Folge dieser Bewegungen
werden die correspondirenden Punzen und Praͤgestaͤmpel, die sich
durch die Leitungsplatten durchschieben, an einander gebracht und der
gehoͤrige Druk bei der Zusammensezung der verschiedenen Theile des
Knopfes und bei der Vollendung desselben gegeben.“
„Die Scheiben von Florentiner-Taffet oder von anderen Stoffen,
welche die Oberflaͤche der Knoͤpfe uͤberziehen, werden aus
dem Stuͤke zugleich mit den metallischen Scheiben ausgeschlagen, jedoch
an der entgegengesezten oder an der hinteren Seite der Maschine. Der
Florentiner-Taffet ist, wie oben bemerkt wurde, auf der Walze k aufgerollt, und wird zwischen die Ziehewalzen in
den Ausschnitt der Punzenbuͤchse x
gefuͤhrt, wo das Messer, welches so gebaut ist, wie es im vorigen Patente
beschrieben wurde, herabgelassen wird, und die Florentiner-Scheiben
mittelst der Hebel und Stangen zzzz
ausschneidet: an dem unteren Ende befindet sich ein Klopfhebel, auf welchen ein
excentrisches Muschelrad im Mittelpunkte der Hauptachse wirkt.“
„Es ist nun noͤthig auf einen fruͤheren Theil dieser
Patent-Erklaͤrung zuruͤkzuweisen, in welchem die
Seitenbewegungen der Pfeiler des Speisungsapparates, F,
H, und LL so dargestellt sind, als
wuͤrden sie durch die Umdrehung der Triebstoͤke bewegt, die
einzeln in die Zahnstoͤke V, U, und R eingreifen; man wird hieraus einsehen, daß die
Metallblatter, welche die Muscheln und Oehrstuͤke der Knoͤpfe
bilden, so wie auch der Florentiner-Taffet selbst, der sie bedekt, auf
diese Weise nach und nach durch ihre einzelnen Punzen-Buͤchsen
durchgeschoben, und die Scheiben aus denselben auf die oben beschriebene Weise
ausgeschnitten werden.“
„Man seze nun es sey eine Reihe solcher Scheiben von dem Ende eines jeden
Metallblattes und von dem Stuͤke Florentiner-Taffet in gerader
Linie ausgeschnitten, so wird es nothwendig die Blaͤtter und den
Florentiner-Taffet vorwaͤrts und dann wieder
ruͤkwaͤrts zu bringen, um nach der Seite eine andere Reihe von
Scheiben aus jedem derselben schneiden zu koͤnnen: die Vorrichtung hierzu
ist in Fig.
3 und 4. dargestellt.“
„Wenn der Zahnstok Q dem Ende seines Laufes zu
nahe gekommen ist, so ruͤkt ein am Zahnstoke befestigter Klopfer gegen
eine schiefe Flaͤche an der Seite des Stuͤkes f, und stoͤßt ihn in die durch punktirte
Linien angedeutete Lage. Der Zwek dieser Bewegung ist, daß bei der
naͤchsten Umdrehung der Kurbel E das Ende des
Hebels O* bei g gegen
das Ende des Stuͤkes f schlagen kann, und
dieses dadurch veranlaßt, den dreiarmigen Hebel, h,
in die durch Punkte angezeigte Lage zu bringen. Diese Bewegung des Hebels, h, laͤßt den Federspenkegel, i, in die Zaͤhne des Zahnstokes, Q, fallen, und zieht zugleich den Sperrkegel P aus dem Zahnstoke zuruͤk. Die Umdrehung der
Kurbel, E, wodurch die Hebel in Thaͤtigkeit
gebracht werden, macht nun den Zahnstok Q, und
zugleich den Schlitten mit dem Florentiner-Taffet wieder
zuruͤklaufen; gleichzeitig aber mit dieser lezten Arbeit schlaͤgt
der Klopfer, C, gegen eine schiefe Flaͤche
auf der Fangstange k, und druͤkt sie
zuruͤk, wie die Punkte zeigen, so daß, wie der Hebel o sich schwingt, ein Stift an dem Ende desselben den
Haken von k faͤngt, und die Fangstange der
Laͤnge nach hinzieht, welche den Hebel und den Spenkegel bewegt (l), und so das Sperrrad m um einen Zahn vorwaͤrts treibt.“
„An dem oberen Ende der senkrechten Achsen n,
woran das Sperrrad m befestigt ist, befindet sich
ein breites Rad, das in ein aͤhnliches Rad o
an der horizontalen Achse, p, eingreift, welche
laͤngs dem Ruͤken des Florentiner-Wagens herlaͤuft.
Dieses Rad, o, ist von einem Knechte bewacht, und
laͤßt die Achse p von einem Ende desselben zu
dem anderen sich schieben, indem es mittelst eines Federschluͤssels
angeschlossen ist.“
„Die gelegentlichen Bewegungen der Achsen n
und p werden mittelst eines Getriebes von
Zahnraͤdern, q, den Speisungswalzen r (siehe Fig. 3.) mitgetheilt,
wodurch die Kante des Florentiner-Taffetes nach dem Abschneiden einer
jeden Reihe vorgeschoben wird.“
„Um die Metallblaͤtter vorwaͤrts zu schieben oder
aufzustellen, nachdem jede Reihe von Scheiben fuͤr die Muscheln und
Oehrstuͤke weggeschnitten wurde, kommt ein Zahnrad, s, in die Mitte der obenen Speisungswalze, welches
in ein Zahnrad eingreift, das sich auf der Achse, t,
schiebt. Diese Achse wird daher gleichzeitig mit jenen getrieben, die den
Florentiner-Taffet herbeifuͤhren, und da zwei Triebstoͤke
von verschiedenem Durchmesser auf dieser Achse befestigt sind, die in die
Zahnstoͤke vv und uu eingreifen, welche Zahnstoͤke mit
dem Speisungsapparate verbunden sind, indem sie den Schlitten oder Wagen der Klauen G und I angemacht sind,
so werden noͤthigen Falles die Metallblaͤtter
eingezogen.“
„Das ganze Zahnradgetriebe, welches die Wagen (carriers) treibt, wird von einem Kurbelrade, W, auf der Achse D getrieben (siehe Fig. 1.).
Dieses Rad greift in ein besonders geformtes Sternrad ein, X, welches man in zwei Lagen und in einem
groͤßeren Maßstabe in Fig. 8 und 9.
sieht.“
„Bei einem Ruͤkblike auf die fruͤhere
Patent-Erklaͤrung ist die Weise, wie die Kanten des
Florentiner-Taffetes eingesammelt werden, leicht erklaͤrlich. Ich
vollende diese Arbeit nach der in Fig. 10 und 11.
dargestellten Weise. Der Apparat besteht aus zwei sehr duͤnnen
Stahlplatten, die sich uͤber einander schieben. Sie sind in messingenen
Rahmen aufgezogen, und zwischen die zwei Central-Carrierraͤder
gestellt, wie man in yy, Fig. 5. sieht.Daß die Figuren im Originale sehr oft falsch citirt sind, ist nicht die Schuld des Uebersezers. A. d.
Ue. In jeder Platte befindet sich ein Loch von besonderer Form: die Enden
eines jeden Loches sind kreisfoͤrmig, aber von verschiedenem Durchmesser,
so daß, wenn die Platten in Einer Richtung gehoben werden, eine
kreisfoͤrmige Oeffnung von ungefaͤhr Einem Zolle gebildet wird,
und wenn sie in der entgegengesezten Richtung geschoben werden, die Oeffnung
verkleinert wird. Diese Bewegung geschieht mittelst der Kurbelhebel, zz, auf welche ein excentrisches Muschelrad
auf der Hauptachse wirkt. Ehe diese Sammler in Thaͤtigkeit kommen, wird
die Muschel des Knopfes, und mit dieser zugleich der Florentiner-Taffet
unter ihr, wie in der fruͤheren Patent-Erklaͤrung
erklaͤrt wurde, in eines der Loͤcher des unteren Carrierrades
gefuͤhrt, wodurch die Kanten der Florentiner-Scheibe rings um den
Rand der Muschel in die Hoͤhe gehoben und dadurch in dem Rade
eingeschlossen werden. Nun kommen die Knoͤpfe unter die Oeffnung der
Sammler, wo sie, mittelst der naͤchstfolgenden Operation des unteren
Punzens heraufgehoben und die Kanten des Florentiner-Taffetes durch die
Sammler gefuͤhrt werden, welche man dann so zieht, daß das Loch sich
verkleinert und die Kanten der Florentiner-Taffetscheibe nur einen sehr
kleinen Umfang bilden. In diesem Augenblike steigt der Punzen mit dem
Oehrstuͤke herab auf die Sammler, und da sich die Oeffnung dieser
lezteren jezt erweitert, so kann das Oehr in die hohle Muschel gedrukt werden
und wird die Kanten des Taffetes mit sich fuͤhren, der durch diese
leztere Operation des Punzens fest und gesund auf der Muschel befestigt
wird.“
Tafeln