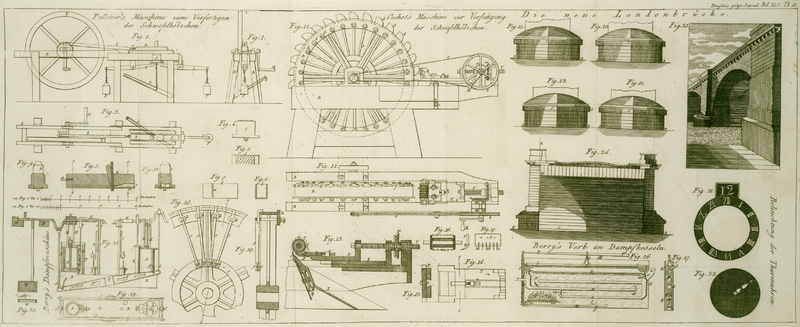| Titel: | Bericht des Hrn. Th. Olivier über die verschiedenen Maschinen zur Verfertigung von Schwefelhölzchen, welche der Société d'encouragement vorgestellt wurden. |
| Fundstelle: | Band 45, Jahrgang 1832, Nr. LII., S. 209 |
| Download: | XML |
LII.
Bericht des Hrn. Th. Olivier uͤber die verschiedenen Maschinen
zur Verfertigung von Schwefelhoͤlzchen, welche der Société
d'encouragement vorgestellt wurden.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement. Januar 1832, S. 11.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Olivier, Bericht uͤber die verschiedenen Maschinen zur
Verfertigung von Schwefelhoͤlzchen.
Hr. Chevolot Sohn, Tischler zu Is-sur-Tille
im Département de la Côte d'or, sandte der
Gesellschaft ein sehr huͤbsch verfertigtes Modell einer angeblich von ihm
erfundenen Maschine zur Verfertigung der Schwefelhoͤlzchen. Die Commission,
welche der Gesellschaft einen Bericht uͤber diese Maschine zu erstatten
beauftragt war, uͤberzeugte sich jedoch, daß dieselbe nicht neu, sondern ganz
identisch mit der Maschine des Hrn. Pelletier ist, welche
zwar nirgends abgebildet, aber doch im ersten Bande des Dictionnaire technologique ausfuͤhrlich beschrieben ist. Die
Commission hatte zwar hiemit allein schon ihre Aufgabe geloͤst, sie glaubt
aber nichts Unzwekmaͤßiges zu thun, wenn sie hier noch eine Vergleichung der
Pelletier'schen Maschine mit einer anderen, von ihr
ganz verschiedenen Maschine, welche Hr. Cochot im
Faubourg St. Antoine erbaute und den Mitgliedern der Commission zu zeigen die
Gefaͤlligkeit hatte, mittheilt.
Beschreibung der Pelletier'schen Maschine zur Verfertigung der
Schwefelhoͤlzchen.
Diese Maschine besteht aus einer Tischlerbank B
Fig. 1, auf
der sich zwischen zwei Falzen und durch eine Hin- und Herbewegung der Hobel R schiebt, welcher ein horizontales n und 24 senkrechte Hobeleisen traͤgt. Das
Stuͤk Holz wird durch ein vierekiges, in der Bank angebrachtes Loch
emporgehoben, und zwar mittelst zweier Hebel 11', an deren Enden sich ein Gewicht
von 60–70 Pfunden befindet. Die Hin- und Herbewegung wird dem Hobel
durch das Kurbelstuͤk b, welches mit dem einen
Ende an dem Kopfe des Hobels, und mit dem anderen an der geknieten Kurbel c befestigt ist, mitgetheilt. Auf diese Kurbel
laͤßt man die Triebkraft wirken.
Wenn der Hobel nach Vorwaͤrts geht, so spalten die 24 senkrechten Hobeleisen
zuerst das Stuͤk Holz der Laͤnge nach in Stuͤke von der Dike
der Schwefelhoͤlzchen; nachdem er um 3 bis 4 Millimeter vorwaͤrts
gegangen, tritt das horizontale Hobeleisen in Thaͤtigkeit, und loͤst
die 24 ausgeschnittenen Hoͤlzchen los, die sich dann in das Innere des Hobels
legen. Durch die ruͤkgaͤngige Bewegung, welche der Hobel hierauf
erhaͤlt, werden die Hoͤlzchen aus dem Hobel ausgestoßen, und gelangen
dann in eine kleine Buͤchse, welche sich unter dem aͤußersten Ende des
Laufes des Hobels befindet. Ein Flugrad, welches an der Welle der geknieten Kurbel
angebracht ist, erleichtert und regulirt die Bewegung.
Fig. 1 ist ein
Seitenaufriß der Maschine.
Fig. 2 zeigt
die Maschine von Vorne.
Fig. 3 ist ein
Grundriß derselben.
An allen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche Gegenstaͤnde.
B ist die Hobelbank.
M die in c gekniete Kurbel,
an der das Zwischenstuͤk b, welches mit dem einen
Ende in den Hobel R eingehakt ist, befestigt ist.
d ist die Buͤchse, in die die fertigen
Hoͤlzer gelangen.
V das Flugrad.
PP' sind Gewichte, die an den Hebeln ll' angehaͤngt sind; diese Hebel heben den
Traͤger S empor, auf welchem das Holz, das
zerschnitten werden soll, befestigt ist.
Fig. 4 und
5 zeigen
diesen Traͤger in vergroͤßertem Maßstabe, und zwar Fig. 4 im Aufrisse und
Fig. 5 im
Grundrisse. Dieser Traͤger ist an seiner oberen Flaͤche mit kleinen
eisernen Spizen versehen, durch welche das Holz an seiner Stelle erhalten wird; an
seinem unteren Ende hingegen befindet sich ein Ring, durch den ein Strik gezogen
wird, mittelst welchem man den Traͤger herabziehen kann, wenn man ein neues
Stuͤk Holz einsezen will. Dieser Strik befindet sich an einem Hebel, den man
mit dem Fuße bewegt.
Fig. 6 ist ein
Querdurchschnitt der Buͤchse fuͤr die Hoͤlzchen. Fig. 7 zeigt
dieselbe im Seitenaufrisse. n ist eine Spalte, welche in
den beiden Seitenwaͤnden angebracht ist, und in welche man einen Bindfaden legt, mit dem man die
Hoͤlzchen, wenn die Buͤchse angefuͤllt ist, zusammenbinden
kann.
Fig. 8 ist ein
Laͤngendurchschnitt des Hobels; Fig. 9 ist ein
Querdurchschnitt desselben nach der Linie x'y'; Fig. 10 endlich ist ein
Querdurchschnitt nach xy.
a ist ein Ringnagel, in den das Ende des
Kurbelstuͤkes b eingehakt wird.
m ist das senkrechte Hobeleisen, durch welches das Holz
gespalten wird: dieses Eisen hat 24 duͤnne, flache, und so weit von einander
entfernte Zaͤhne, als man die Hoͤlzchen dik machen will.
n ist das horizontale Hobeleisen, durch welches das Holz
in duͤnne Platten geschnitten wird.
g ist die Oeffnung, durch welche die Hoͤlzchen in
die Buͤchse gelangen. Die Maschine wird auf folgende Weise gehandhabt:
Man hakt das Kurbelstuͤk aus, schiebt den Hobel zwischen den beiden Falzen
vorwaͤrts, sezt den Fuß auf den Hebel L und
bringt dadurch den Traͤger herab; dann bringt man das Stuͤk Holz,
welches zerschnitten werden soll, in das vierekige Loch, in welchem sich der
Traͤger bewegt, schiebt den Hobel wieder zuruͤk, und hakt das
Kurbelstuͤk ein, worauf die Maschine zur Arbeit fertig ist.
Beschreibung der Cochot'schen Maschine.
Man denke sich ein Rad, dessen Felge aus dem Holze bestehe, welches zu
Schwefelhoͤlzchen zerschnitten werden soll; ferner einen Cylinder von
geringem Durchmesser, der an seinem Umfange mit duͤnnen, gut schneidenden,
staͤhlernen und so weit von einander entfernten Klingen versehen ist, als die
Hoͤlzchen breit werden sollen; und endlich ein Eisen von der Breite der
Felge, welches die Stelle eines Hobels vertritt, und senkrecht und tangental gegen
den kleinen Cylinder gestellt ist. Man denke sich, daß der Cylinder und das
senkrechte Hobeleisen von demselben Wagen, der mittelst einer Schraube an die Felge
angedruͤkt wird, getragen wird, und zwar das senkrechte Hobeleisen in
unveraͤnderlicher Stellung, der Cylinder hingegen auf seinen Zapfen
beweglich. Man denke sich ferner die Achse des Rades und des kleinen Cylinders in
einer horizontalen Flaͤche.
Wenn man nun den Cylinder mittelst einer Schraube gegen die Felge druͤkt, so
dringen die Klingen auf eine gewisse Tiefe in die Felge; und wenn dann das Rad in
Bewegung gesezt wird, so wird der Hobel die Felge in duͤnne Baͤnder
von der Dike der Hoͤlzchen schneiden, waͤhrend der Cylinder, der sich
frei um seine Achse dreht, dieses Band mittelst seiner Klingen in kleine
Hoͤlzchen von der Breite der Schwefelhoͤlzchen schneidet.
Wenn das Rad seine Umdrehung vollendet hat, so senkt man die Schneideklingen
neuerdings mittelst einer Drukschraube in die Felge ein, so daß man auf diese Weise
mit groͤßter Leichtigkeit und Regelmaͤßigkeit die ganze Felge in
Hoͤlzchen zerschneiden kann. Ist dieß geschehen, so wird die Felge durch eine
neue ersezt. Damit dieß nun schnell geschehen kann, damit der Arbeiter die Bewegung
nicht bei jeder Umdrehung des Rades, um den Wagen um die noͤthige Entfernung
vorwaͤrts zu schieben, unterbrechen darf; und damit das Holz immer in der
Richtung seiner Fasern dem Hobel dargeboten wird, hat Hr. Cochot seine Maschine auf folgende Weise eingerichtet.
Das Rad R
Fig. 11 von 1
Meter im Halbmesser, besteht aus einem flachen eisernen Reifen, dessen Breite der
Laͤnge der Schwefelhoͤlzchen gleichkommt. Dieser Reifen, der den
Reifen der gewoͤhnlichen Raͤder aͤhnlich ist, ist an 6
gußeisernen Radien oder Speichen befestigt. An dem Umfange dieses Reifens befestigt
man mittelst Zwingen 30 Stuͤk Holz, welche jenen Hoͤlzern
aͤhnlich sind, die die Arbeiter gewoͤhnlich zum Schneiden der
Schwefelhoͤlzchen mit dem Schnizmesser nehmen. Die Fasern des Holzes
muͤssen nach der Breite des kreisfoͤrmigen Reifens laufen.
Die Triebkraft laͤßt Hr. Cochot nicht unmittelbar
auf dieses Rad, welches die Hoͤlzer mit sich fuͤhrt, wirken, sondern
auf eine horizontale, an der Seite des Wagens befindliche Welle; die drehende
Bewegung theilt er dem Rade mittelst einer Kette à la
Vaucanson mit. Mittelst einer Winkelverzahnung erhaͤlt die
Drukschraube ihre fortwaͤhrende Bewegung.
Die Drukschraube bewirkt, daß der Wagen nach jeder Umdrehung des Rades um die Dike
eines Schwefelhoͤlzchens vorwaͤrts schreite. Man braucht daher die
Bewegung der Maschine nur dann zu unterbrechen, wenn alles Holz verbraucht ist, und
man das Rad neuerdings wieder beladen will.
Aus dieser gedraͤngten Beschreibung allein ergibt sich schon, daß die Maschine
des Hm. Cochot in einer und derselben Zeit wenigstens
eben so viel Arbeit liefert, als 30 Handarbeiter. Wir wollen jedoch die Arbeit der
Maschine noch weiter mit jener Arbeit vergleichen, die in einer Werkstaͤtte
von 30 Arbeitern vollbracht wird.
Ein Arbeiter kann in einer Tagarbeit von 14 Stunden 75 große Buͤschel
Schwefelhoͤlzchen, jeden zu 700 Hoͤlzchen, schneiden und binden, und
verdient damit 1 Fr. 75 Cent. bis 2 Franken.
Jeder Buͤschel von 700 Hoͤlzchen kostet in der Fabrik 5 Cent.: 30
Arbeiter liefern mithin in einem Tage 2250 Buͤschel, welche der Fabrikant um
112 Fr. 50 Cent. verkauft. Da der Kaufmann oder Kraͤmer das um 10 Cent.
verkauft, was ihm der Fabrikant um die Haͤlfte dieses Preises liefert, so wird das
Product, welches 30 Arbeiter in einem Tage erzeugen, von dem Kraͤmer um 225
Franken verkauft. Zieht man nun den Lohn der Arbeiter mit 52 Franken 50 Cent., den
Taglohn zu 1 Fr. 75 Cent. gerechnet, ab, so bleibt dem Fabrikanten ein Gewinn von 60
Franken.
Die Maschine des Hrn. Cochot erzeugte mehrere Monate
hindurch taͤglich, den Tag zu 14 Stunden gerechnet, fuͤr 250 Franken
Arbeit. Die fabricirten Hoͤlzchen mußten jedoch gebunden werden, und dazu
verwendete Hr. Cochot 12–20 Knaben oder
Maͤdchen, uͤber welche eine aͤltere Frau die Aufsicht
fuͤhrte. Der Lohn der Kinder betrug 25 bis 40 Cent. des Tages; jener der
Aufseherin belief sich auf 3 Franken, was im Durchschnitte taͤglich eine
Ausgabe von 9–10 Franken machte. Die Maschine wurde mittelst eines Pferdes
getrieben, so daß auch noch die Unterhaltung des Pferdes und der Maschine in
Anschlag kommt.
Nach Abzug aller dieser Kosten lieferte die Maschine des Hrn. Cochot mithin doch noch taͤglich fuͤr 200 Franken Arbeit,
und folglich wenigstens drei Mal so viel als eine Werkstaͤtte von 30
Arbeitern zu liefern im Stande ist. Der Ankauf des Holzes und die Kosten des
Schwefelns brauchen nicht in Anschlag gebracht zu werden, da sich diese wie 67 zu
200 verhalten.
Ich will nun aber auch die beiden Maschinen unter sich vergleichen. An jener des Hrn.
Pelletier bewegt sich der Hobel, waͤhrend das
Holz, aus welchem die Hoͤlzchen geschnitten werden, unbeweglich bleibt. Wenn
die 24 Hoͤlzchen fertig und in die dafuͤr bestimmte Buͤchse
gelangt sind, so hebt sich das Holz senkrecht um so viel als die Dike eines
Hoͤlzchens betraͤgt, und die Arbeit beginnt von Neuem, so daß sich das
Holz mithin nicht bestaͤndig, sondern absazweise bewegt.
An der Maschine des Hrn. Cochot hingegen schreitet der
Cylinder, der die Klingen traͤgt, allmaͤhlich und langsam
vorwaͤrts, waͤhrend sich die Stuͤke Holz, welche zerschnitten
werden sollen, bestaͤndig drehen.
An ersterer Maschine ist die Arbeit des Hobels regelmaͤßig; die
Hoͤlzchen erhalten saͤmmtlich gleiche Dike und gleiche Breite. An
lezterer bleibt sich hingegen die Arbeit des Cylinders nicht immer gleich. Der
Durchmesser dieses Cylinders bleibt naͤmlich unveraͤnderlich,
waͤhrend die Entfernung der Oberflaͤche des zu zerschneidenden Holzes
von der Achse des Rades, an welcher es befestigt ist, in dem Maße abnimmt, in
welchem das Holz zerschnitten wird. Hieraus ergibt sich, daß die ersten und die
lezten Hoͤlzchen, welche geschnitten werden, jenen aus der Mitte nicht ganz
gleich kommen.
Da uͤbrigens der Wagen allmaͤhlich und bei jeder Umdrehung des Rades um
die Dike eines Hoͤlzchens vorwaͤrts schreitet, so wuͤrde, wenn
die senkrechte Klinge, die die Arbeit eines Hobels versieht, allein (und ohne den
Cylinder) arbeitete, das Holz in Form eines Cylinders, der eine Archimedische
Schraubenlinie zur Basis hat, zerschnitten werden, so daß die bei der ersten
Umdrehung des Rades ausgeschnittenen Hoͤlzchen nicht durchaus gleiche Dike
haben koͤnnen. Waͤhrend des uͤbrigen Theiles der Arbeit
wuͤrde jedoch die Dike dieser Hoͤlzchen sich gleich bleiben, weil die
senkrechte Klinge die Streifen genau in der Form der Archimedischen Spirale
schneidet.
Die Maschine des Hrn. Pelletier scheint 30 Mal weniger
Arbeit zu geben, als jene des Hrn. Cochot; man brauchte
also 30 neben einander aufgestellte und durch eine einzige Triebkraft getriebene Pelletier'sche Maschinen, um die Resultate einer einzigen
Cochot'schen zu erhalten. Ueberdieß braucht leztere
weniger Raum als erstere; dafuͤr kosten aber die 30 Pelletier'schen Maschinen weniger, als die einzige Cochot'sche. Die 30 Hobel sind naͤmlich nicht so theuer, leichter
zu verfertigen und leichter auszubessern, als der Klingencylinder.
Bei der Anwendung der Maschine des Hrn. Pelletier ergibt
sich auch noch der Vortheil, daß man nur so viele Hobel in Bewegung zu sezen
braucht, als mit der Groͤße der Consumtion im Verhaͤltnisse steht, und
daß man mithin die Fabrikation nach Bedarf vermehren oder vermindern kann.
Wir zweifeln jedoch sehr, daß diese Maschinen die Handarbeit verdraͤngen
werden, da diese Arbeit keinen großen und sehr vollkommenen Werkzeug noͤthig
macht, und da der Arbeiter nicht lange braucht, um eine hinlaͤngliche
Fertigkeit in derselben zu erreichen. Wenn man auch in den meisten
Fabrikationszweigen eine Vervollkommnung der Werkzeuge und die Anwendung der
Maschinen wuͤnschen muß, so scheint uns dieß doch nicht auch auf die
Fabrikation der Schwefelhoͤlzchen anwendbar zu seyn; und zwar erstens, weil
diese Arbeit gewoͤhnlich von einer sehr armen Classe von Menschen verrichtet
wird, und zweitens, weil die Anwendung der Maschinen, ungeachtet in Paris und in
einem Umfange von 15–20 Meilen taͤglich fuͤr 500 Franken
Schwefelhoͤlzchen (wovon auf die Estaminets allein taͤglich
fuͤr 250 Fr. kommen) verbraucht werden, doch keine großen Vortheile abwerfen
wird. Der Handel mit diesen Hoͤlzchen befindet sich naͤmlich in den
Haͤnden von 14 Haͤusern in der Straße de la
Vieille-Monnaie, und der Fabrikant muͤßte seine Waare
wenigstens um die Haͤlfte des gegenwaͤrtigen Preises wohlfeiler geben,
wenn er sich des Vorzuges versichern wollte, oder er muͤßte seine Maschine
einige Zeit des Jahres uͤber feiern lassen, um nur so viel zu erzeugen, als
er braucht. Es wuͤrde daher bei der Anwendung einer Maschine weder der Fabrikant, noch der
Consument gewinnen, da fuͤr lezteren der Preis der Waare gleichhoch bleiben
wuͤrde.
Beide der beschriebenen Maschinen verdienen aber alle Beruͤksichtigung, indem
sie sich wahrscheinlich zu verschiedenen anderen Zweken mit Vortheil anwenden
lassen. So scheint sich z.B. jene des Hrn. Pelletier sehr
gut zum Ausschneiden kleiner Stuͤke Holz fuͤr eingelegte Arbeiten, und
jene des Hrn. Cochot zum Zerkleinern der
Faͤrbehoͤlzer zu eignen. Leztere wird gegenwaͤrtig auch
wirklich von ihrem Erfinder zu diesem Zweke benuzt.
Die Verfertigung der Schwefelhoͤlzchen scheint jedoch, auch wenn sie, wie wir
wuͤnschen, eine bloße Handarbeit bleibt, noch einiger Verbesserungen
faͤhig zu seyn. Untersucht man naͤmlich einen Buͤschel dieser
Hoͤlzchen, so findet man, daß die meisten derjenigen, die sich in der Mitte
befinden, an ihren beiden Enden nur sehr schwach mit Schwefel uͤberzogen
sind. Dieß ruͤhrt davon her, daß die Hoͤlzchen in ganzen
Buͤscheln geschwefelt werden, wobei sie sich wegen ihrer rechtwinkeligen Form
so an einander legen, daß kein Zwischenraum zwischen denselben bleibt, und daß sich
der Schwefel folglich nur an die Endflaͤchen anlegen und nicht zwischen die
Hoͤlzchen eindringen kann. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, sollte man die
Hoͤlzchen nach englischer Manier am Ende schief zuschneiden. Die
Englaͤnder schwefeln ferner nur das eine Ende, und zwar, wie es scheint, mit
Recht; denn das Hoͤlzchen ist meistens zu kurz, als daß es wohl zu
zweimaligem Gebrauche dienen koͤnnte. Bei uns schwefelt man beide Enden, weil
das eine Ende oft so schlecht geschwefelt wird, daß es sich nicht entzuͤnden
kann.
Außer diesen Maschinen wurde auch schon in England eine erfunden, auf welche sich Hr.
Weatherley am 14. Mai 1825 ein Patent geben ließ, die
aber im Großen unausfuͤhrbar gewesen zu seyn scheint.Wir uͤbergehen hier die Beschreibung dieser Maschine, die der Bulletin im Auszuge gibt, indem dieselbe unseren
Lesern bereits aus dem Polytechn. Journal
Bd. XXV. S. 226 laͤngst
bekannt ist. A. d. Ueb.
Fig. 11 ist
ein Seitenaufriß der Cochot'schen Maschine.
Fig. 12 ist
ein Grundriß derselben.
An Fig. 11 und
12 sieht
man in B die Bank, auf welcher der Apparat ruht.
R ist ein gußeisernes Rad mit 30 Zwingen S, durch welche 30 Stuͤke Holz d, die zu Schwefelhoͤlzchen zerschnitten werden
sollen, an ihrer Stelle erhalten werden.
a ist die Achse oder Welle des Rades R, die ein Zahnrad traͤgt, welches von der endlosen
Vaucanson-Kette c gefuͤhrt wird. Diese
Kette laͤuft uͤber das Zahnrad b, dessen
Welle mittelst der Kurbel M in Bewegung gesezt wird. Auf
diese Kurbel kann man irgend eine Triebkraft wirken lassen.
Die endlose Kette geht uͤber eine Reibungsrolle y,
die sie in gehoͤriger Spannung erhaͤlt, indem diese Rolle mittelst des
rechtwinkeligen Loches, welches sich in ihrem Traͤger befindet, und durch
welches der Bolzen z geht, den man nach Belieben
anziehen oder nachlassen kann, nach Bedarf gehoben oder herabgelassen werden
kann.
Die Welle des Zahnrades b traͤgt ein Winkelrad n, und dieses fuͤhrt ein zweites Winkelrad m, dessen Achse nach der Laͤngenachse der
Maschine laͤuft.
Die Nabe des Rades m dient der Schraube V als Mutter, und diese Schraube treibt den
Klingencylinder r, der sich frei um seine Achse dreht,
in dem Maße als die Arbeit fortschreitet, vorwaͤrts.
Fig. 13 ist
ein Laͤngendurchschnitt des Apparates, welcher den Klingencylinder
traͤgt.
r ist der kupferne Cylinder, in welchen die Messer oder
Klingen ii so eingesezt sind, daß die
Flaͤchen derselben durch die Achse dieses Cylinders gehen.
Fig. 16
zeigt, auf welche Weise diese Klingen in dem kupfernen Cylinder befestigt sind. Die
Achse des Cylinders dreht sich frei auf Zapfenlagern, welche an dem Wagen T befestigt sind, welchen man in Fig. 14 im Grundrisse und
in Fig. 15 im
Querdurchschnitte nach oo' sieht.
Dieser Wagen erhaͤlt mittelst der schwalbenschwanzfoͤrmigen Fuge k eine Bewegung laͤngs des Falzes k', und diese Bewegung wird durch die Schraube V bestimmt, der die Bewegung selbst wieder durch die
bewegliche, das Winkelrad tragende Schraubenmutter mitgetheilt wird.
Der Wagen T traͤgt noch einen Kamm P, dessen Gestalt man in Fig. 17 sieht. Dieser
Kamm laͤßt sich mittelst der Schraube u
vor- und ruͤkwaͤrts bewegen, er bleibt aber feststehend, wenn
er ein Mal fuͤr den Dienst, den er zu verrichten hat, gehoͤrig
gestellt ist. Dieser Kamm traͤgt 5 Zaͤhne k, deren unbewegliche Spizen dazu dienen, die kleinen von den Klingen des
Cylinders r ausgeschnittenen Hoͤlzchen
loszumachen. Zu diesem Behufe sind die Messer oder Klingen in Entfernungen, welche
der Dike eines Hoͤlzchens gleich sind und an Punkten, welche den
Zaͤhnen des Kammes entsprechen, eingeschnitten, wie man dieß in Fig. 16
steht.
e ist ein Hobel, welcher die Stuͤke Holz nach
duͤnnen Platten, welche durch den Klingencylinder wieder in Hoͤlzchen
zerschnitten werden, einschneidet. Dieser Hobel kann sich mittelst der Schraube t vor- und ruͤkwaͤrts bewegen;
diese Schraube dient naͤmlich zur Regulirung seiner Stellung, je nachdem man
mehr oder weniger dike Blaͤtter von dem Holze trennen will.
X ist ein Trog, in welchen die nach und nach
geschnittenen Hoͤlzchen fallen.
Fig. 18 und
19 geben
die Details des großen Rades, woran sich die zu zerschneidenden Stuͤke Holz
befinden, in groͤßerem Maßstabe. Fig. 18 ist ein Anfriß
und Fig. 19
ein Durchschnitt nach vv'.
Die Zwingen S sind mittelst eines ihrer Enden an dem
gußeisernen Kreise G befestigt. Dieses Ende laͤßt
sich aber um den Bolzen g so bewegen, daß man mittelst
der Schraube h die Zwinge nachlassen oder anziehen, und
daher das Stuͤk Holz mehr oder weniger gegen den Kreis R, der ihm als Ausladung dient, andruͤken kann.
Tafeln