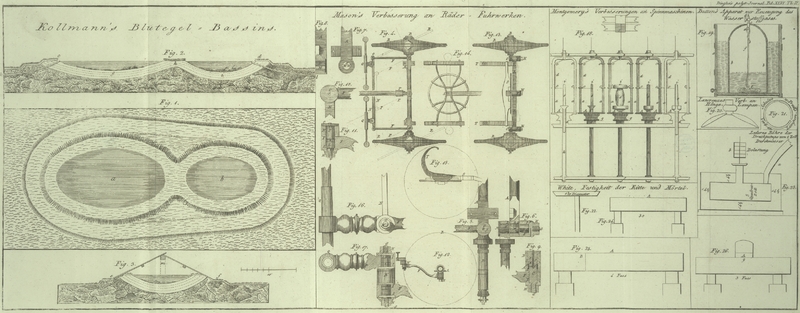| Titel: | Ueber einen bequemen Apparat zur Erzeugung von Wasserstoffgas. Von Hrn. Carl Button. |
| Fundstelle: | Band 46, Jahrgang 1832, Nr. XXXII., S. 136 |
| Download: | XML |
XXXII.
Ueber einen bequemen Apparat zur Erzeugung von
Wasserstoffgas. Von Hrn. Carl
Button.
Aus dem Register of Arts. Julius 1832, S.
170.
Mit einer Abbildung auf Tab. II.
Button, Apparat zur Erzeugung von Wasserstoffgas.
Schon oft fuͤhlte ich den Mangel eines bequemen Verfahrens, durch welches man
sich schnell zu chemischen Zweken Wasserstoff zu verschaffen im Stande ist. Dieß
bewog mich dazu einen Apparat auszusinnen und zu verfertigen, mit welchem man in
jedem Augenblike eine Quantitaͤt Wasserstoffgas, die weniger als drei Gallons
betraͤgt, zu erzeugen im Stande ist, und der mir bei meinen Arbeiten so gute
Dienste leistete, daß ich keinen Anstand nehme denselben hiemit oͤffentlich
bekannt zu machen. Ich bin uͤberzeugt, daß es bald kein Laboratorium geben
wird, in welchem sich mein Apparat nicht vorfaͤnde, und zwar entweder in
groͤßerem oder in kleinerem Maßstabe.
Man sieht diesen Apparat in Fig. 19, an welcher aa das aͤußere Gefaͤß vorstellt,
welches ein Faß oder ein anderer Behaͤlter seyn kann, der 18 Gallons oder
eine sonstige Menge Fluͤssigkeit zu fassen vermag. In diesem Fasse oder
Behaͤlter befindet sich 3 bis 4 Zoll uͤber dessen Boden eine Oeffnung
von beilaͤufig 1/2 Zoll im Durchmesser, welcher mit einem Pfropfe
verschlossen wird. b ist der innere Behaͤlter
oder das innere Gefaͤß, welches beilaͤufig um 8 Zoll im Durchmesser
kleiner ist, als das Gefaͤß a, die Form eines
Bienenstokes hat, und aus Toͤpferwaare besteht, welche innen und außen
glasirt ist. In den oberen Theil oder in die Mitte der Kuppel wird eine
kreisfoͤrmige Oeffnung von beilaͤufig 1/2 Zoll im Durchmesser gebohrt,
welche zur Aufnahme einer 4 Zoll langen Gasroͤhre aus Zinn (pewter) dient. An den einen Ende dieser Roͤhre
ist eine weibliche Schraube aus Messing angeloͤthet, in die der Sperrhahn d paßt; an ihrem anderen Ende hingegen befinden sich
zwei Loͤcher, die genau einander gegenuͤberstehen, und die zur
Aufnahme des, bleiernen Dreiekes oder Ringes e dienen.
Wenn diese Roͤhre auf die angegebene Weise zubereitet worden, so wird sie mit
Gyps in der Kuppel des inneren Behaͤlters befestigt, und wenn dieser Gyps
getroknet ist, so wird das bleierne Dreiek oder der Ring e an der Roͤhre fest gemacht, indem man einen Bleidraht durch die
gemachten Oeffnungen e stekt, und dessen Enden
zusammendreht. Auf diese Weise erhaͤlt man einen Stuͤzpunkt, an
welchem man einen Bleistreifen von beilaͤufig 1/2 Zoll Breite in der Mitte
des Gefaͤßes so aufhaͤngen kann, daß man ein zusammengerolltes Zinkblech F in einer Hoͤhe von 2 bis 3 Zoll uͤber
dem Boden des Gefaͤßes daran zu befestigen im Stande ist. Ist dieß geschehen,
so wird der Behaͤlter an seiner Stelle eingeschraubt, indem der Scheitel des
aͤußeren Gefaͤßes auf denselben herabgeschraubt wird. Dieß kann
dadurch geschehen, daß man in der Mitte eine Oeffnung, durch welche der Sperrhahn
gehen kann, und an der Seite eine zweite Oeffnung anbringt, durch welche die
Saͤure und das Wasser in den aͤußeren Behaͤlter gegossen wird.
Ist der Apparat auf diese Art und Weise vollstaͤndig zusammengesezt, so wird
der Sperrhahn an dem Behaͤlter geoͤffnet, und in den aͤußeren
Behaͤlter so lang Saͤure und Wasser gegossen, bis sowohl dieser, als
der aͤußere Behaͤlter voll ist. Wenn dieß der Fall ist, so wird der
Sperrhahn geschlossen, und dafuͤr der Pfropf, mit welchem die Oeffnung am
unteren Theile des aͤußeren Behaͤlters verschlossen ist, ausgezogen,
und die Oeffnung so lang offen gelassen, bis alles uͤber ihr befindliche
Wasser ausgeflossen ist, worauf man sie dann durch den Pfropf wieder verschließt,
und so viel concentrirte Schwefelsaͤure eintraͤgt, daß dieselbe
beinahe den achten Theil des Wassers betraͤgt, so zwar daß man. Eine Pinte
Schwefelsaͤure auf 7 Pinten Wasser erhaͤlt. Die Saͤure wird
sich bald mit einem Theile des Wassers vermischen, dadurch mit dem Zinke in
Beruͤhrung kommen, und eine große Menge Wasserstoffgas entwikeln. Dieser
Wasserstoff wird in den oberen Theil des Behaͤlters emporsteigen, und das
Wasser aus der Stelle treiben, welches dann wieder von dem aͤußeren
Gefaͤße aufgenommen werden wird. Der Pfropf an dem aͤußeren
Gefaͤße muß sich tief unten befinden, damit so viel Wasser abgelassen werden
kann, daß die Saͤure und das Wasser nicht uͤber das aͤußere
Gefaͤß laufen, wenn der innere Behaͤlter mit Gas gefuͤllt
ist.
Braucht man nun Wasserstoffgas, so hat man weiter nichts zu thun, als auf den
Sperrhahn eine Blase aufzuschrauben, und den Hahn zu drehen. So wie dieß
naͤmlich geschieht, wird die verduͤnnte Saͤure in dem
aͤußeren Behaͤlter herabsteigen, so daß die Blase in wenigen Sekunden
mit Gas gefuͤllt seyn wird. So wie der Hahn geschlossen wird, entwikelt sich
dann neuerdings Gas, welches die verduͤnnte Saͤure in den
aͤußeren Behaͤlter treibt; und dieß geschieht so lange als noch Zink
und Saͤure vorhanden.Wir koͤnnen an dieser Methode des Hrn. Button nicht viel Neues finden;
denn, einige leichte Modificationen abgerechnet, trifft man eine ganz
aͤhnliche Vorrichtung an mehreren
Wasserstoffgas-Zuͤndmaschinen.A. d. Ueb.
Tafeln