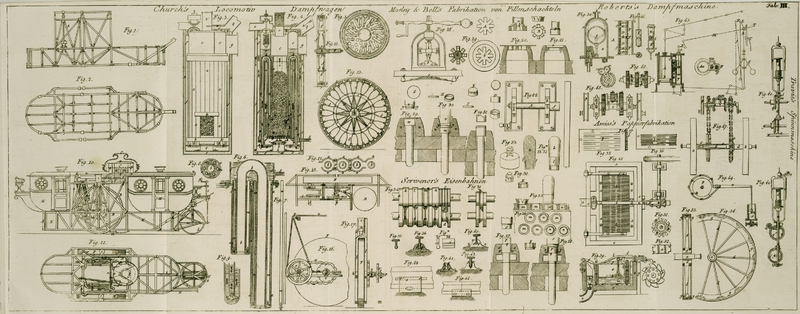| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zum Transporte von Menschen und Gütern, von welchen Verbesserungen einige auch auf die gewöhnlichen Dampfmaschinen anwendbar sind, und auf welche sich William Church Esq., von Bordsley Green bei Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 9. Februar 1832 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 49, Jahrgang 1833, Nr. XXX., S. 162 |
| Download: | XML |
XXX.
Verbesserungen an den Apparaten zum Transporte
von Menschen und Guͤtern, von welchen Verbesserungen einige auch auf die
gewoͤhnlichen Dampfmaschinen anwendbar sind, und auf welche sich William Church Esq., von
Bordsley Green bei Birmingham in der Grafschaft Warwick, am
9. Februar 1832 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Maͤrz 1833, S.
89.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Church, Verbesserungen an den Apparaten zum Transporte fuͤr
Menschen, Guͤter etc.
Die unter diesem Patente begriffenen Verbesserungen und Erfindungen beziehen sich
hauptsaͤchlich auf jene Dampfwagen, welche auf gewoͤhnlichen Straßen
fahren sollen, und lassen sich unter folgende drei Abschnitte bringen. Sie betreffen
naͤmlich: 1) den Bau des Gestelles des Wagens, welches die Koͤrper
oder Kasten des Fuhrwerkes zu tragen hat, und welches die Maschinerie, die den Wagen
treibt, umschließt, so wie auch die Art und Weise, auf welche die Rippen oder die
Riegel mit einander verbunden sind, um bei einem verhaͤltnißmaͤßig
geringen Gewichte des Materielles doch eine große Staͤrke zu erreichen; 2)
den Bau der Kessel und der Feuerzuͤge, in Folge dessen die zum Betriebe der
Maschine noͤthige Menge Dampf erzeugt wird; und 3) endlich den Bau der
Laufraͤder des Wagens, der so berechnet ist, daß wenn die Raͤder auch
uͤber Unebenheiten der Straße gehen, doch keine Erschuͤtterung Statt
finden kann, indem die Reifen dieser Raͤder elastisch sind, und sich, so wie
sie mit dem Boden in Beruͤhrung kommen, in sphaͤroidische Figuren oder
abgeplattete Kruͤmmen verwandeln.
Bei der Einrichtung des Gestelles habe ich mich, sagt der Patenttraͤger,
bemuͤht, die Bohlen, Rippen, Riegel, Stangen, Roͤhren oder
Staͤbe desselben so zu formen, anzuordnen und mit einander zu verbinden, daß
sie ein Gehaͤuse oder Skelett bilden, welches in allen Theilen und nach allen
Richtungen, in denen irgend ein Druk, Stoß oder Zug darauf wirken kann,
gehoͤrig unterstuͤzt ist, an welchem alle Theile den gehoͤrigen
sie treffenden Theil des Gewichtes und der Gewalt zu tragen haben, kurz an welchem
die Gewalt so gleichmaͤßig als moͤglich uͤber alle Theile des
Gehaͤuses oder Skelettes verbreitet und ausgedehnt ist. Ich verfertige dieses
Gehaͤuse ferner in der Art, daß es die Kessel und die Maschinerien umschließt, und
auch den Koͤrpern oder Kasten der Wagen, welche zur Aufnahme der Reisenden
und des Gepaͤkes bestimmt sind, als Stuͤze dient.
Ich bilde durch die von mir getroffene Einrichtung des Gehaͤuses gleichsam
einen sogenannten Maschinenraum, d.h. einen Raum, in welchem sich die verschiedenen
Maschinerien und Kessel befinden, und der an Hoͤhe der Hoͤhe der
Kasten der zu erbauenden Wagen gleichkommt. Fig. 1 zeigt einen
Seitenaufriß eines nach diesen Grundsaͤzen erbauten, vollkommenen, solchen
Gehaͤuses. Fig. 2 ist eine horizontale Ansicht desselben, von Oben gesehen.
Wenn dieses Gehaͤuse aus hoͤlzernen Balken zusammengesezt ist, wie man
dieß in der Zeichnung sieht, so verbinde ich diese Balken durch eiserne oder
sonstige metallene Klammern oder Wangen mit einander, um auf diese Weise das
Einzapfen derselben in einander zu umgehen, damit das Holz nichts in seiner Substanz
und Staͤrke verliere.
Das Gehaͤuse, kann nun durch Verbindung von Stangen, Rippen, Balken oder
metallenen Roͤhren nach den angefuͤhrten Principien erbaut werden,
indem deren Verbindungen durch Scheidengefuͤge, welche durch Stifte (cotters) befestigt werden, und dergleichen man in Fig. 1 bei AA sieht, versichert werden. Diese Einrichtung ist
hier deßwegen befolgt, damit die sich bewegenden Cylinder und deren
Anhaͤngsel leichter eingehaͤngt und losgemacht werden
koͤnnen.
Bei der Beschreibung des Kessels, des Ofens und der Feuerzuͤge ist vor Allem
zu bemerken, daß der Kessel aus mehreren mit Wasser gefuͤllten Roͤhren
besteht, welche in senkrechter Richtung neben einander angebracht sind, und zwar in
kreisfoͤrmigen oder vielekigen Reihen, so daß sich das Feuer in der Mitte der
Roͤhren befindet, waͤhrend die Feuerzuͤge aus kleineren, durch
das Innere der Wasserroͤhren laufenden Roͤhren bestehen. Aus den
Zeichnungen wird diese Einrichtung deutlicher und anschaulicher werden.
Fig. 3 zeigt
ein System solcher Roͤhren, welche einen Kessel und Ofen bilden, von Außen im
Aufrisse; die doppelten Gehaͤuse, welche den Rauchfang oder aͤußeren
Feuerzug bilden, und der Gang fuͤr die Luft sind weggenommen oder zum Theil
im Durchschnitte dargestellt.
Fig. 4 ist ein
Durchschnitt desselben Apparates senkrecht durch die Mitte des Kessels und des Ofens
genommen, damit die Wasserroͤhren aaaa
anschaulich werden. Man wird sogleich ersehen, daß diese Wasserroͤhren
paarweise und von ungleicher Laͤnge angebracht sind, und daß durch jedes Paar
eine Heberroͤhre bb geht.
Fig. 5 ist ein
horizontaler Durchschnitt durch die cylindrische Kampfkammer c, uͤber den Kruͤmmungen der Heber b genommen, damit man den Scheitel dieser Heber und deren Verbindungen mit den einzelnen
Paaren von Wasserroͤhren ersieht.
Die eigenthuͤmliche Einrichtung der einzelnen Wasserroͤhren des Kessels
und deren paarweise Verbindung mit den Heberfeuerzuͤgen ersieht man aus Fig. 6, welches
ein Paar dieser Wasserroͤhren mit ihrem Verbindungsheber einzeln und in
vergroͤßertem Maßstabe im Durchschnitte darstellt. cc ist naͤmlich ein Theil der cylindrischen
Dampfkammer, deren unterer Theil mit Wasser gefuͤllt ist, welches durch die
Speisungsroͤhre d eingefuͤhrt wird. Das
Niveau des Wassers wird bis auf einige Zolle uͤber die Kruͤmmungen der
Heberroͤhren bb erhoͤht, wie aus
Fig. 4
ersichtlich. Von dieser cylindrischen Kammer aus steigt das Wasser in die
Roͤhren aaaaa herab, so daß dieselben
vollkommen gefuͤllt sind. Die Roͤhren selbst werden, wie man bei j sieht, durch Schrauben oder auf eine andere Weise an
der Bodenplatte der Dampfkammer befestigt.
Die Flammen und die durch das Feuer erhizten Daͤmpfe spielen frei um die
aͤußeren Oberflaͤchen jener Theile des Kessels, welche durch die
Reihen von kurzen Roͤhren gebildet werden, und auf jenen Theilen der
Oberflaͤche der langen Roͤhren, die gegen das Feuer gerichtet ist. Da
sie jedoch durch die Naͤhe dieser lezteren Roͤhrenreihe eingeengt
werden, so steigen die Flamme und die Daͤmpfe, wie dieß in der Zeichnung
durch Pfeile angedeutet ist, durch die kuͤrzeren Schenkel der in den
Wasserroͤhren befindlichen Heberfeuerzuͤge empor, und durch deren
laͤngere Schenkel wieder herab, um dann, nachdem sie ihre Hize an das Wasser
abgegeben, in die am Grunde der laͤngeren Heberschenkel befindliche
Rußbuͤchse (dust-box) uͤberzugehen,
und aus dieser hierauf durch die aͤußeren Feuerzuͤge f in den Rauchfang g
emporsteigen. Der Ruß wird durch ein feines Drahtgitter, welches als eine Art von
Scheidewand zwischen der Rußbuͤchse und der unteren Oeffnung des
aͤußeren Feuerzuges angebracht ist, aufgehalten.
Die Enden der Heberfeuerzuͤge sind, wie Fig. 6 und Fig. 4 im Durchschnitte
zeigt, durch angeschraubte Dekel oder Huͤtchen i
mit den unteren Enden der Wasserroͤhren verbunden; sie koͤnnen
uͤbrigens auch auf eine andere Weise und so damit verbunden werden, daß sie
die inneren Oberflaͤchen der Wasserbehaͤlter bilden.
Die Feuerzuͤge haben die Form von Hebern oder gebogenen Roͤhren, und
stehen am Scheitel in gar keiner Verbindung mit den Wasserroͤhren, so daß
sich das Metall bei dem Wechsel der Temperatur ausdehnen und zusammenziehen kann,
ohne daß die Verbindungen des Metalles dadurch auch nur den geringsten Nachtheil
erleiden. Die unteren Enden der Wasserroͤhren koͤnnen durch
Schraubengewinde oder auf irgend eine andere zwekmaͤßige Weise in die oberen
Flaͤchen der ringfoͤrmigen Kammern k, und die Enden der
Heber in die unteren Flaͤchen derselben eingesezt werden, wie dieß aus Fig. 3 und 4 ersichtlich
ist. Um die Circulation des Wassers zu befoͤrdern, kann man in diesem Falle
von der einen ringfoͤrmigen Kammer zur anderen kleine
Verbindungsroͤhren ll laufen lassen.
Um nun an den unteren Theilen der Kesselroͤhren a
eine fortwaͤhrende Speisung mit Wasser zu unterhalten, sind in denselben
kleine, senkrechte Leitungsroͤhren angebracht, die man in Fig. 6 bei mm sieht. Diese Roͤhren sind an beiden
Enden offen; in geringer Entfernung unter deren unterer Muͤndung befindet
sich aber ein kleiner Dekel oder Schild nn, dessen
Zwek darin besteht, das Emporsteigen der Dampfkuͤgelchen, die sich am Boden
des Kessels erzeugen, in den kleinen Roͤhren zu verhindern. In Folge dieser
Einrichtung wird der Dampf naͤmlich frei außerhalb der Leitungsroͤhren
in den Wasserroͤhren emporsteigen, waͤhrend in den
Leitungsroͤhren m fortwaͤhrend eine
Stroͤmung des Wassers nach Abwaͤrts Statt finden wird, in Folge deren
der Boden des Kessels bestaͤndig gehoͤrig mit Wasser gespeist wird.
Eine dieser Roͤhren mit ihrem Dekel sieht man in Fig. 7 einzeln fuͤr
sich. Fig. 8
ist ein horizontaler Durchschnitt der Wasserroͤhre und des Feuerzuges mit
sechs eingesenkten Leitungsroͤhren m. Die Wirkung
dieser inneren Leitungsroͤhren wird aus Fig. 9 noch deutlicher
erhellen, indem hier die nach Aufwaͤrts gerichteten Pfeile den Lauf des
Dampfes, die nach Abwaͤrts gerichteten hingegen jenen des Wassers
andeuten.
Um die groͤßte moͤgliche Hize zu erzeugen und um den Rauch so
vollkommen als moͤglich zu verbrennen, lasse ich zwei Luftstroͤme in
den Ofen treten, von denen der eine am Scheitel des Brennmaterial les eintritt, und
durch eine Oeffnung in der Dampfkammer nach Abwaͤrts geht, waͤhrend
der andere am Boden eindringt, zwischen den fuͤnf Stangen oo durchgeht, wo er dann mit dem ersteren
zusammentrifft, um hierauf mit diesem durch die Heberfeuerzuͤge b und durch den aͤußeren Feuerzug f in den Rauchfang g zu
gelangen. Diese beiden Luftzuͤge kann man durch irgend ein Mittel, wie z.B.
durch einen sich drehenden Windfang oder durch ein uͤber dem Kessel
angebrachtes Geblaͤse, wie man z.B. in Fig. 10 und 11 sieht,
hervorbringen.
Fig. 10 ist
eine Seitenansicht des Wagens, woran man das Gestell oder Gehaͤuse und die
arbeitenden Theile der Maschine offen dargestellt sieht. Fig. 11 ist eine
horizontale Ansicht oder ein Grundriß eben desselben Wagens. An diesen beiden
Figuren sieht man die beiden Koͤrper oder Kasten BB und das oberhalb befindliche Geblaͤse C zur rechten Hand, waͤhrend sich die Cylinder DD zur Linken befinden. Man sieht hier auch die
Verbindung der Wirkung ihrer Kolben mit den Laufraͤdern FF.
Das cylindrische, am Scheitel des Wagens befindliche Gehaͤuse C enthaͤlt zwei horizontale, an einer Welle
aufgezogene Windraͤder. Das Gehaͤuse selbst ist durch eine
horizontale, in Fig. 10 durch punktirte Linien angedeutete Scheidewand abgetheilt. In dem
oberen Fache dreht sich der Windfang, um die Luft, die durch die Oeffnung oder den
Canal p an ihn gelangt, in den Ofen zu treiben, indem er
diese Luft durch die entgegengesezte Oeffnung oder durch den Canal q, welchen man auch in Fig. 3 und 4 sieht, in das
Gehaͤuse des Kessels treibt.
Die auf diese Weise eingetriebene Luft soll aus dem zwischen dem Maschinenraume und
den Wagenkasten befindlichen Raume genommen werden, um leztere auf diese Weise
kuͤhl zu erhalten. Ein Theil dieser eingetriebenen Luft gelangt durch die
Oeffnungen rr des Gehaͤuses und durch den
Centralgang der Dampfkammer abwaͤrts in den Ofen, und erzeugt daselbst den
oberen Luftzug; der andere Theil hingegen geht durch den aͤußeren Canal ss des Gehaͤuses (wobei er im
Voruͤbergehen den Waͤrmestoff des nahegelegenen Feuerzuges aufnimmt),
und durch die Oeffnung x zwischen den Roststangen in den
Ofen, um auf diese Weise den unteren Luftzug zu bilden. Der zweite, in dem unteren
Fache des cylindrischen Gehaͤuses befindliche Windfang, der die Dienste eines
Luftausschoͤpfers versehen soll, bringt den Dampf und Rauch aus dem
Rauchfange g empor, und entleert denselben durch die
Oeffnungen uu in die Kuppel, aus der er dann in
die freie Luft entweicht.
Der Ofen wird durch eine cylindrische Buͤchse oder einen Trichter v mit Brennmaterial gespeist. Durch den unteren Theil
dieses Trichters geht naͤmlich ein horizontaler Schieber w der die Muͤndung des Ofens verschließt, und
welcher einen Boden bildet, auf dem das Brennmaterial ruht. Oben ist der Trichter
mit einem Dekel verschlossen; soll das Feuer gespeist werden, so wird der Schieber
w herausgezogen, wo dann das Brennmaterial in den
Ofen faͤllt.
Unter gewissen Umstaͤnden finde ich es zwekmaͤßig das beschriebene
Princip des Kesselbaues (d.h. die durch die Wasserroͤhren gehenden
Heberroͤhren) in verschiedene Formen zu kleiden. Statt z.B. die
aͤußere Reihe der Wasserbehaͤlter aus cylindrischen Roͤhren zu
verfertigen, bilde ich dieselben aus zwei gefalteten Metallplatten, welche
zusammengebolzt oder auf irgend eine andere Weise an einander befestigt werden, wie
dieß aus Fig.
12 ersichtlich ist. aaa sind hier die
Wasserbehaͤlter, welche den Kessel bilden, und deren Seiten durch die Bolzen
xxx an einander befestigt sind. Die
Heberroͤhren sind auf die fruͤher beschriebene Weise verfertigt und eben
so durch Schrauben an den Wasserbehaͤltern befestigt. Die oberhalb
befindlichen Dampfgefaͤße c werden durch eine
Fortsezung der aͤußeren gefalteten Platten der Wasserbehaͤlter nach
Aufwaͤrts, und dadurch gebildet, daß man zur Erzeugung der inneren
Oberflaͤche des Dampfgefaͤßes aͤhnliche gefaltete Platten
anwendet, die man dann durch Nieten oder auf eine andere Weise an einer flachen, den
Boden der Dampfkammer bildenden Platte befestigt, und deren Seiten man durch
Querbolzen mit einander vereinigt.
Die eigenthuͤmliche Einrichtung der Laufraͤder ersieht man aus Fig. 13, in
welcher eines dieser Raͤder von Vorne dargestellt ist, waͤhrend man in
Fig. 14
einen Querdurchschnitt eines solchen Rades sieht. Diese Raͤder haben eine
bedeutende Breite und also auch einen großen Durchmesser; sie werden durch
Vereinigung mehrerer Reifen aa aus elastischem
Holze gebildet, indem man diese Reifen durch Klammern bb mit einander verbindet. Der aͤußere Umfang des Rades ist durch
einen eisernen, das Geleise bildenden Reifen ccc
gebunden; die Speichen bestehen aus elastischen gekruͤmmten Stahlplatten oder
aus Federn ddd, welche sich biegen und sich an
Gelenken bewegen. Die aͤußeren Enden saͤmmtlicher, elastischer
Speichen d sind am Ruͤken der einzelnen Klammern
durch Gefuͤge an der Felge befestigt, waͤhrend die entgegengesezten
Enden derselben gleichfalls durch Gefuͤge oder Gelenke mit einem Paare
metallener Ringe ee in Verbindung stehen, welche
durch die Radial- und Diagonalstangen fff
an der in der Mitte des Rades befindlichen Nabe oder metallenen Buͤchse g gehoͤrig festgemacht sind.
Diese Laufraͤder sind nun an kurzen kreisenden Achsen h befestigt, und das Gewicht des Wagens, welches auf diesen Achsen ruht,
bewirkt, daß sich der Umfang der Raͤder, so wie dieselben auf der Straße
fortlaufen, in schwach sphaͤroidische Figuren oder in Kruͤmmen biegt,
die etwas abgeplattet sind. Diese Abweichung von der kreisfoͤrmigen Form
bewirkt, daß das Rad fester an dem Boden festhaͤlt, und folglich weniger
Neigung hat herumzugleiten und in der Straße einzusinken.
Die Federn, welche hier in den Raͤdern angebracht sind, dienen als Ersazmittel
fuͤr die Federn, au welchen man sonst die Wagenkasten aufzuhaͤngen
pflegt. Um jedoch dem Wagen noch mehr Elasticitaͤt zu geben, und um die
Bewegung desselben zu erleichtern, bediene ich mich noch folgender Mittel. Wie Fig. 10 und
11
zeigen, ist an dem Gestelle oder Gehaͤuse eine cylindrische, mit Luft
gefuͤllte und am Scheitel geschlossene Buͤchse i gut befestigt. In dieser cylindrischen Buͤchse ist, wie in der
Seitenansicht Fig.
17 durch Punkte angedeutet ist, an dem oberen Ende eines gabelfoͤrmigen Joches
ll ein Kolben k
festgemacht. Dieses Joch bewegt sich frei auf und nieder und ist an dem oberen
Theile nach Art der Liederung an den hydraulischen Pressen durch eine lederne
Huͤlle genau schließend gemacht, waͤhrend sich in den unteren Enden
des Joches Augen oder Zapfenlager befinden, in welchen sich die kurzen Achsen h frei drehen. Wenn nun eine hinreichende Menge Luft in
das Gefaͤß oder in den Behaͤlter i
getrieben worden, so entsteht dadurch eine Luftfeder, wenn ich so sagen darf, auf
der das Gewicht des Wagens und dessen Last ruht, waͤhrend dieses Gewicht
durch die Dazwischenkunft der Kolben und, der Joche von den Laufraͤdern
getragen wird.
Da die Achsen der Raͤder zu einer seitlichen Bewegung geneigt waͤren,
wenn diese nicht durch eine gehoͤrige Vorrichtung verhindert wuͤrde,
so bediene ich mich der gegliederten Stangen mm
und p, welche man in der horizontalen Darstellung des
Rades Fig. 15
sieht. Liese Stangen sind naͤmlich an dem einen Ende durch Angelgewinde nn mit dem Gestelle oder Gehaͤuse, an dem
entgegengesezten Ende hingegen durch Ringe oo mit
den Achsen (siehe den Seitenaufriß Fig. 16 und die
Randansicht Fig.
17) verbunden. Die Stange p ist, wie man
bemerken wird, durch ein Nußgelenk, welches man in dem Durchschnitte des Rades und
seiner Achse Fig.
14 sieht, mit der inneren Seite der Achse des Rades verbunden, und wird
daher, obschon sie die Achse endwaͤrts festhaͤlt, deren Bewegung nicht
hemmen. Diese Stangen gestatten dem Wagen sich in senkrechter Richtung zu
schwingen.
Um das Entweichen der Luft hinter dem Kolben in der Buͤchse i zu verhindern, treibe ich mittelst einer kleinen
Drukpumpe eine geringe Menge Oehl, Wasser oder einer sonstigen Fluͤssigkeit
ein. Diese Pumpe kann auch zum Eintreiben von Luft verwendet werden, so daß die
Elasticitaͤt der Feder mithin dem Gewichte der Last, welche sie zu tragen
hat, angepaßt werden kann.
Obwohl ich nun hier Luftbuͤchsen und Kolben beschrieben habe, so muß ich doch
bemerken, daß ich mich keineswegs auf diese Luftfedern beschraͤnke, indem in
manchen Faͤllen metallene Federn wuͤnschenswerther seyn
moͤchten.
Die Kraft, welche der arbeitende Cylinder und die Kolben der Maschinen
ausuͤben, wird auf die gewoͤhnliche Weise durch die Kolbenstangen an
die Kurbelwelle (crank-shaft) s fortgepflanzt, und eine an dieser Welle befestigte
Rolle t (Fig. 16) treibt mittelst
einer endlosen Kette u, welche uͤber eine
aͤhnliche, an jeder der Achsen der Laufraͤder aufgezogene Rolle v laͤuft, die beiden Laufraͤder. Da die
Triebkraft jedoch verschieden abgeaͤndert werden muß, so habe ich auch zwei Kettenrollen von
ungleichen Durchmessern w und x an der genannten Kurbelwelle und an der Radachse aufgezogen, und eine
endlose Kette uͤber dieselben gefuͤhrt (Fig. 15 und 17). Beide an
den Radachsen befindliche Rollen drehen sich frei um dieselben, und jede derselben
kann mittelst der schiebbaren Klauenbuͤchse yy durch die Hebel und Stangen zz in
Thaͤtigkeit gesezt werden.
In der in Fig.
10 und 11 gegebenen Ansicht der ganzen Einrichtung des Wagens ist AA das Gestell oder das Skelett des Wagens. BB sind die beiden Kessel in ihren
Gehaͤusen; DD die Maschinen, welche nach
dem unter'm 29. Novbr. 1830 mir ertheilten PatentePolytechn. Journal Bd. XLIII. S.
1.A. d. R. erbaut sind, mir dem einzigen Unterschiede, daß die Maschinen im
gegenwaͤrtigen Falle umgekehrt sind, indem sie von den Eintritts- und
Austrittsroͤhren fuͤr den Dampf herabhaͤngen, und sich an dem
oberen Ende der Pfosten bbb in Zapfenlagern
drehen. E ist die Kurbelwelle, die sich in Zapfenlagern,
die in dem Gestelle angebracht sind, dreht, und welche durch die Schraubenbolzen aa an dem Ende des aufrechten Stuͤkes b in gehoͤriger Stellung erhalten wird.
Die Kurbelwelle sezt durch die Kettenrolle c und die
endlose Kette d die an den Achsen der Laufraͤder
FF aufgezogenen Kettenrollen oder Rigger e in Bewegung. An den Achsen dieser Raͤder sind
aber gleichfalls die Kettenrollen ff aufgezogen,
welche durch die endlosen Ketten hh mit den Rollen
ii in Verbindung stehen. Auf der Kurbelwelle
kk sind die Klauenbuͤchsen an den
Achsen der Laufraͤder angebracht, und zwar mit ihren Hebeln ll, welche durch die Stangen mm mit dem Hebel n
verbunden sind, durch den die Klauenbuͤchsen von einer Rolle zur anderen
geschoben werden koͤnnen, je nachdem die Geschwindigkeit der
Laufraͤder diese oder jene Abaͤnderung erhalten soll.
Die Cylinder ii enthalten die Luftfedern mit den an
der Spize der gabelfoͤrmigen Stangen ll
befindlichen Kolben; sie tragen den Wagen. n ist der
Trichter, durch welchen die Speisung mit Brennmaterial geschieht; o die Sicherheitsklappe und die zu den Maschinen
fuͤhrende Dampfroͤhre. rr ist die
Roͤhre, durch welche der austretende Dampf von den Maschinen in den Rauchfang
g geleitet wird. C ist
die Kuppel, in der sich die beschriebenen Windfange oder Geblaͤse befinden.
Auf der unteren Seite des unteren Windfanges ist die Rolle t befestigt, welche durch das endlose, uͤber die Rolle v und die groͤßere, an der Kurbelwelle E befindliche Rolle w
gezogene Band uu beide Windfange in kreisende
Bewegung versezt. HH sind die Kasten der Wagen, in denen die
Reisenden sizen, waͤhrend in den Raͤumen KK das Gepaͤk untergebracht werden kann.
Der Wasserbehaͤlter, der die Kessel mit Wasser speist, kann an jeder Seite des
Maschinenraumes unter dem Kettenrigger angebracht werden, waͤhrend die
Behaͤlter fuͤr das Brennmaterial uͤber demselben Raum finden,
so daß in der Mitte ein hinreichender freier Raum fuͤr den Maschinisten
bleibt. Uebrigens koͤnnen diese Behaͤlter auch an irgend einem anderen
beliebigen und geeigneten Plaze untergebracht werden. L
ist das Leitungs- oder Steuerungsrad, welches sich unter dem vorderen Size
des Wagens und unter der Leitung des Wagenlenkers befindet. Dieses Steuerungsrad ist
an einem kreisrunden Gestelle 11 aufgezogen, und dreht sich in den Enden der
aufrechten und fest an das kreisrunde Gestell geklammerten Stangen 2 in
Zapfenlagern. Die oberen Enden dieser Stangen sind mit einander verbunden und an die
Enden der Welle 3 gebolzt, und diese Welle ist mit einem Halsringe versehen, an
welchem sich eine starke, in der Buͤchse 4 enthaltene und auf ihm ruhende,
metallene Feder befindet. Diese Federbuͤchse ist in dem Ende des Schnabels
oder der Deichsel 5 des Wagens festgemacht. 6 ist ein gezaͤhnter, an der
Welle 3 befestigter Quadrant, in welchen der Triebstok 7, der bloß Verzahnungen hat,
eingreift. Der zulezt genannte Triebstok ist an der senkrechten Stange 8 aufgezogen,
die mit einem horizontalen Kurbelgriffe 9 versehen ist. Wenn der Wagenlenker daher
diesen Griff umdreht, so wird der Triebstok den Quadranten 6, und also durch die
Welle 3 auch das Rad L und dessen kreisrundes Gestell
innerhalb des aͤußeren kreisrunden, an dem Wagen festgemachten Reifens 10
bewegen oder drehen.
11 ist ein Sprachrohr, mit Huͤlfe dessen sich der Wagenlenker in jedem
Augenblike und nach allen Richtungen mit dem Maschinisten besprechen kann. 12 stellt
ein ekiges Metallstuͤk vor, welches unmittelbar vor den Laufraͤdern so
an der unteren Seite des Gestelles aufgehaͤngt ist, daß es beinahe den Boden
beruͤhrt, und welches dazu da ist, um alle losen Steine oder andere auf der
Straße liegende Hindernisse aus dem Wege zu raͤumen, und alle Stoͤße
so viel als moͤglich zu vermeiden. Sollten die Raͤder zufaͤllig
mit irgend einem feststehenden Hindernisse in Beruͤhrung kommen, so
wuͤrden sie durch die Kette in Stand gesezt werden, uͤber dasselbe
hinweg zu gleiten.
Um der Zerstoͤrung der Stangen des Rostes durch die Hize des Ofens
vorzubeugen, gebe ich denselben eine muldenfoͤrmige Gestalt, und
fuͤlle deren Hoͤhlung mit feuerfestem Thone, Graphit oder irgend einem
anderen, der Einwirkung der Hize widerstehenden Materiale aus.
Tafeln