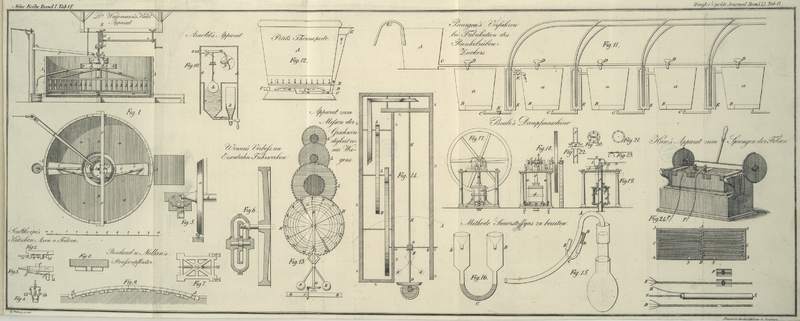| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich Josua Taylor Beale, Mechaniker im Church Lane, Whitechapel, Grafschaft Middlesex, am 28. März 1822 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 51, Jahrgang 1834, Nr. LXXXVIII., S. 401 |
| Download: | XML |
LXXXVIII.
Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich
Josua Taylor Beale,
Mechaniker im Church Lane, Whitechapel, Grafschaft Middlesex, am 28. Maͤrz 1822 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Maͤrz 1833, S.
101.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Verbesserungen an den Dampfmaschinen.
Meine Erfindung, sagt der Patenttraͤger, besteht in einer eigens
thuͤmlichen Verbindung oder Einrichtung gewisser Theile einer Dampfmaschine,
wodurch der Dampfcylinder an einer fixirten hohlen Kolbenstange bewegt wird, und
wobei diese hohle Kolbenstange sowohl als Einfuͤhrungs-, denn als
Ausfuͤhrungsgang fuͤr den Dampf dient.
Fig. 17 ist
ein Fronteaufriß einer nach meiner Erfindung erbauten Maschine. Fig. 18 gibt einen
Seitenaufriß derselben, und Fig. 19 ist ein
Durchschnitt durch Fig. 17. Fig. 20, 21 und 22 zeigen der groͤßeren Deutlichkeit wegen mehrere Theile einzeln
fuͤr sich dargestellt. An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche
Buchstaben auch auf gleiche Gegenstaͤnde.
An die vier Eken der zwei rechtekigen Rahmen sind vier Saͤulen oder Pfosten
aa geschraubt, wodurch das Gestell gebildet
wird, auf welchem die Maschine ruht, d ist der
Dampfcylinder, dessen Dekel ee mit
Schlußbuͤchsen versehen sind, durch die die Kolbenstange f geht. Diese Kolbenstange ist hohl, wie der
Durchschnitt in Fig. 19 zeigt, und dient sowohl als Eintritts-, denn als
Austrittsroͤhre des Dampfes aus dem Cylinder.
An der Kolbenstange f ist der Kolben d, Fig. 19, befestigt, und
dieser Kolben ist den allgemein gebraͤuchlichen aͤhnlich, mit dem
Unterschiede jedoch, daß die Klappen h und i, welche dem Dampfe gegen den Dampfcylinder hin und von
demselben weg zu stroͤmen gestatten, daran angebracht sind. Die
Dampfroͤhre j fuͤhrt von dem Kessel her,
und steht bei k mit der hohlen Kolbenstange f in Verbindung.
An dem oberen oder Scheitelende der Kolbenstange befindet sich eine
Schlußbuͤchse in derselben, durch welche die Stange l geht, die an der Klappe oder dem Ventile m
befestigt ist, und mittelst welcher diese Klappe durch den Hebel n oder o von ihrem Size emporgehoben werden
kann. Der Hebel n hat seinen Stuͤzpunkt in q; der Hebel o hingegen ist
gebogen; das eine Ende desselben ist unter einem rechten Winkel gebogen, und unter
dem Hebel n bei p
festgemacht, so daß er bewirkt, daß die Klappe m auf
ihrem Size ruht, wenn nicht durch die an der Hauptwelle r angebrachten Wischer 2 und 3, oder durch ein Herabdruͤken des
Hebels n mit der Hand darauf gewirkt wird.
Die Hauptwelle r dreht sich in vier Zapfenlagern s, und ist mit zwei Kurbeln oder Winkelhebeln t ausgestattet, welche durch die Verbindungsstangen, die
an dem Gestelle, an welchem sich der Dampfcylinder d
befindet, befestigt sind, in Bewegung gesezt werden. Dieses Gestell, welches eine
Wiege (cradle) genannt wird, besteht aus einem starken,
vierekigen Rahmen v, und in diesem Rahmen ist der
Cylinder durch die an dessen beiden Seiten befindlichen Zapfen w befestigt, so daß, ohne daß der Cylinder in Unordnung
geraͤth, eine leichte Bewegung hervorgebracht werden kann. Der Cylinder wird
sich auf diese Weise frei senkrecht an der Kolbenstange bewegen koͤnnen,
selbst wenn einige Theile nicht ganz genau seyn sollten; ein Umstand, der nicht
Statt finden koͤnnte, wenn das Gestell diese leichte Bewegung nicht
zuließe.
An den Seitentheilen xx der Wiege oder der Rahmen
vv sind Achsen oder Zapfen yy angebracht, an denen die Verbindungsstangen u, und auch die Reibungsraͤder zz befestigt sind. Auch diese Zapfen oder Achsen
yy lassen eine leichte Bewegung zu, ohne daß
der Dampfcylinder dadurch verruͤkt wird; diese Bewegung, die zu demselben
Zweke dient, wie die fruͤher beschriebene, erfolgt jedoch hier in
entgegengesezter Richtung.
Vor und hinter dem Cylinder D sind zwei senkrechte
Fuͤhrer oder Leiter 44 angebracht, zwischen denen sich das Rad zz bewegt, wie aus einem Blike auf Fig. 17 und 18 erhellen
wird.
Fig. 20 zeigt
den Kolben g fuͤr sich allein dargestellt, und
Fig. 21
ist ein metallener Ring, der innerhalb oder außerhalb der Nuͤsse des Kolbens
herabgeschraubt wird, damit er nicht abgehen kann.
Fig. 22
stellt die einzelnen Theile der Kolbenstange im Durchs schnitte dar, und zugleich
auch die Art und Weise, auf welche der Kolben damit verbunden ist. Man wird aus
dieser Figur ersehen, daß die Kolbenstange aus zwei Roͤhren besteht, von
denen jede mit einem Randstuͤke ausgestattet ist, mit Huͤlfe dessen
die Roͤhre mittelst Schrauben an dem Kolben festgemacht ist.
Ich muß hier bemerken, daß das Flugrad an einer Maschine, welche bloß einen Cylinder
hat, belastet werden muß, um dem Dampfcylinder
d das Gleichgewicht zu halten. In allen Faͤllen
hingegen, in welchen zwei Cylinder vorhanden sind, koͤnnen dieselben offenbar
so an der Hauptwelle angebracht werden, daß jeder Cylinder dem anderen zum Theil das
Gleichgewicht haͤlt, die Maschine mag mit hohem oder niederem Druke
arbeiten.
Ich will nun erklaͤren, auf welche Weise die Maschine arbeitet, und hierbei
annehmen, der Dampf werde in der Dampfroͤhre j
von einem Dampfkessel hergeleitet, und der an der Hauptwelle r befindliche Wischer 3 wirke auf den Hebel o.
Dadurch wird naͤmlich die Klappe m durch die
Stange l von ihrem Size emporgehoben, so daß der Dampf
in die hohle Kolbenstange und aus dieser zwischen dem oberen Dekel des
Dampfcylinders und dem stritten Kolben durch die Klappe h in den Dampfcylinder gelangen kann. Diese Klappe besteht naͤmlich
aus zwei abgeschliffenen, an einer und derselben Spindel befestigten Platten, und
diese Spindel bewegt sich durch Fuͤhrungs- oder
Leitungsloͤcher, welche sich, wie Fig. 20 zeigt, in Stegen
befinden, die quer uͤber die Oeffnungen in dem Kolben g laufen.
Wenn nun der obere Dekel oder Boden des Dampfcylinders die Klappe auf diese Weise auf
ihren unteren, gleichfalls abgeschliffenen Siz herabgedruͤkt hat, so ist der
obere Theil der Klappe zum Behufe des Ueberganges des Dampfes aus der Kolbenstange
in den oberen Theil des Cylinders geoͤffnet, wodurch dieser Cylinder
veranlaͤßt wird, sich so lange von dem fixirten Kolben zu entfernen, bis der
untere Dekel oder Boden des Cylinders mit der Spindel der Klappe h in Beruͤhrung kommt, und dadurch
veranlaͤßt, daß der obere Theil verschlossen, die untere Klappe hingegen
geoͤffnet wird, damit der Dampf gegen die untere Seite des Kolbens
stroͤmen, und den Dampfcylinder von dem fixirten Kolben auf diese Seite
druͤken kann.
Zu derselben Zeit, waͤhrend welcher die Klappe h
fuͤr den oberen Theil des Dampfcylinders verschlossen, fuͤr den
unteren Theil desselben hingegen geoͤffnet ist, kommt die Klappe i mit dem unteren Dekel oder Boden des Dampfcylinders in
Beruͤhrung, und oͤffnet dadurch den oberen Theil dieser Klappe in
solcher Weise, daß der Dampf, der den oberen Theil des Cylinders bereits zum
Zuruͤkweichen von dem Kolben veranlaͤßt hat, in den unteren Theil der
hohlen Kolbenstange, und aus diesem, je nach der Einrichtung der Maschine, entweder
in den Verdichter oder in die freie Luft uͤbergeht. Wenn nun aber der obere
Dekel des Dampfcylinders neuerdings wieder mit den Klappen h und i in Beruͤhrung kommt, so wird
der Dampf auch wieder in den oberen Theil des Cylinders einstroͤmen, und auch
der Ausfuͤhrungsgang wird so geoͤffnet seyn, daß der Dampf von der unteren Seite des
Kolbens, den man in Fig. 19 in dieser Stellung steht, austreten kann. Zu bemerken ist, daß es
sehr gut ist, wenn die Spindeln der Klappen h und i mit Federn versehen sind, oder wenn fuͤr eine
sonstige hinreichende Reibung gesorgt wird, damit dem Schließen derselben vorgebaut
wird, wenn sie dadurch, daß die Dekel oder Boden der Cylinder mit ihnen in
Beruͤhrung kamen, in die gehoͤrigen Stellungen getrieben wurden.
Es wurde bereits gesagt, daß der Dampf durch die Klappe m
in die hohle Kolbenstange Zutritt erhaͤlt. Die fuͤr jede Seite des
Kolbens noͤthige Menge Dampf erhaͤlt dadurch Zutritt, daß die Wischer
2 und 3 mit dem Hebel o, der immer durch die Feder 5
herabgedruͤkt gehalten wird, in Beruͤhrung kommen. Die Menge Dampf,
welche bei jedem Stoße eintritt, wird also von der Zeit abhaͤngen,
waͤhrend welcher die Klappe m offen erhalten
wird, so daß mithin diese Menge durch die Laͤnge der Wischer 2 und 3 bestimmt
wird. Die Ausdehnung oder Laͤnge des Stoßes, waͤhrend welchem der
Dampf eintritt, und dann abgeschnitten wird, kann also so regulirt werden, daß der
Rest dieses Stoßes durch die Ausdehnung des Dampfes hervorgebracht wird.
Soll nun die Maschine in Gang gesezt werden, so wird der Hebel n mit der Hand herabgedruͤkt, wodurch die Klappe m geoͤffnet, und dem Dampfe der Zutritt in den
Cylinder gestattet wird. Aus Fig. 19 sieht man, daß
sich in der Kolbenstange f eine Scheidewand 6 befindet,
die diese Stange in zwei Theile theilt, von denen der eine als
Eintrittsroͤhre fuͤr den Dampf in den Cylinder, der andere oder untere
hingegen als Austrittsroͤhre fuͤr denselben dient.
Im Falle nun dieser Apparat an einer Dampfmaschine mit niederem Druke angewendet
werden soll, wird an dem unteren Theile der Kolbenstange eine Roͤhre
befestigt, welche in den Verdichter fuͤhrt; soll sie hingegen an einer
Hochdrukdampfmaschine ihre Anwendung finden, so wird eine in den Rauchfang des Ofens
oder in die freie Luft fuͤhrende Roͤhre daran angebracht.
Wenn die Maschine in Bewegung gesezt werden soll, so bewirke ich, daß der Bodendekel
des Dampfcylinders auf die Klappen h und i wirkt, indem ich das Flugrad so lange umdrehe, bis die
Kurbel beinahe auf den Punkt der Unthaͤtigkeit (dead
point) gebracht ist. Dadurch werden diese Klappen naͤmlich so
geoͤffnet, daß der Dampf durch beide Seiten des Kolbens stroͤmen, und
auf diese Weise den Cylinder erhizen wird.
Wenn die Maschine klein ist, so drehe ich die Kurbeln mittelst des Flugrades
uͤber den Punkt der Unthaͤtigkeit hinaus in der Richtung, in welcher
die Welle getrieben werden soll, wodurch die Klappen in die gehoͤrige Stellung
kommen werden. Sind die Maschinen jedoch groß, oder mit zwei Cylindern ausgestattet
(und besonders bei den Maschinen fuͤr den Seedienst), so muß man im Stande
seyn, die Stellung der Klappen h, i waͤhrend
jeder Periode des Stoßes andern zu koͤnnen, damit sich die Richtung der
Kurbeln an der Hauptwelle jederzeit gleich aͤndern laͤßt. In diesem
Falle bringe ich also an der Spindel der Klappen h, i
solche Stangen an, wie man sie in Fig. 19 durch punktirte
Linien angedeutet steht, und welche durch Schlußbuͤchsen gehen, die sich an
dem oberen Dekel der Dampfcylinder befinden. Diese Stangen verbinde ich an ihrem
oberen Ende durch einen gabelfoͤrmigen Hebel (Fig. 23), mit
Huͤlfe dessen sie dann gemeinschaftlich bewegt werden koͤnnen.
Wenn die Stellung der Klappen zum Behufe der Veraͤnderung der Richtung der
Kurbeln abgeaͤndert werden soll, so muß die Drosselklappe oder der Hahn,
welcher sich an der von dem Kessel herfuͤhrenden Roͤhre befindet,
geschlossen werden, damit der Zutritt des Dampfes unterbrochen und der Gang der
Maschine mithin angehalten wird. Dann muͤssen die mit den Klappen h, i in Verbindung stehenden Stangen durch den durch
punktirte Linien angedeuteten Hebel p nach
Umstaͤnden gehoben oder herabgesenkt werden, wodurch denn auch diese Klappen
gehoben oder gesenkt, und die Richtung der Bewegung des Dampfes und folglich auch
der Kurbeln veraͤndert werden, wobei jedoch, wenn man mit einer großen
einfachen Maschine zu thun hat, sorgfaͤltig darauf zu sehen ist, daß die
Kurbeln nicht an den Punkten der Unthaͤtigkeit angehalten werden. Damit nun
die Wischer zu jeder Zeit, zu welcher die Maschine angehalten (backed) werden soll, schnell unter dem Hebel, o weggeschafft werden koͤnnen, sind die Wischer 2
und 3 an einer Roͤhre angebracht, welche sich an der Hauptwelle r schieben laͤßt, und an der sich zwei Paare von
Wischern befinden, so daß, wenn das eine Paar weggeschoben ist das andere
dafuͤr in eine solche Stellung kommt, daß es, wenn es noͤthig ist, in
Thaͤtigkeit gesezt werden kann.
Fig. 18 zeigt
die Mittel zur Bewegung der Wischer. An der erwaͤhnten Roͤhre befindet
sich naͤmlich ein Griff oder eine Klaue, in welche das eine Ende des Hebels
b eingreift. Wenn nun der Hebel b um seine Achse gedreht wird, so wird er die
Roͤhre, an der sich die Wischer befinden, laͤngs der Hauptwelle
treiben, waͤhrend das Umdrehen dieser Roͤhre durch eine Feder
verhindert wird: eine Einrichtung, die Jedermann deutlich seyn wird.
Obwohl ich nun die Kolbenstange hier als in einer senkrechten Stellung befestigt
beschrieben und abgebildet habe, so ist doch klar, daß dieselbe in gewissen Fallen
auch in horizontaler oder diagonaler Richtung angewendet werden kann. Ich nehme daher
keineswegs die verschiedenen einzelnen Theile der Maschine, welche bereits bekannt
sind, noch auch den besonderen Bau derselben in Anspruch, da dieser (obschon ich ihn
so, wie ich ihn angab, am zwekmaͤßigsten fand) verschieden abgeaͤndert
werden kann; meine Erfindung besteht vielmehr lediglich in der
eigenthuͤmlichen Einrichtung und der Verbindung der verschiedenen Theile
einer Dampfmaschine, in Folge deren der Dampfcylinder an einer fixirten hohlen
Kolbenstange in Bewegung gesezt wird, und in Folge deren diese Kolbenstange sowohl
als Eintritts-, denn als Austrittsroͤhre des Dampfes aus dem Cylinder
dient.
Tafeln