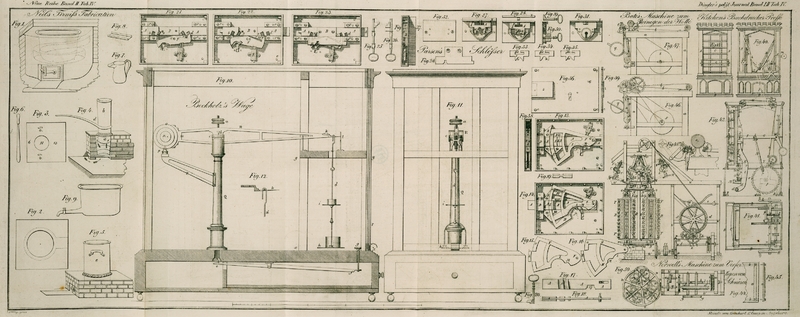| Titel: | Verbesserungen an den Buchdrukerpressen, worauf sich John Kitchen, Buchdruker von Newcastle-upon-Tyne, am 25. Jul. 1833 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 52, Jahrgang 1834, Nr. L., S. 250 |
| Download: | XML |
L.
Verbesserungen an den
Buchdrukerpressen, worauf sich John Kitchen, Buchdruker von
Newcastle-upon-Tyne, am 25. Jul. 1833 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of
Arts. Maͤrz 1834, S. 49.
Mit Abbildungen auf Tab. IV.
Kitchen's Verbesserungen an den
Buchdrukerpressen.
Die unter obigem Patente begriffenen Verbesserungen bestehen in
einer neuen Anordnung der verschiedenen Theile und Apparate
einer Maschine zum Abdruken von Lettern, Holzbloͤken,
oder anderen erhabenen Oberflaͤchen. Bei dieser neuen
Anordnung der Theile befindet sich naͤmlich die Tafel
oder die Flaͤche, auf welcher die Form der Lettern, der
Holzbloͤke etc. ruht, oder gegen welche sie sich stemmt,
in senkrechter Stellung, waͤhrend die Stellung der Form
mittelst Zahnstangen und Getrieben regulirt wird. Die Form wird
geschwaͤrzt, indem vor derselben mittelst Fuͤhrern
und Rollen eine elastische Walze in senkrechter Richtung auf und
nieder bewegt wird. Der Tiegel (platten) mit dem Dekel (tympan) und dem Rahmen, der das zu bedrukende Papier
enthaͤlt, wird mittelst sogenannter Schwingarme, die sich
an Zapfen bewegen, in Beruͤhrung gebracht; der Tiegel
wird naͤmlich, wenn der Druk zu geschehen hat, gegen die
Tafel und die Form empor gebracht, waͤhrend man ihn
hingegen zuruͤkfallen laͤßt, wenn das Blatt
Papier, nachdem es bedrukt worden, wieder entfernt und durch ein
neues ersezt werden soll.
Die Kraft, die den Druk ausuͤbt, wirkt mittelst
gegliederter Hebel, welche durch einen Winkelhebel und
eine Stange in Bewegung gesezt werden, wie man aus den
beigefuͤgten Figuren ersehen wird. Fig.
40 ist naͤmlich ein Fronteaufriß der
verbesserten Maschine; Fig.
41 ist ein Grundriß oder ein horizontaler Durchschnitt
der unteren Theile der Maschine. Fig.
42 ist ein Laͤngendurchschnitt der Maschine
nach der in Fig.
40 gegebenen Stellung. Fig.
43 endlich ist ein Endaufriß.
Die ganze Maschinerie befindet sich in einem Gestelle aus
Gußeisen oder aus einem anderen geeigneten Materiale, welches
aus vier ekigen Saͤulen A, A,
die auf der Basis B, B ruhen,
besteht. Die Tafel fuͤr die Form der Lettern besteht aus
einer diken eisernen Platte C, C,
welche an der hinteren Flaͤche mit starken eisernen
Baͤndern oder Klammern versehen ist, um ihr auf diese
Weise groͤßere Festigkeit zu geben. Diese Tafel ist
senkrecht gestellt, und wie Fig.
42 und 43
zeigt, an dem Gestelle befestigt. Die Befestigung geschieht
mittels Schraubenbolzen, welche durch Loͤcher in den
Saͤulen des Gestelles gehen, und welche, wie aus Fig. 42 ersichtlich ist, durch die Theile z, z, z eine kleine Regulirung
zulassen. An der vorderen Flaͤche der Tafel C ist der Rahmen, welcher die
Letternform enthaͤlt, mittelst angeschraubter Klammern
a, a, die man aus Fig. 44 und 45
sieht, festgemacht. Diese Klammern sind an stellbaren
Schieberzahnstangen b angebracht,
und diese Zahnstangen koͤnnen durch Getriebe, die sich an
der Welle c befinden, in Fenstern
oder Spalten der Tafel auf und nieder bewegt werden. Die Welle
c erstrekt sich, wie Fig. 42 und 43
zeigt, quer hinter dem Ruͤken der Tafel.
Der sogenannte Tiegel D besteht aus
einer diken Eisenplatte, welche auf den vibrirenden Armen oder
gekruͤmmten Hebeln EE,
die sich um die Zapfen d drehen,
aufgezogen sind. Die vordere Flaͤche dieses Tiegels wird
mit einem Tuche oder mit Filz bedekt, und in eine Furche, welche
in der Naͤhe der Raͤnder rings um die
Flaͤche desselben laͤuft, ist ein leichtes,
eisernes Gestell, in welches der sogenannte Dekel aus Pergament
oder aus Cannevaß fuͤhrt, eingelassen. Dieser Rahmen wird
mittelst der Daumenschrauben f an
dem Tiegel befestigt, und dadurch wird der Dekel fest und glatt
uͤber die Oberflaͤche gespannt, so daß er sich
nicht runzeln kann. Auch der Rahmen h besteht aus einem leichten eisernen Gestelle,
welches, wie Fig.
40 zeigt, durch gegliederte Hebel i und g
an dem Tiegel festgemacht ist, und welches, wenn es geschlossen
wird, rings um den Rand des Tiegels zu liegen kommt. Die
Drukhebel sind am Ruͤken des Tiegels angebracht, und
bestehen aus einer Stange oder aus einem Hebel F, der an dem einen Ende durch den
Stift k mit dem Tiegel, an dem
anderen Ende hingegen durch den Stift l mit den beiden Stangen oder Hebeln G, H in Verbindung steht, wodurch
ein sogenanntes Knebelgefuͤge (toggle-joint) gebildet wird. Her Hebel G dreht sich um eine starke Welle
m, die gleichsam dessen
Stuͤzpunkt bildet, und in den Saͤulen des
Gestelles aufgezogen ist, indem deren Enden in verschiebbare
Bloͤke n eingelassen sind.
Diese Bloͤke lassen sich so stellen, daß man den Druk
oder die Kraft der Knebelgefuͤge abaͤndern kann,
je nachdem man die Keile o, die von
Oben durch Schrauben in Bewegung gesezt werden, emporhebt oder
herabsenkt. An dem aͤußeren Ende des Hebels G ist ein Gegengewicht angebracht.
Der Hebel H ist eine
Krummhebelstange, welche mittelst eines Zapfens p an der Seite des großen Rades I befestigt ist. Durch die Umdrehung
dieses Rades wird die Stange H
emporbewegt, damit die Hebel F und
G auf diese Weise in horizontale
Stellung gerathen, sobald der Druk ausgeuͤbt werden soll.
Das Rad I wird durch einen Triebstok
K, der sich an der Welle J befindet, getrieben, und diese
Welle wird durch eine Kurbel und ein Flugrad L, welches man in Fig.
41 am deutlichsten sieht, in Bewegung gesezt. Dieß
entspricht der gewoͤhnlichen Bewegung des Kurbelgriffes
an den gewoͤhnlichen Drukerpressen, in denen sich die
Tafel und die Form in horizontaler Richtung hin und her bewegen.
Man kann die Maschine uͤbrigens auch durch einen an der
Welle J befestigten Rigger, und
durch ein von einer Dampfmaschine herlaufendes Band in Bewegung
sezen.
Den Schwaͤrzungsapparat, durch welchen die Schwarze auf
die Lettern aufgetragen wird, sieht man am besten aus dem
Durchschnitte Fig.
42. M ist hier
naͤmlich ein Behaͤlter, welcher quer durch die
Maschine laͤuft, und dessen oberer Theil einen Trog, in
welchem die Schwaͤrze enthalten ist, bildet. In diesen
Trog taucht zum Theil eine Walze N
aus Eisen oder aus einem anderen Metalle unter, welche Walze man
die Trog- oder Leitungswalze (ductor roller) zu nennen pflegt. Diese Walze dreht
sich in dem Schwaͤrztroge mittelst einer Rolle mit dreien
Furchen, die sich an dem Ende ihrer Achse befinden, und diese
Achse wird durch ein Laufband, welches von einer an der Achse
des großen Rades I befindlichen
Seilleitungsrolle mit 3 Kehlen herlaͤuft, getrieben.
Laͤngs der Fronte des Schwaͤrztroges ist ein
Metallstreifen angebracht, durch welchen alle
uͤberfluͤssige Schwarze von der Oberflaͤche
der Trogwalze abgestreift wird. Der Behaͤlter M kann unten zum Behufe der
Regulirung der Temperatur der Schwarze mit heißem oder kaltem
Wasser gefuͤllt werden. Ueber der Trogwalze ist eine
andere Walze O angebracht, welche
aus einem elastischen Materials verfertigt ist, und die die
Schwaͤrze von der Trogwalze auf die naͤchst obere
Walze, die sogenannte Vertheilungswalze P uͤbertraͤgt. Die
Achse der Walze O ist an einem
Schwunghebel s, der in Fig. 42 durch punktirte Linien angedeutet ist,
aufgezogen. An dem entgegengesezten Ende dieses Hebels befindet
sich ein Gewicht, durch welches die Walze O uͤber die Trogwalze empor gehalten wird,
ausgenommen der Tiegel D und seine
Arme E befinden sich in der aus Fig. 42 ersichtlichen drukenden Stellung, wo dann das
Ende einer Schraube oder eines Stiftes r, der an dem Arme E
angebracht ist, auf einen senkrechten Arm t, der unter rechten Winkeln aus dem Hebel s hervorragt, trifft. Dadurch wird
der Arm vorwaͤrts getrieben, und dadurch wird bewirkt,
daß die Walze O herab und mit der
Trogwalze in Beruͤhrung kommt, wo sie sich dann in Folge
der Reibung dreht und mit Schwaͤrze versehen wird.
Die Vertheilungswalze P besteht aus
Holz, und erhaͤlt die Schwaͤrze von der Walze O, wenn sich der Arm E zuruͤkzieht, indem hiedurch
dem Hebel mit der Walze O gestattet
wird, emporzusteigen, und diese leztere Walze mit der Walze P in Beruͤhrung zu bringen.
An dem Ende der Achse der Walze P
befindet sich eine Rolle; die Walze selbst wird dadurch
umgedreht, daß von einer an der Haupttreibwelle J befindlichen Seilleitungsrolle ein
Laufband an ihre Rolle laͤuft. Außer dieser drehenden
Bewegung wird diese Walze P aber
auch noch mittelst irgend einer der gewoͤhnlichen
Vorrichtungen hin und her bewegt, damit die Schwaͤrze
gleichmaͤßiger uͤber die Oberflaͤche dieser
Walze vertheilt werde. Ueber der Vertheilungswalze befindet sich
die elastische Speisungswalze Q,
welche bestaͤndig mit der Walze P in Beruͤhrung ist. So wie die
Vertheilungswalze daher Schwaͤrze mitgetheilt
erhaͤlt, so gibt sie dieselbe an die Oberflaͤche
der ober ihr befindlichen Speisungswalze ab; diese traͤgt
die Schwaͤrze ihrerseits wieder auf die
Schwaͤrzwalze R uͤber,
so oft sie mit derselben in Beruͤhrung kommt. Die Art und
Weise, auf welche die Schwaͤrzwalze R an der Flaͤche der
Letternform auf und nieder bewegt wird, soll nun beschrieben
werden.
Die Enden der Achse dieser Schwaͤrzungswalze R drehen sich in kleinen
Buͤchsen S, welche man in
Fig.
40 sieht, und welche sich auf den senkrechten
Fuͤhrstangen T auf und nieder
bewegen. An jeder dieser Schieberbuͤchsen ist eine Schnur
U festgemacht, und diese
Schnuͤre laufen oben uͤber die Rollen V, V, die sich an dem Scheitel der
Maschine befinden, und hierauf abwaͤrts uͤber die
Rollen W, W, die an der Welle X angebracht sind. Diese Welle X wird durch ein an der Hauptwelle
T befindliches Zahnrad Y getrieben, indem dieses Rad in ein
aͤhnliches Zahnrad Z, welches
sich an der Welle X befindet,
eingreift. Dieses leztere Rad Z
laͤuft lose an der Welle, und kann daher das Rad Y nur dann in Bewegung sezen, wenn
es mittelst der Klauenbuͤchse w an seine Welle gesperrt ist. Diese
Klauenbuͤchse kann durch irgend einen der Mechanismen,
deren man sich gewoͤhnlich zu diesem Behufe bedient, in
gewissen Zeitraͤumen hin und her geschoben werden. Der
Patenttraͤger bedient sich zu diesem Behufe zweier
Klopfer, die aus der Welle p des
großen Rades I hervorragen, und
welche, so wie sich die Welle umdreht, abwechselnd auf einen
Hebel x wirken, der mit der
Klauenbuͤchse in Verbindung steht, und dieselbe in
gewissen Zeitraͤumen hin und her bewegt, so daß mithin
das Rad Z, je nachdem es
noͤthig ist, an die Achse X
gesperrt oder davon befreit wird.
Diese Presse arbeitet nun auf folgende Weise. Wenn die Form
senkrecht und auf die beschriebene Weise auf die Tafel in dem
Gestelle gebracht, und der Tiegel D
zuruͤkgestoßen worden, so richtet der Druker das Blatt
Papier auf den Dekel der vorderen Flaͤche des Tiegels,
und schließt, um das Blatt zu fixiren, den Rahmen, indem er den
Griff eines rechtwinkeligen Hebels g, der sich um einen an dem unteren Theile des Tiegels
befindlichen Zapfen dreht, herabdruͤkt. Dadurch und mit
Huͤlfe eines anderen Leitungshebels gelangt der Rahmen
auf die vordere Flaͤche des Dekels. Nachdem die Lettern
vorher geschwaͤrzt worden, bringt der Druker seine
Haͤnde an die Kurbel des Flugrades L, und versezt, indem er sie umdreht, das Rad I mit der Stange H in jene Stellung, die man in Fig. 42 ersieht, und bei welcher jener Zeitpunkt
Statt findet, in welchem die Hebel F
und G horizontal zusammentreffen,
und in welchem der Tiegel, auf dem sich das zu bedrukende Blatt
Papier befindet, mit großer Gewalt gegen die Letternform gedrukt
wird, um auf diese Weise einen Abdruk derselben zu erhalten.
Durch die weitere Umdrehung der Welle J gelangen die Hebel wieder in die aus Fig.
40 ersichtliche Stellung, in welcher der Tiegel
zuruͤkgezogen ist; nun wird der Rahmen geoͤffnet,
das bedrukte Blatt herausgenommen, und ein neues dafuͤr
eingelegt, womit die Operation dann wieder aufs Neue
beginnt.
Waͤhrend der Tiegel in die aus Fig.
40 ersichtliche Stellung zuruͤk sinkt, kommt
einer der an der Achse p
befindlichen Klopfer mit dem Hebel x
in Beruͤhrung, und treibt denselben in jene Stellung, in
der das Rad und die Welle X an
einander gesperrt werden. Diese Welle dreht sich folglich nun
um, die Rollen W, W winden die
Strike u, die mit den Wagen S der Schwaͤrzwalze R in Verbindung stehen, auf, und die
Schwaͤrzwalze wird mithin auf den senkrechten
Fuͤhrstangen T
hingefuͤhrt. Da nun der Umfang der Walze hiebei mit den
Lettern in Beruͤhrung kommt, so werden die Lettern bei
dieser Operation geschwaͤrzt. So wie hingegen der andere
Klopfer auf den Hebel x trifft, so
wird derselbe nach der entgegengesezten Seite bewegt, so daß die
Klauenbuͤchse w mithin
zuruͤkgeschoben, und die Welle X von dem Rade Z befreit
wird. Das Gewicht der Schwaͤrzwalze und ihrer Wagen wirkt
nun auf die lose Achse X, dreht
dieselbe herum, windet die Strike von der Rolle W ab, und gestattet, daß die Walze
R in Folge ihrer Schwere in die
aus Fig.
42 ersichtliche Stellung herabgelangt, und daselbst
neuerdings wieder mit Schwarze versehen wird. Damit die Walze
R jedoch nicht zu rasch
herabrolle, steht mit einer der Rollen W ein Flugrad y in
Verbindung, welches durch den Widerstand, den es bei seinen
Umdrehungen durch die Luft erfaͤhrt, die Umdrehungen der
Rolle langsamer von Statten gehen macht, so zwar, daß die Walze
nur allmaͤhlich herabgelangt.
Die Hauptvortheile, welche der Patenttraͤger seiner Presse
beilegt, und welche seiner Ansicht nach ohne Zweifel durch
dieselbe erreicht werden, sind: daß alle ihre Theile einen hohen
Grad von Festigkeit gewaͤhren; daß sie einen
verhaͤltnißmaͤßig kleinen Raum einnimmt, obschon
selbst das groͤßte Format in ihr gedrukt werden kann; daß
sich durch einen sehr geringen Kraftaufwand eine große Gewalt
erzielen laͤßt; daß in Folge der senkrechten Stellung und
Fixirung der Form die Lettern weniger Neigung haben,
herauszufallen, und daß die Bogen in Folge der Stellung des
Tiegels und des Rahmens durch die moͤglich kleinste
Bewegung an die Lettern gebracht werden koͤnnen.
Als seine Erfindung erklaͤrt der Patenttraͤger 1)
die senkrechte Stellung der Form; 2) die Art und Weise, auf
welche der Druk durch die zusammengesezten Hebel in Verbindung
mit dem großen Kurbelrade und seinem Getriebe ausgeuͤbt
wird; 3) die Methode den Rahmen von dem Tiegel zuruͤk und
in eine schiefe Stellung zu bringen; 4) die Umgebung des
Schwarztroges mit heißem oder kaltem Wasser zum Behufe der
Regulirung der Temperatur der Schwaͤrze; 5) den Apparat,
wodurch das Herabrollen der Schwaͤrzwalze langsamer
gemacht wird. und 6) die ganze Zusammenstellung der
Maschine.
Die Drukerpresse des Patenttraͤgers, bemerkt Hr. Newton, uͤbertrifft alle mir
bekannten Pressen an Festigkeit und Einfachheit. Sie nimmt nur
einen horizontalen Raum von 4 Fuß 6 Zoll auf 3 Fuß 6 Zoll ein,
waͤhrend sie in der Hoͤhe 7 Fuß 6 Zoll mißt; dabei
ragt keiner ihrer Theile uͤber diese Dimensionen hinaus.
Die Maschine schwaͤrzt selbst, und mit Huͤlfe
eines Mannes, der die Bogen einlegt, und eines Knaben, der sie
ausnimmt, koͤnnen in derselben mit
Leichtigkeit in jeder Stunde 500 Exemplare der groͤßten
Zeitung gedrukt werden. Wird die Maschine durch Dampf getrieben,
so kann ein Arbeiter leicht in einer Stunde 600 Exemplare
liefern. Die ganze Maschine wiegt nicht uͤber 1 1/2
Tonnen, und kostet nur 150 Pfd. Sterl. Ich sah eine solche
Presse, mit welcher das Newcastle Journal gedrukt wird, in Gang,
und mit einer anderen wird, wie ich hoͤrte, eine große
Zeitung zu Bradford in Yorkshire gedrukt.
Tafeln