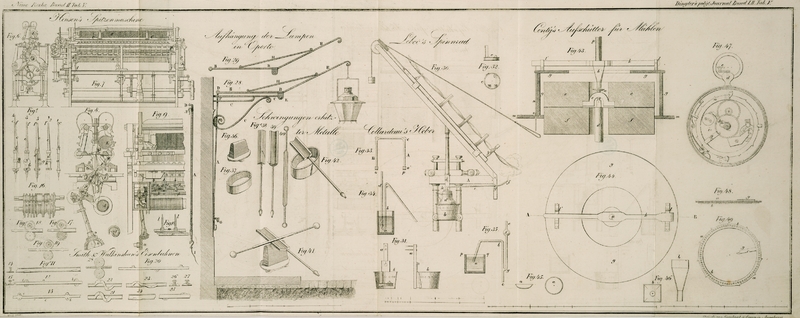| Titel: | Bericht des Hrn. Bussy über einige Heber des Hrn. Collardeau zu Paris, rue du Fabourg-Saint-Martin No. 56. |
| Fundstelle: | Band 52, Jahrgang 1834, Nr. LXVII., S. 368 |
| Download: | XML |
LXVII.
Bericht des Hrn. Bussy uͤber einige Heber des Hrn.
Collardeau zu Paris, rue du Fabourg-Saint-Martin
No. 56.
Aus dem Bulletin de la
Société d'encouragement. November
1833, S. 383.
Mit Abbildungen auf Tab. V.
Bussy's Bericht uͤber einige
Heber.
Hr. Collardeau hat der Société
d'encouragement eine kleine Broschuͤre
uͤberreicht, in welcher 15 verschiedene Arten von Heber,
die er in seiner Fabrik verfertigt, beschrieben sind. Die
meisten dieser Heber sind nur Modificationen der bereits
bekannten Heberarten, von denen einige allerdings vortheilhafter
eingerichtet sind; einige derselben sind auch bereits in einem
fruͤheren Berichte des Hrn. Hachette
Polyt. Journ. Bd. XIV.
S. 59.
gehoͤrig gewuͤrdigt worden. Besondere
Aufmerksamkeit scheinen uns jedoch nachtraͤglich noch
folgende vier Arten von Heber zu verdienen.
1) Heber mit doppelter Verschließung.
(Siphon à double
obturateur.) Dieser Heber, welcher aus Eisenblech
gearbeitet, und hauptsaͤchlich zum Umfuͤllen von
Oehlen oder alkoholischen Fluͤssigkeiten bestimmt ist,
besteht, wie Fig.
33 zeigt, aus zwei senkrechten Armen A, B von beinahe gleicher
Laͤnge, welche durch einen dritten, horizontalen Arm mit
einander verbunden sind. Die beiden Muͤndungen desselben
sind mittelst zweier beweglichen Verschließer o, o', welche an zwei Eisendrahten,
die sich in den Armen A und B schieben, angebracht sind,
verschlossen. Will man nun diese Eisendrahte emporziehen, und
folglich die Muͤndungen der Arme A, B verschließen, so schiebt man eine Art von
hoͤlzernem Keil unter die Woͤlbung oder unter den
Bogen C, den die Draͤhte
dadurch bilden, daß sie sich uͤber dem horizontalen Arme
mit einander vereinigen. Will man die Verschließer hingegen
oͤffnen, so entfernt man den Keil, und druͤkt mit
der Hand auf die Woͤlbung C,
damit die Draͤhte wieder herabsteigen. Einer der
Verschließer o' hat in der Mitte ein
Loch, welches man mit einem gewoͤhnlichen
Korkstoͤpsel nach Belieben verschließen oder
oͤffnen kann.
Wenn dieser Heber angestekt werden soll, so kehrt man denselben
so um, daß seine beiden Muͤndungen nach Oben gerichtet
sind, und oͤffnet die Muͤndung o, waͤhrend man die mit dem
durchloͤcherten Verschließer versehene Muͤndung
o' verschließt. Durch diese
leztere Muͤndung gießt man hierauf die
Fluͤssigkeit ein; ist sie bei o angelangt, so verschließt man diesen Verschließer,
und faͤhrt so lange fort Fluͤssigkeit
nachzugießen, bis der Heber bis zu p
voll ist, wo man dann die Muͤndung p mit einem Korkstoͤpsel verschließt, und den
Heber zum Behufe des Umfuͤllens umkehrt. Ist der Heber
auf diese Weise an Ort und Stelle gebracht, so oͤffnet
man die beiden Verschließer, damit die Fluͤssigkeit
ausfließen kann.
2) Heberpumpe. (Siphon-pompe.) Dieser Heber gewaͤhrt den
Vortheil, daß man den Heber anfielen kann, indem man im Inneren
desselben mittelst der Pumpe einen luftleeren Raum erzeugt, und
daß man, wenn der Unterschied zwischen den beiden Niveau's nicht
mehr so groß ist, daß dadurch ein Ueberstroͤmen bewirkt
wird, diesem Umstande durch die Pumpe abhelfen kann. Diese Art
von Heber findet vorzuͤglich beim Umfuͤllen des
Weines aus einem Fasse in ein anderes seine Anwendung, wenn
sich beide Faͤsser, wie dieß meistens der Fall ist, in
gleicher Hoͤhe befinden.
3) Einblasheber. (Siphon d'insufflation.) Dieser
Heber, der nichts weiter als eine modificirte Anwendung des
bekannten Einblasgefaͤßes des Hrn. Gay-Lussac ist, verdient theils wegen der
großen Einfachheit seines Baues, theils wegen der Leichtigkeit,
mit der er in Thaͤtigkeit gesezt werden kann, besondere
Empfehlung. Chemiker und Fabrikanten, welche oft aͤzende
Fluͤssigkeiten umfuͤllen muͤssen, werden
die Vortheile dieses Einblashebers besonders zu schaͤzen
wissen. Er ist aus Glas verfertigt, und besteht: 1) aus einer
gewoͤhnlichen heberartig gebogenen Glasroͤhre b, c, e, Fig.
34, mit dem Unterschiede jedoch, daß der kurze Arm b, c an seinem Ende einen Haken a bildet, so daß, wenn der Heber
arbeitet, die Muͤndung dieses kuͤrzeren Armes nach
Oben gekehrt und erweitert ist; 2) aus einer glaͤsernen
Roͤhre d, welche momentan zum
Anfielen des Hebers dient. Diese Roͤhre hat an dem einen
Ende eine Anschwellung, und paßt mit ihrem Ende ziemlich genau
auf die Muͤndung des kleinen Armes b, c des Hebers. Um nun den Heber in
Thaͤtigkeit zu sezen, taucht man den Arm b, c in das Gefaͤß, bringt
hierauf die mit der Fluͤssigkeit gefuͤllte
Roͤhre d an, und bewirkt
durch ein leichtes Einblasen in diese Roͤhre, daß die in
ihr enthaltene Fluͤssigkeit in dem Arme b bis c
emporsteigt. Der Heber ist nun hiemit angestekt; man nimmt die
Roͤhre d ab, wo die
Fluͤssigkeit dann dessen ungeachtet durch die
Muͤndung e ausfließt. Dieser
Apparat ist so einfach, daß sich ihn sogar jeder Lehrling in der
Chemie selbst verfertigen kann.
4) Sicherheits-Saugheber. (Siphon d'aspiration de
sûreté.) Auch diese Art von Heber, die
man in Fig.
35 abgebildet sieht, kann in chemischen Laboratorien
und Fabriken bei Arbeiten, bei denen man es mit scharfen und
aͤzenden Fluͤssigkeiten zu thun hat, mit großem
Vortheile angewendet werden. Man stekt denselben an, indem man
an der Roͤhre e, g, welche
parallel an den laͤngeren Arm b,
c geschmolzen ist, saugt. An dem oberen Theile dieser
Roͤhre ist eine Kugel f
geblasen, welche hindert, daß die Fluͤssigkeit, die aus
dem Gefaͤße p, q emporsteigt,
unmittelbar in den Mund gelangt.
Tafeln