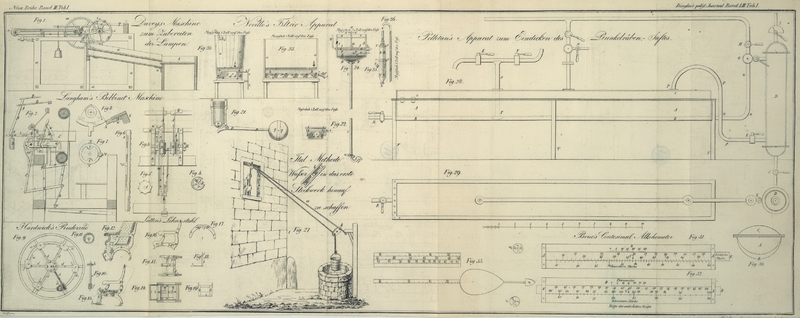| Titel: | Verbesserter Apparat zum Klären und Filtriren von Wasser und anderen Flüssigkeiten, worauf sich James Neville, Mechaniker von Great Dover Road, Grafschaft Surrey, am 9. Sept. 1831 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 53, Jahrgang 1834, Nr. VIII., S. 34 |
| Download: | XML |
VIII.
Verbesserter Apparat zum Klaͤren und
Filtriren von Wasser und anderen Fluͤssigkeiten, worauf sich James Neville, Mechaniker von
Great Dover Road, Grafschaft Surrey, am 9. Sept.
1831 ein Patent ertheilen ließ.Eine kurze Andeutung dieses Patentes gaben wir schon, im Polyt. Journ. Bd. XLV. S. 265, zur weiteren
Aufklaͤrung war jedoch noch diese Beschreibung durchaus nothwendig.A. d. R.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Junius
1834, S. 347.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Verbesserter Apparat zum Klaͤren und Filtriren von Wasser
und anderen Fluͤssigkeiten.
Fig. 20 ist
ein senkrechter Durchschnitt meines verbesserten Apparates zum Klaͤren und
Filtriren des Wassers, und zwar in einem Maßstabe von 1 Zoll auf 1 Fuß. a, a ist ein Gefaͤß oder ein Faß oder irgend ein
anderer Behaͤlter aus Holz oder einer anderen geeigneten Substanz, auf dessen
Boden b, b ich die Schuͤssel c, c anbringe. Diese Schuͤssel besteht aus
poroͤser oder unglasirter Toͤpferwaare, hat eine abgestuzt
kegelfoͤrmige Gestalt, und ist mit ihrer Muͤndung nach Abwaͤrts
gekehrt. In dem Rande oder der Muͤndung dieser Schuͤssel befinden sich
mehrere Auskerbungen, durch welche das geklaͤrte Wasser frei hindurch treten
kann, und rund um diesen Rand herum kitte oder spanne ich einen Streifen starken
Filz d, d, damit nichts von den feineren Theilchen der
filtrirenden oder klaͤrenden Substanz in die Schuͤssel c gelangen kann. An dem Scheitel oder oberen Theile
dieser Schuͤssel communicirt die Roͤhre e
mit dem Inneren derselben, so daß das geklaͤrte Wasser aus ihr abgelassen
werden kann. Diese Roͤhre e geht durch die
Seitenwand des Behaͤlters a, und ich leite sie,
wo es die Stellung des Behaͤlters immer moͤglich macht, so tief als
moͤglich herab, um auf diese Weise einen groͤßeren
atmosphaͤrischen Druk auf die in dem Behaͤlter befindliche
Fluͤssigkeit zu erhalten, und um hiedurch zu bewirken, daß eine
groͤßere Quantitaͤt Wasser durch das klaͤrende Medium getrieben
wird. Ich wende in
diesem Falle eine kleine Klappe f an, welche nach
Belieben gehoben werden kann, damit alle Luft, die ja in der herabsteigenden
Roͤhre e e enthalten ist, entweichen kann. Wo
diese Einrichtung jedoch nicht moͤglich ist, bediene ich mich bloß eines
gewoͤhnlichen Hahnes, der durch ein kurzes Rohr mit dem Inneren der
Schuͤssel c, c communicirt. Diese
Schuͤssel wird nun zuerst mit einer Schichte oder Lage groben Quarzkieses gg in einer Hoͤhe von zwei oder drei Zollen
umgeben, und oben auf diese Schichte kommt eine Lage vegetabilischer Kohle h, h, die in einer Muͤhle so weit wie grob
gemahlener Caffee gemahlen worden, und die zur Beseitigung aller in ihr enthaltenen
Unreinigkeiten wiederholt mit Wasser ausgesotten wurde. Diese Kohlenschichte reicht
einige Zoll hoch uͤber den Scheitel der Schuͤssel cc hinauf; sie muß fest eingedruͤkt und
oben geebnet werden. Oben auf sie wird ein Stuͤk diken wollenen Filzes
gelegt, und hierauf eine Schieferplatte i, i, die den
Umfang des Behaͤlters a, a beinahe
ausfuͤllt. Diese Schieferplatte i, i dient dazu,
daß das filtrirende Medium weder beim Reinigen des Apparates von dem darin
angesammelten Schlamme, noch bei dem schnellen Einstroͤmen des Wassers in den
Apparat aufgeruͤhrt werde; zugleich ist aber auch zwischen den
Raͤndern der Schieferplatte und den Waͤnden des Behaͤlters noch
so viel Raum uͤbrig gelassen, daß genug Wasser auf den Filz, der an die
Waͤnde des Behaͤlters gekittet oder genagelt ist, gelangen kann. Soll
der Apparat gereinigt werden, so braucht man nichts weiter, als ihn mit einem Besen
oder einer Buͤrste auszureiben, und das unreine Wasser dann durch den Hahn
k abfließen zu lassen.
Um den Zufluß des Wassers in diesen Apparat zu reguliren, wende ich, wo derselbe
durch eine Wasserleitungsroͤhre, oder von irgend einem Wasserbehaͤlter
her gespeist wird, eine Vorrichtung an, welche einfacher und in ihrer Wirkung
sicherer ist, als der gegenwaͤrtig gebraͤuchliche Kugelhahn. Diese
Vorrichtung ist in Fig. 20 bei l ersichtlich, und in Fig. 21 in
ihrer natuͤrlichen Groͤße im Durchschnitte abgebildet, mm ist eine metallene Roͤhre, in deren
Boden sich ein Loch von geringem Durchmesser befindet, so zwar, daß ein
gewoͤhnlicher Schusser so hineinpaßt, daß er ungefaͤhr zum dritten
Theile uͤber die Muͤndung dieses Loches hervorragt. Mit dem Gewinde
o, o steht der Hebel p,
p, an dessen Ende sich eine kleine hohle Kugel qq befindet, in Verbindung. Dieser Hebel mit der Kugel kann an dem Gewinde
o, o nach Belieben steigen und fallen, und sein
Gewicht muß hinreichen den Schusser n, n gegen den Druk
des in der Speiseroͤhre enthaltenen Wassers zu heben. Zugleich muß aber auch
die hohle Kugel q, q so viel Schwimmkraft besizen, daß
sie, wenn sie zur
Haͤlfte in Wasser untergetaucht ist, den Hebel p,
p hebt, und dadurch dem Schusser gestattet herabzusinken und das Loch in
dem Boden der Roͤhre zu verschließen. Auf diese Weise wird mithin die
Speisung des Apparates je nach Bedarf regulirt, und ich habe hier nur noch zu
bemerken, daß in das Innere der Roͤhre m, m eine
weibliche Schraube r, r geschnitten ist, durch welche
diese Roͤhre an irgend ein Wasserleitungsrohr geschraubt werden kann. Der
Schusser wird von dem Wasser nicht angegangen, und wird sich daher nie wegen
Corrosion oder Oxydation in dem Loche der Roͤhre festsezen.
Fig. 22 ist
ein Apparat, der an Wasserbottichen oder anderen Behaͤltern, die bereits
erbaut sind, in der Absicht, um das darin enthaltene Wasser zu reinigen, angebracht
werden kann. Er kommt im Principe ganz dem unter Fig. 20 beschriebenen
Apparate gleich; dieselben Buchstaben beziehen sich auch auf dieselben
Gegenstaͤnde; doch bezeichnet s hier einen
irdenen Topf von solchem Rauminhalte, daß das filtrirende Medium etc. darin Plaz
hat. Dieser Topf wird auf den Boden des Wasserbehaͤlters, der durch punktirte
Linien angedeutet ist, gestellt; die Communication mit der Schuͤssel c, c ist durch die Roͤhre t, t vermittelt.
In Fig. 23
sieht man eine Vorrichtung, wie sie sich zum Reinigen des Wassers im Großen, in
Fabriken z.B. eignet. Auf dem Boden des Wasserbehaͤlters aa ist eine gewisse Anzahl halbcylindrischer oder
bogenfoͤrmig gewoͤlbter irdener Gefaͤße u, u, u, u, u angebracht, welche der ganzen Laͤnge nach durch den
Wasserbehaͤlter laufen, und die an dem einen Ende saͤmmtlich durch die
Roͤhren v, v, v, v, v mit der Hauptroͤhre
e, e, aus der das klare Wasser abgelassen werden
kann, in Verbindung stehen. Auch diese Roͤhre soll, wie es in Fig. 20 angegeben worden,
so tief als moͤglich herabgeleitet werden, und nur wo dieß nicht
moͤglich ist, soll man eine Pumpe daran anbringen, um das Wasser in
groͤßerer Menge durch das klaͤrende Medium zu ziehen. In allen anderen
Beziehungen ist dieser Apparat dem unter Fig. 20 beschriebenen
vollkommen aͤhnlich, weßhalb sich denn alle Buchstaben auch auf dieselben
Gegenstaͤnde beziehen. Die untere Schichte g, g
besteht jedoch hier aus klein geschlagenem Sandsteine oder aus einem anderen
poroͤsen Gesteine, waͤhrend die Schichte h,
h aus zu gleichen Theilen vermengten Quantitaͤten feiner Kohle und
gut ausgewaschenem Sande besteht.
Fig. 24 zeigt
einen Durchschnitt eines Apparates zum Klaͤren von gemalzten
Fluͤssigkeiten, Oehlen etc. in großen Quantitaͤten; in dieser
Zeichnung kommen 3/4 Zoll auf den Fuß. A, A ist ein
gußeiserner, oder aus einem anderen Materiale verfertigter Behaͤlter, welcher
oben offen ist, waͤhrend er unten einen trichterfoͤrmigen Boden
B, B hat, von dessen Mittelpunkt aus die Roͤhre
C, C beilaͤufig 12 Fuß weit herabsteigt. D, D ist ein gußeiserner oder anderer Rost, oder ein
falscher, durchloͤcherter Boden, der auf den schraͤg zulaufenden
Seitenwaͤnden des Bodens B, B aufruht. Dieser
Boden wird mit einem messingenen (!) Drahtgewebe belegt, auf welches, dann eine
feine waschlederne Deke EE gebreitet wird. Auf
diese leztere wird dann eine Schichte reines Kohlenpulver F,
F gebracht, und hierauf dann ein Rahmen GG gelegt, der genau in das Innere des Behaͤlters AA paßt, und mit einem diken wollenen Filze bedekt
wird. Von der Mitte dieses Rahmens GG steigt die
sich umdrehende Welle H, H, an der eine Reihe von
Buͤrsten oder Umruͤhrern angebracht ist, empor. Diese Welle wird durch
die Rolle K, K oder auf irgend eine andere Weise in
Bewegung gesezt, und dadurch werden die in der Fluͤssigkeit enthaltenen
Unreinigkeiten gehindert, sich auf der Oberflaͤche des Filzes oder des
sonstigen Ueberzuges des Rahmens G G anzusammeln. L ist
eine Oeffnung mit einer Klappe, bei welcher der Bodensaz oder die Unreinigkeiten
entweichen koͤnnen, wenn es fuͤr nothwendig befunden werden sollte.
M ist eine Roͤhre, durch welche der Apparat
mit der zu reinigenden Fluͤssigkeit gespeist wird. Ist die
Fluͤssigkeit eine gegohrne malzhaltige, oder koͤnnte sie
uͤberhaupt dadurch, daß sie laͤngere Zeit der Luft ausgesezt wird,
Schaden leiden, so bediene ich mich des Schwimmers oder Dekels N, N, der genau in das Innere des Behaͤlters A, A paßt, und dessen Raͤnder mit Leder oder
einer anderen aͤhnlichen Substanz besezt sind, damit der Dekel luftdicht
schließt, ohne uͤbrigens in der Auf- und Niederbewegung
beeintraͤchtigt zu seyn. Die Welle HH geht
durch die Mitte des Dekels NN. OO ist eine kleine, mit einer Klappe versehene
Roͤhre, durch welche die in der Roͤhre C,
C und in dem unteren Theile des Behaͤlters enthaltene Luft
entweichen kann. Das untere Ende dieser Roͤhre C,
C ist, wie man bei P, P sieht,
gekruͤmmt, damit keine Luft eintreten kann, so lange sich die Vorrichtung in
Thaͤtigkeit befindet. Wenn die herabsteigende Roͤhre CC 12 Fuß lang ist, und wenn der Behaͤlter
AA 4 Fuß im Gevierte hat, oder wenn derselbe
eine Oberflaͤche von 16 Quadratfuß darbietet, so wird, wenn die Roͤhre
mit irgend einer Fluͤssigkeit von der specifischen Schwere des Wassers
gefuͤllt ist, und wenn der Hahn Q umgedreht wird, die atmosphaͤrische
Luft mit einem Gewichte von 5 Tonnen oder von beilaͤufig 11,600 Pfd. auf die
Oberflaͤche der in dem Behaͤlter AA
befindlichen Fluͤssigkeit druͤken, und dadurch wird in sehr kurzer
Zeit eine große Menge Fluͤssigkeit durch das klaͤrende Medium
getrieben werden. Die Kraft oder der Druk, den man auf diese Weise hervorbringt,
wird jederzeit von der Hoͤhe des Apparates oder von der Tiefe, bis auf
welche die Roͤhre CC herabsteigt, so wie
von dem specifischen Gewichte der Fluͤssigkeit, mit welcher man arbeitet,
abhaͤngen. Ich aͤndere diese Hoͤhe und den daraus sich
ergebenden Druk je nach der Natur der zu behandelnden Fluͤssigkeiten, und je
nach der Kraft, welche zur Klaͤrung großer Quantitaͤten erforderlich
ist, verschieden ab.
Fig. 25
stellt einen tragbaren Apparat zum Verfeinern und Klaren von Bier, Wein etc. vor; er
ist in ersterem Falle zum Gebrauche der Gastwirthe etc. bestimmt, und kann dann mit
den gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen Biermaschinen in Verbindung gebracht
werden, damit das Bier in kleinen Quantitaͤten und waͤhrend des
Abziehens und Ausschenkens vollkommen geklaͤrt wird (!!). RR ist ein cylindrisches Gefaͤß aus
Zinkblech oder irgend einem anderen geeigneten Materiale, dessen unterer Theil sich
in einen Kegel S, S endigt. Dieser Kegel ist gleich
einem Seiher durchloͤchert, und muß mit duͤnnem Waschleder
uͤberzogen werden. Sowohl der Cylinder, als der Kegel werden mit reinem
Kohlenpulver, welches auf die in Fig. 20 beschriebene
Weise zubereitet worden, gefuͤllt. Bei T, T
befindet sich ein Schraubengewinde an dem Cylinder, und auf dieses wird der
kegelfoͤrmige Dekel U, U geschraubt, nachdem man
vorher ein kreisrundes Stuͤk Waschleder auf das in dem Cylinder enthaltene
Kohlenpulver gelegt hat. An dem Boden des Cylinders R, R
und da wo der Kegel S, S beginnt, befindet sich ein
anderes Schraubengewinde V, V, an welches der
aͤußere Cylinder W, W geschraubt wird. Auch
dieser aͤußere Cylinder hat einen kegelfoͤrmigen Boden, an dessen
Spize sich eine Klappe X befindet, die zum Entfernen der
Unreinigkeiten dient, die sich allenfalls innerhalb des Cylinders ansammeln
moͤchten. An der Seite dieses Cylinders befindet sich ein Mundstuͤk
mit einem Schraubengewinde Y, an welchem das
Saug- oder Speiserohr, das zu dem Fasse oder zu dem Bottiche fuͤhrt,
angebracht wird. Oben am Scheitel des Kegels U, U
befindet sich eine Verbindungsschraube, durch welche die Roͤhre Z, die an die sogenannte Biermaschine fuͤhrt, mit
dem Apparate in Verbindung gesezt wird. Wenn es noͤthig ist, lasse ich auch
von mehreren Faͤssern aus Roͤhren an diesen Apparat, und von diesem an
die Pumpen der Biermaschinen laufen.
Soll der Apparat zum Klaͤren von Weinen verwendet werden, so wende ich statt
der Pumpe lieber die gleichmaͤßige Wirkung eines Hebers an, der, wie Fig. 26 zeigt,
an den Scheitel des Kegels U, U geschraubt wird. Der
herabsteigende Schenkel l, l dieses Hebers muß so lang
seyn, daß dadurch der gehoͤrige Druk der Fluͤssigkeit durch das
klaͤrende Medium erzeugt wird. In der Naͤhe des Bodens des Hebers
befindet sich ein Sperrhahn; auch muß alle Luft aus dem Heber und aus dem Apparate
ausgetrieben werden, bevor derselbe in Thaͤtigkeit treten kann. Der Heber muß
in das Faß, welches zur Aufnahme der geklaͤrten Fluͤssigkeit bestimmt
ist, eingesenkt werden, so daß bloß der Lufthahn offen bleibt; die
Speiseroͤhre Y muß mit dem Fasse, in welchem sich
die ungeklaͤrte Fluͤssigkeit befindet, in Verbindung gebracht werden,
wobei auch hier der Lufthahn offen zu lassen ist. Der Apparat kann gereinigt und in
Ordnung erhalten werden, indem man die Gewinde T, T und
V, V abschraubt, wo dann das Waschleder
herausgenommen, ausgewaschen und getroknet werden kann, im Falle der Apparat nicht
bestaͤndig in Thaͤtigkeit ist.
Ich beschraͤnke mich uͤbrigens, bei der Verfertigung dieser Apparate
nicht auf die hier beschriebenen Formen und Dimensionen, so wenig als ich die
Anwendung der Kohle, des Kieses oder des Sandsteines zum Klaͤren und
Filtriren fuͤr meine Erfindung ausgebe.
Tafeln