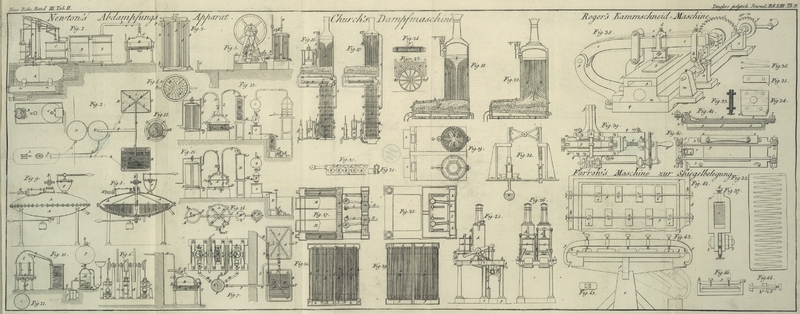| Titel: | Ueber Hrn. Rogers's Maschine zum Schneiden der Kämme. |
| Fundstelle: | Band 53, Jahrgang 1834, Nr. XVIII., S. 101 |
| Download: | XML |
XVIII.
Ueber Hrn. Rogers's Maschine zum Schneiden der
Kaͤmme.
Aus den Transactions of the Society of arts for 1833 Part. II. im Mechanics'
Magazine, No. 562.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Roger's Maschine zum Schneiden der Kaͤmme.
Die Materialien, aus welchen man Kaͤmme zu schneiden pflegt, sind Buchsholz,
Elfenbein, Horn und Schildpatt. Das wichtigste Geschaͤft, nachdem man den
Kaͤmmen durch Raspeln, Feilen etc. den aͤußeren Umriß und eine
beliebige Form gegeben, ist das Schneiden der Zaͤhne.
Dieß geschah nun fruͤher in allen Fallen mittelst einer doppelten
Saͤge, welche aus zwei parallelen Blaͤttern bestand, von denen das
eine tiefer, als das andere war, so zwar, daß, wenn das tiefste Blatt bis in die
ganze Tiefe eines Zahnes geschnitten hatte, das andere Blatt erst bis zur
Haͤlfte dieser Tiefe eingedrungen war. Bei der Anwendung dieser Saͤge
machte das tiefste Blatt in einer geringen Entfernung von der Außenseite des Kammes
den ersten Schnitt, und folglich wurde durch die erste Bewegung der Saͤge die
aͤußere Seite des einen Zahnes ganz und dessen innere Seite halb
ausgeschnitten. Nachdem dieß geschehen, wurde die Saͤge um einen Zahn
vorwaͤrts gebracht; d.h. das tiefste Blatt wurde in den durch das seichtere Blatt gemachten
Schnitt gebracht, so daß also nun das tiefe Blatt die aͤußere Seite des
zweiten Zahnes ganz ausschnitt, waͤhrend das seichtere Blatt wieder die
Haͤlfte der inneren Seite ausschnitt. Auf diese Weise wurde die Saͤge
jedes Mal um einen Zahn vorwaͤrts bewegt, die Zwischenraͤume zwischen
den Saͤgezaͤhnen wurden gleich, und der halbe Schnitt, den das seichte
Blatt im Voraus fuͤr das tiefe Blatt machte, verhinderte das Werfen der Sage
oder das Schneiden von Zaͤhnen von ungleicher Dike.
Kaum war die Kreissaͤge erfunden, so wendete man dieselbe auch zum Schneiden
von Kaͤmmen an, indem man an einer Welle zwei solche Kreissaͤgen
anbrachte- von denen die eine einen groͤßeren Durchmesser hatte, als
die andere; und indem man die Entfernung zwischen beiden Saͤgen nach der
Feinheit der zu schneidenden Zaͤhne regulirte. Man bedient sich
gegenwaͤrtig sowohl der geraden, als der kreisfoͤrmigen Doppelsage;
und zwar ersterer zum Schneiden von Kaͤmmen aus allen den oben angegebenen
Materialien, lezterer hingegen bloß zur Verfertigung von Kaͤmmen aus
Buchsholz und Elfenbein. Buchsholz und Elfenbein splittern sich gern, wenn sie der
senkrechten Wirkung eines Schneidinstrumentes ausgesezt werden; waͤhrend Horn
und Schildpatt wegen ihrer Textur, so wie auch deßhalb, weil sie in der
Waͤrme weich und biegsam werden, die Einwirkung eines scharfen senkrechten
Schneidinstrumentes sehr gut ohne Splitterung ertragen.
Vor beilaͤufig 20 Jahren erhielt das erste Haus, welches damals zu London mit
Kaͤmmen Geschaͤfte trieb, vom Auslande einige Muster von Verzierungen,
die wie Kronen aussahen, und an den Schildkrotkaͤmmen angebracht werden
sollten. Es gab daher einem der gewandtesten Kuͤnstler, Namens Ricketts, den Auftrag, dieselben auszufuͤhren, und
dieser erfand auch wirklich einen Staͤmpel oder eine Patrize, mit welchem er
durch fortgesezten Druk aus einem duͤnnen Stuͤke erwaͤrmten
Schildpattes Stuͤk fuͤr Stuͤk des Musters ausschnitt. Der
Erfinder bemerkte hiebei, daß hier zwei Kaͤmme aus dem Materiale, welches nur
zu einem einzigen bestimmt war, ausgeschnitten wurden; er verfolgte diesen
Fingerzeig weiter, und erfand hienach bald eine Maschine, an der ein einfaches
Schneidinstrument, welches senkrecht herabstieg, durch einen Tretschaͤmel und
ein Rad in Bewegung gesezt wurde. Das Lager, auf welchem das Schildpatt ruhte, war
an der Seite ausgekerbt, und diese Auskerbungen paßten in andere correspondirende
Auskerbungen einer parallel damit laufenden Zahnstange. Nach jedem Schnitte wurde
das Lager mit der Hand um eine Auskerbung bewegt, und auf diese Weise wurde die
gleiche Entfernung der Schnitte von einander gesichert. Da jedoch der Zahn eines Kammes
die Gestalt eines sehr langen Dreiekes hat, so mußte dem Lager, waͤhrend es
von einer Auskerbung zur anderen vorwaͤrts geschoben wurde, zugleich auch
eine abwechselnde Bewegung gegeben werden. Auch diese Bewegung wurde mittelst der
Haͤnde hervorgebracht, und so entstand hienach die erste rohe Maschine zum
Ausschneiden der Zaͤhne des einen Kammes aus den Zwischenraͤumen
zwischen den Zaͤhnen eines anderen.
Als Kiese Maschine bekannt zu werden anfing, wurden verschiedene Vorrichtungen zur
Vorwaͤrtsbewegung des Lagers, so wie auch dazu erfunden, demselben die
noͤthige wechselsweise Aenderung der Richtung zu geben. In einigen Fallen gab
man diese abwechselnde Bewegung dem Lager, in anderen hingegen dem
Schneidinstrumente selbst. Schon bevor man diese Verbesserungen in Vorschlag
brachte, war jedoch der urspruͤngliche Erfinder, Hr. Ricketts, auf die Idee gekommen, diese Veraͤnderung der Richtung
ganz entbehrlich zu machen, und zwar durch Anwendung eines doppelten
Schneidinstrumentes; d.h. durch ein Instrument, welches aus zwei Blaͤttern
bestuͤnde, welche einander an dem einen Ende beruͤhrten,
waͤhrend sie an dem anderen Ende so weit von einander entfernt waͤren,
als es die Breite der Zaͤhne erfordert. Zugleich machten die Blaͤtter
an ihren Enden eine Kruͤmmung, um auf diese Weise die Enden der Zahne frei zu
machen.
Es ist offenbar, daß waͤhrend der Schnitt geschah, das Material
stationaͤr bleiben mußte, und daß das Bett waͤhrend des Zwischenraumes
zwischen dem Emporheben und Herabsenken des Schneidinstrumentes um die Breite eines
Zahnes vorwaͤrts bewegt werden mußte. Diesen Zwek nun erreichte man an den
Rickett'schen Maschinen dadurch, daß man das
Schneidinstrument durch einen Tretschaͤmel allein in Bewegung sezte, und daß
man das Lager durch eine Schraube vorwaͤrts bewegte, an deren Ende eine
Kurbel angebracht war, so zwar daß eine ganze oder eine halbe Umdrehung der Kurbel
das gehoͤrige Vorwaͤrtsschreiten bewirkte, und daß nach jeder solchen
ganzen oder halben Umdrehung ein Ruhepunkt eintrat, waͤhrend welchem das
Schneidinstrument in Thaͤtigkeit gerieth.
In Hrn. Roger's Maschine gelangt man aber ohne
Tretschaͤmel und bloß mittelst einer einfachen Kurbel zu demselben Zweke. Die
Welle, an der die Kurbel befestigt ist, sezt das Schneidinstrument mittelst eines
Winkelhebels in Bewegung; und an der Welle befindet sich ein Rad, an welchem ein
Theil der Zaͤhne weggenommen ist. Dieses Rad greift in ein
gewoͤhnliches Zahnrad, welches sich an der Achse einer Schraube befindet,
durch deren Umdrehung das Lager mit der darauf befindlichen Arbeit vorwaͤrts
bewegt wird. Hieraus
erhellt, daß, waͤhrend die zum Emporheben und Herabsenken des
Schneidinstrumentes bestimmte Maschinerie so lange die Kurbel umgedreht wird, in
bestaͤndiger Thaͤtigkeit ist, die Schraube, die das Lager in Bewegung
sezt, so lange außer Thaͤtigkeit ist, als die Zahne der beiden Raͤder
nicht auf einander wirken. Durch Erweiterung und Vergroͤßerung des Raumes, an
welchem die Zaͤhne des zweiten Rades weggeschnitten sind, wird der
Zwischenraum zwischen je zwei Zahnen des Kammes verkleinert; man kann den
Zaͤhnen also eine beliebige Entfernung von einander geben, je nachdem das
Rad, das man an die Achse der Schraube bringt, diese oder jene Anzahl von
Zaͤhnen hat.
Diese Maschinen haben in allen ihren Modifikationen den Vorzug, daß aus derselben
Quantitaͤt Material, aus welcher mit der gewoͤhnlichen Sage nur ein
Kamm geschnitten werden konnte, nun zwei Kaͤmme erzeugt werden
koͤnnen. Da die Schildkrotschalen jedoch am Rande keilfoͤrmig sind, so
kann die neue Erfindung, indem der keilfoͤrmige Rand fuͤr den
Ruͤken des Kammes nicht Dike genug hat, eigentlich nur auf dike, aus der
Mitte der Schale geschnittene Stuͤke leicht angewendet werden. Dessen
ungeachtet ist aber selbst hier der Vortheil noch sehr groß, indem das rohe
Schildpatt von erster Qualitaͤt 4 Guineen per
Pfund gilt, und also theurer ist, als Silber.
In einigen Faͤllen laͤßt sich der duͤnne Rand eines
Stuͤkes Schildpatt jedoch vielleicht dadurch verstaͤrken, daß man
denselben auf ein dikeres Stuͤk, welches zum Ruͤken bestimmt ist,
loͤthet oder schweißt, indem man die Schildpattstuͤke erhizt, und noch
heiß zusammenpreßt. Es muß jedoch hiebei sehr sorgfaͤltig darauf geachtet
werden, daß das Schildpatt nicht uͤberhizt wird, indem es sonst seine
blaͤtterige Textur verliert, und beinahe so bruͤchig wie Glas wird.
Sowohl in Deutschland als in Frankreich erzeugt man viele Kamme, an denen die
Verzierungen durch einen starken Druk in heißen staͤhlernen Modeln
ausgeschlagen oder ausgepreßt werden, und an denen man auf diese Weise zwei oder
mehrere Schildpattstuͤke mit einander vereinigt; allein die Farbe des
Schildpattes leidet hiebei empfindlich, und eben so wird das Material dadurch sehr
bruͤchig. Die besten englischen Fabrikanten bringen zwei
Schildpattstuͤke, die mit einander vereinigt werden sollen, nachdem dieselben
abgeraspelt und geglaͤttet worden, zwischen zwei duͤnnen Brettchen in
eine Schraubenpresse. Diese Presse wird dann einige Stunden lang in siedendes Wasser
gebracht, wobei man sie von Zeit zu Zeit fester anzieht; auf diese Weise erlangt
man, wenn man die gehoͤrige Zeit gestattet, eine feste Verbindung und zwar bei einer Temperatur,
die so niedrig ist, daß weder die Farbe noch die Textur des Materiales Schaden
leidet.
Fig. 32 zeigt
zwei Kaͤmme, welche aus einem Stuͤke Schildpatt geschnitten, aber noch
nicht von einander getrennt sind. Das Schildpatt wird auf einem beweglichen Lager
festgehalten, welches Lager sich jedes Mal um einen Zahn auf ein Mal bewegt. Die
beiden Meißel oder Schneidinstrumente, deren man sich bedient, damit bei jeder
Bewegung ein vollkommener Zahn ausgeschnitten werde, werden, wie Fig. 33 und 34 zeigt,
durch 4 Stifte oder Zapfen mit einander verbunden, und zwischen ihnen werden
Ausfuͤllstuͤke angebracht, deren Dike und Zulaufen die Form der
Kammzahne genau bestimmt. Von dem unteren Ausfuͤllstuͤke, welches in
Fig. 35
einzeln fuͤr sich abgebildet ist, erstrekt sich eine scharfe Spize so weit
herab, daß dieselbe auf gleicher Hoͤhe mit den Raͤndern des
Schneidinstrumentes steht. Dieser Vorsprung schneidet die Spize des Zahnes von dem
entgegengesezten Kamme ab. So wie dieser doppelte Meißel jedoch den Zahn des einen
Kammes und den leeren Raum des entgegengesezten ausschneidet, werden deren breitere
Enden, wie man in Fig. 36 bei aa sieht, ausgebogen;
dadurch schneidet die vorwaͤrtsschreitende Seite zur Haͤlfte durch die
Spize des naͤchstfolgenden Zahnes, und bei der naͤchsten Bewegung
schneidet dann die folgende Kruͤmmung durch die andere Haͤlfte, so daß
der Zahn frei und los ist. In Fig. 37 sieht man den
Schraubstok, in welchem die Schneidinstrumente a, a von
der Schraube und den Schraubenmuttern bb
festgehalten werden; und da sich diese Schneidinstrumente bestaͤndig genau an
einer und derselben Stelle auf und nieder bewegen muͤssen, so ist dieser
Schraubstok mittelst der Bindeschraube d an der Stange
c, c der Maschine fixirt. ee in Fig. 38 sind zwei
Stellschrauben, mittelst welcher die Meißelkanten genau mit dem Lager f, f, auf welchem sich das zu schneidende Schildpatt
befindet, parallel gestellt werden, g ist der
Stuͤzpunkt, an welchem sich der Stab c in einem
Gelenke bewegt, welches bei den Bewegungen gar keine Erschuͤtterungen
zulaͤßt, und sich mit dem Lager in gleicher Hoͤhe befindet. h ist ein anderes Gelenk oder Gefuͤge, welches
mittelst seiner Schraube i fest an das vordere Ende des
Stabes c geschraubt wird, und da hier die Kraft
ausgeuͤbt wird, durch welche die Schneidinstrumente aa herabgedruͤkt werden, um ihre Arbeit zu
vollbringen, so befinden sich diese beiden Gefuͤge g,
h in einer Linie, welche mit den schneidenden Kanten des Meißels aa parallel laͤuft. Sie befinden sich daher
in dem Augenblike, in welchem der Schnitt geschieht, auf gleichem Niveau mit dem
Lager f; und dieß ist offenbar die beste Einrichtung,
indem die Meißel dann keine seitliche Bewegung und keine Neigung haben sich auf die Seite zu legen. Um
jedoch aller Schiefheit, die allenfalls durch ungleiche Schaͤrfe oder durch
Ungleichheit der Substanz, welche verschnitten werden soll, entstehen
koͤnnte, noch sicherer vorzubeugen, ist an der Maschine ein aufrechter
Pfosten mit einem Fenster k festgemacht, durch welchen
der Stab c, c geht, und in welchem sich dieser Stab auf
und nieder bewegen kann, ohne daß eine Seitenbewegung moͤglich ist. Dieser
Pfosten fuͤhrt daher den Stab c, und sichert die
gerade Stellung und die Staͤtigkeit der Schneidinstrumente nur noch mehr. Das
Gefuͤge h steht durch ein Gelenkstuͤk,
welches aus zwei Haͤlften besteht, und beim Anlegen in der Mitte
zusammengeschraubt wird, mit dem Winkelhebel j in
Verbindung, dessen Achse sich hinter l erstrekt, und von
den drei Pfosten m, n und o
getragen wird. Diese Pfosten sind, um gestellt werden zu koͤnnen, in die
Vorspruͤnge p, p, p geschraubt, welche zugleich
mit dem Arme g und dem unteren Lager q aus einem Stuͤke gegossen sind, so daß die
Meißel mit der groͤßten Festigkeit festgehalten, und zum Schnitte angetrieben
werden. An dem anderen Ende der Welle l befindet sich
ein Rad r, an dessen einer Seite nur einige wenige
Zaͤhne gelassen sind. Diese Zaͤhne sind so gestellt, daß sie nur dann
in das Rad s eingreifen, wenn der Winkelhebel j die Schneidinstrumente aa von der Arbeit emporgehoben. Das Rad s ist
an einer Schraube t, Fig. 39
In dieser Figur ist das Ende des Stabes c und
sein verbindendes Gelenkstuͤk als weggebrochen dargestellt, damit man
den Winkelhebel j sehen koͤnne.A. d. O., befestigt, durch welche das Lager ff genau auf
dieselbe Weise bewegt wird, wie dieß bei der gewoͤhnlichen Drehervorlage der
Fall ist. u ist der Pfosten, von dessen Halsring die
Schraube t festgehalten wird, und v das Schraubenloch, durch welches dieselbe geht. Sie steht mit dem
schwalbenschwanzfoͤrmigen Schieber w, an welchem
das Lager f aufgezogen ist, in Verbindung, und dieser
Schieber ist zur Aufnahme der Schraube t durchbrochen.
Wenn man nun die Kurbel x dreht, so treibt der
Winkelhebel j die Schneidinstrumente aa auf das Schildpatt herab, wodurch ein Zahn
ausgeschnitten wird; dann hebt der Winkelhebel diese Schneidinstrumente wieder
empor, waͤhrend zu gleicher Zeit die wenigen Zaͤhne des Rades r eingreifen, das Rad s mit
sich faͤhren, und dadurch die Schraube t um eine
bestimmte Streke vorwaͤrts treiben. Das Rad r
verlaͤßt dann das Rad s wieder, und der
Winkelhebel treibt seinerseits die Schneidinstrumente wieder herab, um auf diese
Weise einen zweiten Zahn zu erzeugen, u.s.f. bis alle Zaͤhne ausgeschnitten
sind, wo dann ein neues Stuͤk Schildpatt auf das Lager f gelegt, und damit keine Zeit verloren gehe, bloß durch
Zuruͤkdrehen der Kurbel x ausgeschnitten
wird.
Hiemit waͤre die Bewegung der Schneidinstrumente und nach ihnen die Bewegung
des Schildpatts erlaͤutert, so daß nun nur noch der Apparat, durch welchen
das Horn oder das Schildpatt auf dem Lager festgehalten wird, zu beschreiben
uͤbrig ist. Dieser Apparat wurde in Fig. 38 absichtlich
weggelassen; dagegen ist er in Fig. 40 und 41 anschaulich
gemacht, ff ist das Lager, an dessen eine Seite
die stellbare Platte zz geschraubt ist, damit das
Schildpatt oder Horn mit Sicherheit geleitet, und schnell in die Mitte und in
gehoͤrig parallele Stellung gebracht werden kann. Mit dem einen Ende des
Lagers bildet die doppelte Gabel 1,1 ein Gefuͤge, waͤhrend an dem
anderen Ende ganz lose eine aͤhnliche doppelte Gabel angebracht ist. 3,3 sind
zwei duͤnne Stahlfedern oder Stabe, die an beiden Enden hakenfoͤrmig
gebogen, und an dem einen Ende mittelst Schrauben und Schraubenmuttern an den Gabeln
1, 1, an dem anderen Ende hingegen an den losen Gabeln 2, 2 festgemacht sind. Diese
Gabeln erhalten die beiden Stahlstaͤbe mit einander parallel, und mittelst
derselben kann man ihnen jede beliebige Entfernung von einander geben, welche
Entfernung eine solche seyn soll, daß sie den Schneidinstrumenten a, a so nahe als moͤglich kommen, ohne dieselben
jedoch zu beruͤhren. Diese Stahlfederstaͤbe, welche auf diese Weise
bei 1, 1 mit dem Lager ein Gefuͤge bilden, koͤnnen an dem anderen Ende
so emporgehoben werden, daß das Schildpatt unter dieselben gebracht werden kann. Um
hingegen auch die Enden 22 nieder zu halten, ragt aus der Mitte der Gabeln 2, 2 ein
breiter Zahn 4 hervor, der in die Riefen des herabhaͤngenden Faͤngers
5 einschnappt, so daß die Federn 3, 3 auf diese Weise mit jeder erforderlichen
Festigkeit oder Kraft auf das Schildpatt y
gedruͤkt werden. Der Faͤnger 5 steht oben mit einem Zapfen 6 in
Verbindung, und wird, wie man in Fig. 41 sieht, durch eine
kleine Feder gegen den Zahn 4 nach Auswaͤrts getrieben. Die Federn oder
Federstaͤbe 3, 3 muͤssen immer in derselben Richtung herab bewegt
werden, d.h. parallel mit dem Lager f, indem sonst die
Schneidinstrumente damit in Beruͤhrung kommen und beschaͤdigt werden
koͤnnten. Es sind daher zu diesem Behufe an dem Zapfen 6 zwei duͤnne
Wangen befestigt, zwischen welchen der breite Zahn 4 durchgeht, wodurch alle
seitliche Bewegung der Federstabe 3, 3 verhindert wird. Wenn die Federn 3,3 empor
gehoben werden, wird der Faͤnger 5 durch den Hebel 8 von dem Zahne 4
weggedruͤkt. Das Lager f ist, wie man in Fig. 38 und
41 bei 9
ersieht, unterhalb hohl, damit man einen Waͤrmeapparat darunter anbringen
kann, indem die Waͤrme das Horn und das Schildpatt erweicht.
Um die Maschine so zu stellen, daß sie Kaͤmme mit feineren oder
groͤberen Zahnen schneidet, braucht man das Rad r
nur gegen ein anderes Rad mit einer groͤßeren oder geringeren Anzahl von
Zaͤhnen auszuwechseln, und die zwischen den Schneidinstrumenten befindlichen
Ausfuͤllstuͤke gegen andere von entsprechender Dike auszutauschen. Die
Raͤder und Ausfuͤllstuͤke sollen, wenn sie ein Mal einander
angepaßt sind, mit gleichen Nummern bezeichnet werden. Die inneren Seiten der Meißel
oder Schneidinstrumente a, a muͤssen ganz flach
und senkrecht erhalten werden, damit die Zahne nie zwischen denselben steten
bleiben; die Schaͤrfung derselben geschieht daher nur an den aͤußeren
Seiten.
Zu groͤßerer Bequemlichkeit fuͤr den Arbeiter soll die Einrichtung
getroffen werden, daß der Stab c entweder von selbst
emporsteigt, oder in dieser Stellung bleibt, wenn er emporgehoben worden. Man
braucht zu diesem Zweke den Kurbelgriff, wie in Fig. 39, nur dem
Winkelhebel j gegenuͤber zu fixiren, und ihn so
schwer zu machen, daß er jedes Mal herabsinkt, und dadurch den Stab c emporhebt; oder man kann an dem Arme g auch eine Feder befestigen, die gegen die untere Seite
des Stabes c wirkt, und zwar mit einer solchen Kraft,
wie sie noͤthig ist, um denselben emporzuheben oder wenigstens gehoben zu
erhalten.
Fig. 32 bis
37 sind
in halber Groͤße, Fig. 38, 40 und 41 in Viertel-,
und Fig. 39
in Achtelgroͤße gezeichnet. An lezterer Figur sieht man drei Ohren 10, 10,
10, die an der Bodenplatte q der Maschine hervorragen,
und mit denen die Maschine an irgend einer geeigneten Bank befestigt werden
kann.
Tafeln