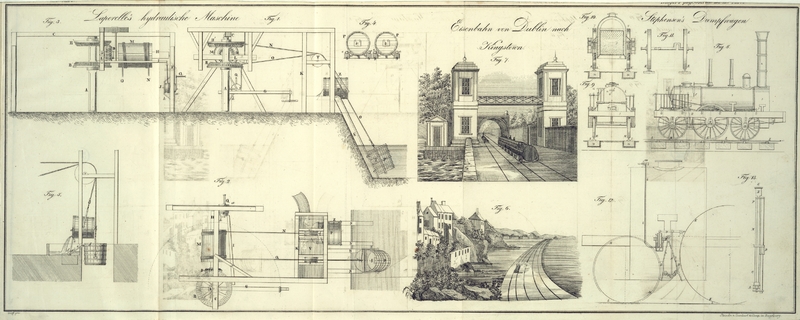| Titel: | Bericht des Hrn. Héricart de Thury über die hydraulische Eimermaschine des Hrn. de Laperelle, Professors der Stereotomie zu Paris. |
| Fundstelle: | Band 54, Jahrgang 1834, Nr. LXX., S. 440 |
| Download: | XML |
LXX.
Bericht des Hrn. Héricart de Thury uͤber die
hydraulische Eimermaschine des Hrn. de Laperelle, Professors der Stereotomie zu
Paris.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement. Mai 1834, S. 193.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Bericht uͤber Laperelle's hydraulische
Eimermaschine.
Die Maschine, welche den Gegenstand gegenwaͤrtigen Berichtes bildet, wurde zu
Ath in Belgien erbaut, um das Wasser aus einem 10 Meter tiefen Steinbruche zu
schoͤpfen. Sie ersezt daselbst mit Vortheil 3 große Archimed'sche Schrauben, welche drei Mal mehr Kosten veranlaßten; sie ist
sehr einfach, und kann ganz aus Holz gebaut werden, obschon es besser ist, wenn die
Zahnraͤder aus Gußeisen und die Zaͤhne aus Holz bestehen; uͤbrigens
koͤnnen leztere gleichfalls aus Gußeisen bestehen.
Hr. de Laperelle maßt sich durchaus nicht an, eine neue
Maschine erfunden zu haben; er verkannte selbst die Aehnlichkeit nicht, welche seine
Maschine mit gewissen aͤlteren, zum Ausschoͤpfen von Wasser bestimmten
Maschinen, und namentlich mit jener des Hrn. Baron de
Prony hat, welche schon seit vielen Jahren bekannt ist, und welche
fuͤr mehrere andere aͤhnliche Maschinen als Muster gedient zu haben
scheint. Nur der guͤnstige Erfolg, mit welchem seine Maschine arbeitet, und
die Ersparniß, welche sich durch die Unterdruͤkung der drei großen Archimed'schen Schrauben, deren Stelle sie vertritt,
ergab, bewogen Hrn. de Laperelle dieselbe der
Gesellschaft vorzulegen.
Diese hoͤchst einfache Maschine hat auf den ersten Blik eine gewisse
Aehnlichkeit mit dem Goͤpel, dessen sich die Gemuͤsegaͤrtner in
der Gegend von Paris bedienen, unterscheidet sich jedoch von diesem dadurch, daß das
Pferd immer in einer und derselben Richtung im Kreise herumgeht, so wie auch durch
die Art und Weise, das Wasser zu schoͤpfen und emporzuheben.
Sie besteht aus einer senkrechten, beweglichen Welle, an welcher zwei große,
hoͤlzerne oder gußeiserne, horizontale Raͤder mit einer
kegelfoͤrmigen gezahnten Oberflaͤche angebracht sind. Die Entfernung
dieser beiden Raͤder von einander wird durch die Dimensionen des Getriebes
bestimmt. An dieser Welle befindet sich auch ein Hebel, an welchem das Pferd,
welches die Maschine in Bewegung sezt, angespannt wird.
Das bewegliche Getrieb, welches die beiden Zahnraͤder von einander trennt,
befindet sich an einer horizontalen Welle, an der eine cylindrische Trommel
angebracht ist, auf welche sich die beiden Taue oder Seile der Schoͤpfeimer
abwechselnd auf- und abwinden, was mittelst eines Hebels geschieht, den der
Lenker des Pferdes in Bewegung sezt. Ein Schoͤpfeimer faßt, wenn die Maschine
fuͤr ein Pferd berechnet ist, 500 Liter. Beide Schoͤpfeimer befinden
sich auf schiefen Flaͤchen, deren unteres Ende unter die Flaͤche des
Wassers, welches gehoben oder ausgeschoͤpft werden soll, taucht; sie werden
mittelst eines Henkels mit einer Achse, der an ihrem Boden oder an ihrem unteren
Theile angebracht ist, an den Tauen befestigt, und von einem eisernen Wagen mit vier
messingenen Rollen, welche in Falzen laufen, die sich zu diesem Behufe in den
erwaͤhnten schiefen Flaͤchen befinden, getragen. An dem oberen Ende
dieser schiefen Flaͤchen befindet sich ein Aufhaͤlter, in welchem sich
die Eimer um ihre Achse
drehen, um sich durch eine Schaukelbewegung, welche der Henkel an dem
Aufhaͤlter erleidet, auszuleeren.
Die gewoͤhnliche Tagesleistung der Maschine besteht darin, daß sie innerhalb
24 Stunden 2880 Kubikmeter Wasser oder 2,880,000 Liter auf eine Hoͤhe von
3,14 Meter hebt; aus einem Brunnen, welcher 20 Meter oder 6 1/2 Mal so tief ist,
hebt sie taͤglich 446,16 Kubikmeter oder 446,160 Liter.
Was den Preis der Maschine betrifft, so haben wir Herrn de
Laperelle bemerkt, daß dieselbe hoͤher zu stehen kommen
muͤsse, als die Archimed'sche Schraube. Seine
Maschine kommt wirklich auf 1000 Fr. zu stehen, waͤhrend jede der Archimed'schen Schrauben 800 Fr. kostete; allein
Jedermann weiß, daß man mit der Schraube nicht in großer Tiefe arbeiten kann, und
daß sie uͤberdieß auch den Nachtheil hat, daß in ihrem Inneren im
Verhaͤltnisse zu der Wassermenge, welche sie hebt, eine große Wassermasse
bleibt, wodurch nicht nur ein Verlust an Kraft, sondern zugleich auch eine so große
Vermehrung der Reibung an den Zapfen entsteht, daß die Schraube oft gebogen wird.
Ueberdieß sagt Hr. de Laperelle, daß der Betrieb einer
jeden Archimed'schen Schraube des Tages auf 30 bis 35 Fr.
und daruͤber zu stehen kommt, waͤhrend der Betrieb der Eimermaschine
des Tages hoͤchstens 12 bis 15 Fr. lostet. Die Pferde brauchen bloß von
mittlerer Staͤrke zu seyn, und die Lenkung ist so einfach, daß der Arbeiter,
welcher den Hebel bewegt, um die Zaͤhne eingreifen zu machen, oder um sie von
einander zu befreien, ihnen nur zuzurufen braucht.
Die Commission schlaͤgt daher vor, die Maschine des Herrn de Laperelle durch den Bulletin bekannt zu machen, und ihm den Dank der Gesellschaft fuͤr
deren Mittheilung auszudruͤken.
Beschreibung der Laperelle'schen, fuͤr ein Pferd
berechneten Maschine.
Fig. 1 ist ein
Seitenaufriß der hydraulischen Eimermaschine.
Fig. 2 ist ein
Grundriß.
Fig. 3 zeigt
jenen Theil des Mechanismus, woraus man das Raͤderwerk ersieht.
Fig. 4 zeigt
die Schoͤpfeimer einzeln und in ihren Wagen angebracht.
Fig. 5 zeigt
die Einrichtung der Schoͤpfeimer, wenn dieselben zum Emporheben des Wassers
aus einem Brunnen dienen sollen.
Die Maschine besteht aus einer senkrechten, sich drehenden Welle A, an welcher sich zwei große horizontale Raͤder
B, B mit hoͤlzernen oder gußeisernen,
kegelfoͤrmig gestellten Zaͤhnen befinden. Zwischen diesen beiden Raͤdern ist
ein senkrechtes Getrieb D angebracht, welches
gleichfalls mit kegelfoͤrmigen Zaͤhnen versehen, und an der Welle H befestigt ist, so daß es abwechselnd in das eine oder
in das andere der beiden Raͤder B eingreift.
Die senkrechte Welle A ist mit zwei eisernen Zapfen
versehen, von denen sich der eine in einer kupfernen, auf einem steinernen Untersaze
angebrachten Pfanne, der andere hingegen in einem Halsringe dreht, welcher an dem
von den beiden Pfosten E, F getragenen Querstuͤke
C befestigt ist. An dieser Welle befindet sich ein
Hebel G mit einem Ortscheite, an welchem das Pferd
angespannt wird. Damit das Getriebe D bald in das eine,
bald in das andere der beiden Raͤder B eingreife,
dreht sich die eine der Achsen der Welle H, an der er
aufgezogen ist, in einem Querbalken L, welcher mittelst
eines Aushebhebels I in dem Zapfenloche g gehoben oder herabgelassen werden kann. An dem einen
Ende dieses Hebels ist naͤmlich ein Seil angebracht, welches sich um die
Trommel J, die man mittelst der Kurbel Q in Bewegung sezt, windet. Diese Trommel, welche
mittelst eines eisernen Beschlaͤges h an dem
Pfosten F befestigt ist, traͤgt an der einen
Seite auch ein Sperrrad a mit einem Sperrkegel, wodurch
die Ruͤkdrehung der Trommel verhindert wird. Nenn man daher die Kurbel Q dreht, so kommt mittelst des erwaͤhnten Strikes
der Aushebhebel l in Bewegung, und die Folge hievon ist,
daß der Querbalken L und die Welle H emporgehoben wird. Auf diese Weise greift das Getriebe
D in das Rad B ein;
laͤßt man das Seil hierauf wieder nach, so senkt sich der Querbalken L wieder herab, wo das Getriebe dann in das Rad B eingreift.
An der Welle H befindet sich die Trommel M, um welche nach entgegengesezten Richtungen die Strike
oder Ketten N, O gewunden sind. An diesen Striken oder
Ketten sind die Eimer P aufgehaͤngt, deren Boden
mit einer Klappe, welche sich nach Innen oͤffnet, ausgestattet ist. Die
beiden Rollen T und U,
uͤber welche die Seile oder Ketten N, O laufen,
sind in einem Geruͤste aufgezogen, welches in einer solchen Entfernung von
dem Triebwerke angebracht ist, daß das Pferd nicht in seiner Bewegung gehindert
wird. Im Inneren dieses Geruͤstes oder Gemaͤuers befindet sich ein
Wasserbehaͤlter V, welcher zur Aufnahme des
Wassers, welches von den Schoͤpfeimern entleert wird, dient. Dieses Wasser
kann dann von hier aus durch den Canal X an einen
beliebigen Ort geleitet werden.
Die Schoͤpfeimer P werden von Wagen R getragen, an denen sich vier messingene Rollen c, c befinden, und welche dadurch in ihrer Bahn erhalten
werden daß eine Achse in Falzen laͤuft, welche laͤngs der schiefen
Flaͤchen S angebracht sind. An dem oberen Ende
dieser Falzen befindet sich ein Aufhaͤlter, gegen den sich die Achse des
Wagens stemmt, wenn der Schoͤpfeimer am Ende seiner Bahn angelangt ist. Der
Wagen, so wie der auf demselben befindliche Schoͤpfeimer dreht sich dann um
seine Achse, und nimmt die aus Fig. 1 ersichtliche
horizontale Stellung an; es geschieht dieß naͤmlich mittelst eines Henkels
Z, an welchem das Seil festgemacht ist, und welcher
die Zapfen aufnimmt, die in den unteren Rand des Kuͤbels eingelassen sind.
Ist der Kuͤbel am oberen Ende der schiefen Flaͤche angelangt, so
geraͤth er nothwendig in Schaukelbewegungen, und entleert sich in dem
Wasserbehaͤlter V. So wie man hierauf das Seil
wieder nachlaͤßt, sinkt der leere Eimer in Folge seines eigenen Gewichtes
wieder in das Wasser hinab, um sich daselbst neuerdings wieder mit Wasser zu
fuͤllen. Diese Bewegung ist eine abwechselnde; d.h. waͤhrend der eine
Eimer gefuͤllt emporsteigt, sinkt der andere leer herab, und umgekehrt.
Die hier beschriebene Maschine kann sowohl zum Trokenlegen verschiedener Orte, als
zum Heben des Wassers auf verschiedene Hoͤhen benuzt werden, in welchem Falle
man, um das Emporsteigen der Eimer zu erleichtern, die schiefe Flaͤche
anbringt. Sie laͤßt sich jedoch auch benuzen, um Wasser aus bedeutenden
Tiefen, z.B. aus Brunnen, Schachten etc. herauszuschaffen; in diesem Falle braucht
man die schiefe Flaͤche nicht, sondern man befestigt an dem oberen Rande des
Eimers eine Braze d, in welche von selbst ein
beweglicher Haken e, auf den die Feder f druͤkt, eingreift. Da dieser Haken am Rande des
Brunnens angebracht ist, so stuͤrzt er den Eimer in dem Augenblike, in
welchem er an diesem Rande anlangt, um, wie Fig. 5 deutlich zeigt.
Tafeln