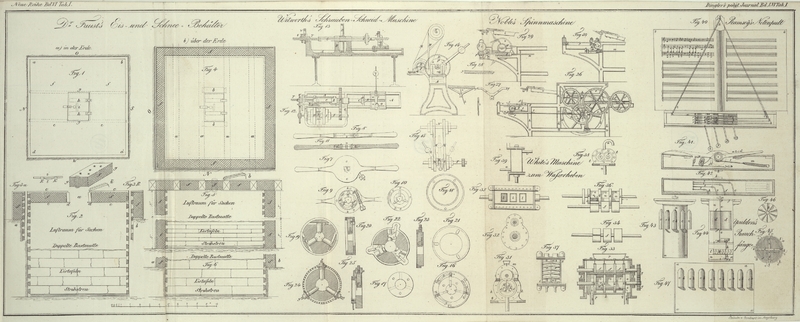| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen oder Apparaten zum Schneiden von Schrauben, worauf sich Joseph Whitworth, Maschinist von Manchester, in der Grafschaft Lancaster, am 27. Febr. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. III., S. 6 |
| Download: | XML |
III.
Verbesserungen an den Maschinen oder Apparaten
zum Schneiden von Schrauben, worauf sich Joseph Whitworth, Maschinist von Manchester, in
der Grafschaft Lancaster, am 27. Febr. 1834 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Januar 1835, S.
266.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Whitworth's verbesserte Maschinen oder Apparate zum Schneiden von
Schrauben.
Die unter obigem Patente begriffenen Erfindungen und Verbesserungen bestehen in einer
verbesserten Einrichtung des Schraubstokes oder des Rahmens, womit die zum Schneiden
der Schrauben dienenden Schneidinstrumente oder Patrizen festgehalten werden, und in
der Art und Weise, auf welche diese lezteren zum Behufe des Schneidens der Schrauben
gleichzeitig eingezwaͤngt werden. Sie bestehen ferner aber auch in dem Baue
einer Maschine, in der Schneidinstrumente, welche nach einem dem eben angegebenen
aͤhnlichen Principe wirken, so angebracht sind, daß sie an cylindrischen
Wellen, welche von einer Dampfmaschine oder anderen Triebkraft bewegt werden,
Schraubengaͤnge von dem erforderlichen Durchmesser schneiden.
Die Mittel, womit den Patrizen die gleichzeitige Bewegung mitgetheilt werden kann,
sind sehr verschieden, weßhalb denn der Patenttraͤger in der
Erklaͤrung seines Patentes und in der beigegebenen Zeichnung mehrere dieser
Methoden erlaͤutert hat.
Fig. 7 zeigt
einen der verbesserten Handschraubstoͤke, woran die Patrizen an Ort und
Stelle angebracht dargestellt sind, von Außen. Fig. 8 zeigt dieselbe
Vorrichtung von der Seite. In Fig. 9 sieht man das
Innere derselben; der Dekel der Buͤchse ist hier abgenommen, damit man die
inneren Theile ersehe; er ist uͤbrigens in Fig. 10 auch noch
umgekehrt abgebildet. Fig. 11 ist ein
Laͤngendurchschnitt durch den Schraubstok in seiner vollendeten Einrichtung.
a, a, a sind die Patrizen, welche genau in Falzen
passen, die zu deren Aufnahme theils in der Buͤchse b,
b, theils in dem Dekel c, c angebracht sind, so
daß sich dieselben in radialen Richtungen schieben koͤnnen. d ist ein innerhalb der Buͤchse angebrachtes Rad,
welches sich in einem kreisrunden, in der Buͤchse und in dem Dekel
befindlichen Ausschnitte dreht, und in dessen Umfang schiefe Zaͤhne
geschnitten sind. e ist eine Tangentenschraube, welche
durch einen cylindrischen Ausschnitt geht, der gleichfalls theils in der
Buͤchse, theils im Dekel angebracht ist; die Gewinde dieser Schraube greifen
in die Zaͤhne des Rades e, und folglich wird
lezteres umgedreht, so wie die Schraube in Bewegung gesezt wird. In das Innere des
Rades d sind drei excentrische, gebogene Vertiefungen
f, f, f geschnitten, deren Curven sich gegen die
Ruͤken der Patrizen a stemmen. Wenn daher die
Schraube e umgedreht wird, so wird das Rad d umgetrieben; und indem hiedurch die kleineren Radien
der Curven f gegen die Ruͤken der Patrizen
andruͤken, werden diese lezteren gleichzeitig nach Einwaͤrts
gedraͤngt.
Die verbesserte Maschine zum Schneiden der Schrauben durch Kraft sieht man in Fig. 12 und
13. Fig. 12 ist
naͤmlich eine horizontale Ansicht dieser Maschine, welche in Fig. 13 im
Laͤngenaufrisse und zum Theil im Durchschnitte dargestellt ist,
waͤhrend Fig. 14 eine Endansicht davon gibt. A, A ist
das Lager oder das Gestell der Maschine, welches beinahe wie das Lager und die
Vorlage einer Drehebank gebaut, und mit fixirten Pfosten versehen ist, in denen sich
die Hauptwelle C nicht nur umdreht, sondern auch der
Laͤnge nach schiebt. Das Zahnrad D ist durch
einen Schluͤssel, welcher durch dessen Nabe geht, mit der Welle C verbunden, und dieser Schluͤssel greift in eine
Fuge, welche, wie Fig. 13 zeigt, der Laͤnge nach in diese Welle geschnitten ist.
Obschon daher das Rad D auf diese Weise so an die Welle
C geschirrt ist, daß es eine und dieselbe kreisende
Bewegung mit dieser theilen muß, so kann sich die Welle dennoch der Laͤnge nach
in der Nabe des Rades schieben. Die kreisende Bewegung wird dem Rade D durch ein Getrieb mitgetheilt, welches an der
Nebenwelle F, F angebracht ist; die Zapfen dieser
lezteren drehen sich in Lagern in dem seitlichen Gestelle G,
G, wie man dieß am besten aus Fig. 12 ersieht. An der
Nebenwelle F, F drehen sich frei die beiden Rollen H und J, von denen jede mit
einer Klauenbuͤchse versehen ist; zwischen ihnen ist die schiebbare Klaue k und der Hebel L
angebracht, womit die eine oder die andere dieser Rollen an die Welle geschirrt
werden kann, damit sich die Welle, je nachdem es die Umstaͤnde erfordern,
nach entgegengesezten Richtungen umdrehen laͤßt. Man wird diesen Theil der
Maschine noch besser auffassen, wenn man einen Blik auf Fig. 15 wirft, wo die
Nebenwelle und die dazu gehoͤrigen Theile zum Theil im Aufrisse dargestellt
sind. Von den Rollen H und J
aus laufen Baͤnder M, M, von denen das eine
gekraͤnzt ist, an entsprechende, an der Welle N
befestigte Rollen. Da diese leztere Welle durch eine Dampfmaschine oder irgend eine
andere Triebkraft in Bewegung gesezt wird, so werden die Rollen H, J durch die Laufbaͤnder M, M nach entgegengesezten Richtungen umgedreht werden; und je nachdem
daher die Welle durch den Hebel L, dessen verschiedene
Stellung durch punktirte Linien angedeutet ist, mittelst der Klauenbuͤchse an
die eine oder die andere der Rollen H, J geschirrt ist,
wird sie sich nach der einen oder nach der anderen Richtung umdrehen, oder auch ganz
stillstehen, im Falle die Klauenbuͤchse in der Mitte steht, und mit keiner
der Rollen in Verbindung gebracht ist.
Die Stelle, an der sich die Buͤchse mit den Schraubenpatrizen befindet, sieht
man in Fig.
12, 13 und 14 bei P; sie ist an einem Rahmen Q befestigt, der auf den Bahnen oder Schienen des Lagers
A, A geschoben, und mittelst Schraubenbolzen an dem
Lager befestigt werden kann. Die in der Buͤchse enthaltenen Patrizen werden
fast nach dem oben beschriebenen Principe in Bewegung gesezt; ihre Einrichtung
weicht jedoch einiger Maßen ab.
Das glatte oder walzenfoͤrmige Stuͤk, in welches die Schraube
geschnitten werden soll, sieht man in Fig. 12, 13 und 14 bei R, und zwar an dem einen Ende von dem
Wangenhaͤlter (chuck-holder) S, der sich an dem Ende der Hauptwelle S befindet, festgehalten; das mit
Schraubengaͤngen zu versehende Stuͤk wird demnach durch die
Umdrehungen und durch die Laͤngenbewegung dieser Welle durch die Patrizen
gefuͤhrt, und dadurch werden die Schraubengaͤnge in dasselbe
geschnitten werden. Die Laͤngenbewegung der Hauptwelle C haͤngt von der Fuͤhrschraube T
ab, deren Achse mit der
Achse der Hauptwelle zusammenfaͤllt; beide sind mit einander verbunden, indem
das Ende der Schraube T in eine an dem Ende der
Hauptwelle angebrachte Dille eingesenkt, und mittelst eines Randstuͤkes und
Halsringes darin festgehalten wird, wie man dieß in Fig. 13 durch Punkte
angedeutet sieht. In Folge dieser Einrichtung kann sich die Welle C unabhaͤngig von der Schraube T umdrehen. Die Schraube T
geht durch eine Schraubenbuͤchse U, und diese,
welche sich frei in dem Halse des Zapfenlagers V
umdreht, wird durch das an ihr befestigte Zahnrad W
umgedreht. Durch diese Einrichtung wird bezwekt, daß, statt die Schraube T selbst umzudrehen, die Schraubenbuͤchse U in kreisende Bewegung versezt wird, um die Schraube
zugleich mit der Welle C der Laͤnge nach zu
verschieben. Bei dieser Einrichtung kann man eine Schraube T, deren Schraubengaͤnge irgend eine geeignete Hoͤhe haben,
anwenden, um die Hauptwelle so zu fuͤhren, daß in das glatte Stuͤk R ein beliebiges Schraubengewinde geschnitten wird. Die
Laͤngenbewegung der Schraube T und der Welle C, wodurch die Schiefheit des zu schneidenden
Schraubengewindes bestimmt wird, kann durch Abaͤnderung der Durchmesser der
Raͤder, die sich an der Nebenwelle F befinden,
und des Rades W, wodurch die Schraubenbuͤchse U umgedreht wird, regulirt werden; denn je nach der
Geschwindigkeit der Umgaͤnge der Schraubenbuͤchse U wird sich auch die Leitungsschraube T und die Welle C der
Laͤnge nach vorwaͤrts bewegen; und je nachdem die Geschwindigkeit der
Umgaͤnge der Schraubenbuͤchse zu- oder abnimmt, wird auch die
Schraube mit mehr oder weniger Schiefheit in das glatte Stuͤk R geschnitten werden.
Um die Ausdehnung der Streke, in welcher das Schraubengewinde mittelst der Patrizen
auf das glatte Stuͤk R geschnitten wird, zu
beschraͤnken, sind an einer Schieberstange, die sich mit der verschiebbaren
Welle vorwaͤrts bewegt, stellbare Aufhaͤlter X,
X angebracht. Diese Aufhaͤlter wirken, je nachdem sie gestellt
werden, in gehoͤrigen Zwischenraͤumen auf den Hebel L, und veraͤndern dessen Stellung solchergestalt,
daß die Klauenbuͤchse veraͤndert wird, und eine Laͤngenbewegung
nach der entgegengesezten Richtung eintritt.
Fig. 16 zeigt
den inneren Bau der Buͤchse, in der die Schneidinstrumente oder Patrizen a, a, a enthalten sind. Die Stiele derselben passen hier
in cylindrische Loͤcher, welche, wie Fig. 17 zeigt,
radienweise in dem inneren Ringstuͤke angebracht sind; auf die hinteren
Theile dieser Stiele wirken die excentrischen Curven y, y,
y, welche in dem aͤußeren Ringe der Buͤchse ausgeschnitten
sind, wie man dieß aus Fig. 16 ersieht. Parallel
mit den gekruͤmmten Ausschnitten sind auch gekruͤmmte excentrische
Rippen z, z, z angebracht, die sich i
Auskerbungen, welche in
die unteren Seiten der Stiele geschnitten sind, bewegen. Es erhellt offenbar, daß,
indem der innere Ring an dem Rahmen Q befestigt ist, wie
man dieß aus Fig.
13 sieht, und indem sich der aͤußere Ring rund um denselben
schiebt, die Patrizen sich dem Mittelpunkte naͤhern oder sich davon entfernen
werden, wenn man dem aͤußeren Ringe mittelst des belasteten Hebels Y eine theilweise Kreisbewegung mittheilt. Fig. 18 stellt
den abgenommenen Dekel der Buͤchse vor.
Sollte man es fuͤr gut finden, so kann man den Rahmen Q zugleich mit der Buͤchse P und den
Patrizen waͤhrend der Zeit, waͤhrend welcher die Schraube in das
glatte Stuͤk R geschnitten wird, sich auch auf
dem Lager A, A bewegen lassen. In diesem Falle
wuͤrde sich die Welle C und das Stuͤk R umdrehen, ohne sich zugleich der Laͤnge nach zu
bewegen, waͤhrend der Rahmen Q und die Patrizen
durch eine Fuͤhrschraube, welche durch eine an dem Rahmen Q angebrachte Schraubenbuͤchse gehen
muͤßte, bewegt werden wuͤrde. Die kreisende Bewegung wuͤrde auf
dieselbe Weise, wie dieß oben bei der Schraubenbuͤchse U angegeben worden ist, oder auf irgend eine andere geeignete Art von der
Welle F her an diese Fuͤhrschraube fortgepflanzt
werden.
Fig. 19 und
20 zeigen
eine Methode, gemaͤß welcher die Bewegung der Schneidinstrumente oder
Patrizen nicht durch die oben beschriebenen excentrischen Ausschnitte, sondern durch
schiefe Flaͤchen oder keilfoͤrmige Stuͤke hervorgebracht wird.
Fig. 19
zeigt das Innere der Buͤchse oder des Patrizenhaͤlters mit
abgenommener Vorderplatte; Fig. 20 hingegen gibt
einen Durchschnitt derselben. y, y sind
keilfoͤrmige Stuͤke, die im Inneren der Buͤchse oder des
Patrizenhaͤlters angebracht sind, und deren schiefe Flaͤchen gegen die
Enden der Stiele oder Bloͤke der Patrizen wirken. An diesen
keilfoͤrmigen Stuͤken sind Stifte oder Zapfen angebracht, die sich in
Faͤhrten oder Ausschnitten bewegen, welche zu diesem Behufe in der aus Fig. 21
ersichtlichen Vorderplatte angebracht sind. Wenn man daher diese Platte zum Theil
umdreht, so werden diese Ausschnitte die keilfoͤrmigen Stuͤke
vorwaͤrts bewegen, und dadurch die Patrizen nach Einwaͤrts
treiben.
In Fig. 22 und
23 sieht
man eine andere Methode dargestellt, gemaͤß welcher die gleichzeitige
Bewegung der Patrizen durch Hebel hervorgebracht wird; durch diese Vorrichtung
koͤnnen uͤbrigens die Patrizen auch zuruͤkgezogen werden, wenn
es erforderlich seyn sollte. y, y sind Krummhebel, deren
Enden sich in Fugen bewegen, welche zu diesem Behufe in die Stiele oder
Haͤlter der Patrizen geschnitten sind. Die Stuͤzpunkte dieser Hebel
befinden sich in Zapfen, welche in der Buͤchse angebracht sind, und an den entgegengesezten Enden
der Hebel befinden sich Zapfen, welche sich gleich wie bei der eben vorher
beschriebenen Methode in Ausschnitten, die in dem aͤußeren Ringe angebracht
sind, bewegen. So wie daher dieser aͤußere Ring zum Theil umgedreht wird,
treiben die Hebel die Patrizen vorwaͤrts; dreht man den Ring hingegen nach
der entgegengesezten Seite, so werden die Patrizen wieder in die fruͤhere
Stellung zuruͤkgelangen.
In Fig. 24 und
25 sieht
man endlich noch eine andere Methode dargestellt, gemaͤß welcher dieselbe
Bewegung der Patrizen durch Schrauben, Raͤder und Getriebe hervorgebracht
wird. y, y, y sind Schrauben, welche an den Enden der
Stiele oder der Haͤlter der Patrizen angebracht sind, und an denen sich
Winkelgetriebe bewegen, in deren Naben Schraubengewinde geschnitten sind. Die Naben
dieser Getriebe werden durch eine Fuge und einen Zapfen an den inneren Ring
gehalten. In die Stiele oder Patrizenhaͤlter ist eine Laͤngenfurche
geschnitten, in der sich Zapfen bewegen, damit sich dieselben nicht umdrehen
koͤnnen. An einem Vorsprunge des inneren Ringes ist ein Rad mit schiefen
Zaͤhnen angebracht, welches in die einzelnen Getriebe eingreift; so wie man
daher dieses Rad vorwaͤrts oder ruͤkwaͤrts dreht, werden die
Getriebe umgedreht werden, und durch ihre Bewegung die Patrizen nach
Auswaͤrts oder nach Einwaͤrts treiben.
Der Patenttraͤger erklaͤrt am Schlusse der Beschreibung seiner
Erfindung, daß dieselbe eben so auch auf das Schneiden der Schraubengewinde
verschiedener anderer Arten von Schrauben, namentlich jener, deren man sich an den
Drehebaͤnken, Schraubstoͤken etc. bedient, so wie auch an den
Maschinen zur Verfertigung von Schraubenbolzen oder Holzschrauben angewendet werden
kann.
Tafeln