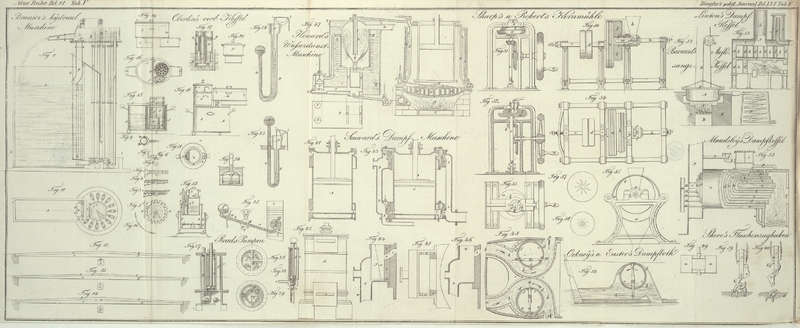| Titel: | Verbesserte hydraulische Maschine oder Apparat mit Centrifugalkraft zum Heben und Treiben von Wasser, worauf sich Louis Brunier, Architect und Civilingenieur von Vine-Yard-Walk, in der Grafschaft Middlesex, am 8. Mai 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. XLVII., S. 275 |
| Download: | XML |
XLVII.
Verbesserte hydraulische Maschine oder Apparat
mit Centrifugalkraft zum Heben und Treiben von Wasser, worauf sich Louis Brunier, Architect und
Civilingenieur von Vine-Yard-Walk, in der Grafschaft Middlesex, am 8. Mai 1834 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions.
Maͤrz 1835, S. 153.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Verbesserte hydraulische Maschine zum Heben und Treiben von
Wasser.
Meine Erfindung beruht in einem hydraulischen Apparate, wodurch ich im Stande bin,
die Centrifugalkraft, welche das Wasser erlangt, wenn es in kreisfoͤrmiger
Richtung herum getrieben wird, zum Heben einer Wassersaͤule uͤber das
Niveau der im Kreise herumlaufenden Wasser zu verwenden.
Fig. 1 gibt
einen Durchschnittsaufriß meines Apparates. A ist ein
Wasserbehaͤlter oder das Wasser eines Flusses, eines Bergwerkes oder eines Brunnens, woraus das
Wasser bloß durch die Centrifugalkraft, die es erlangt, wenn man es von dem unteren
Theile des Behaͤlters A auf eine spaͤter
zu beschreibende Weise durch mehrere kreisrunde Canaͤle stroͤmen
laͤßt, um ein Bedeutendes uͤber sein Niveau emporgehoben wird. C ist ein Leitungsbottich, der das in dem
Behaͤlter A befindliche Wasser in die kreisrunden
Canaͤle ausstroͤmen laͤßt; und D
eine Klappe, womit der Wasserstrom nach Bedarf unterbrochen oder angehalten werden
kann. Diese Klappe wird, wenn es noͤthig ist, mittelst des Krummhebels E, mit dem sie durch die Stange G in Verbindung steht, in Bewegung gesezt; und dieser Krummhebel wird
selbst wieder mittelst des Griffes F von einem Arbeiter
in Thaͤtigkeit gesezt. Da die Klappe G eine
laͤngliche Gestalt hat, so muͤssen zwei solcher Stangen G, die an zwei Stellen an ihr befestigt sind, vorhanden
seyn, wie man dieß aus dem Grundrisse Fig. 11 sieht; der
Winkelhebel E hingegen ist an seinem kuͤrzeren
Ende steigbuͤgelfoͤrmig gebildet, wie dieß Fig. 9 zeigt. Y ist ein kleiner Faͤnger, womit der Hebel E niedergehalten wird, wenn die Klappe bestaͤndig
offen erhalten werden soll.
Nachdem ich nun gezeigt habe, auf welche Weise ich den Wasserstrom in die kreisrunden
Canaͤle eintreten lasse, will ich gleich bei dieser Figur auch zeigen, wie er
wieder aus ihnen austritt, und die weitere und ausfuͤhrliche Beschreibung
dieser Canaͤle selbst bis zu den uͤbrigen Figuren versparen. Das
Wasser, welches durch den Bottich C in die kreisrunden,
hier mit r, r, r, r bezeichneten Canaͤle
eingedrungen ist, stroͤmt, so wie es aus diesen austritt, mit großer Gewalt
in die Austrittsroͤhren H, dergleichen, wie man
spaͤter sehen wird, mehrere angebracht sind, und an denen ein
kegelfoͤrmiges Ende I angepaßt ist, aus welchem
das Wasser in die gebogene Roͤhre J entweicht,
welche in der That nichts weiter als eine an den hoͤher gelegenen
Behaͤlter B fuͤhrende Steigroͤhre
ist. Man wird bemerken, daß das gebogene Ende der Steigroͤhre J mit einer Art von Dekel oder mit einem durch
Randstuͤke damit verbundenen Endstuͤke versehen ist, und daß in diesem
ein kegelfoͤrmiges Loch angebracht ist, welches sich genau unter der
kegelfoͤrmigen Oeffnung am Ende der Austrittsroͤhre befindet, und auch
damit correspondirt. Auf welche Weise das Wasser die Kraft erlangt, mit der es am
Ende des gebogenen Endes der Steigroͤhre J in die
Oeffnung L eindringt, wird spaͤter gezeigt
werden; hier genuͤgt es zu bemerken, daß diese Kraft eine solche ist, daß das
Wasser nicht nur die Steigroͤhre J
erfuͤllt, sondern auch an deren oberem Ende in den Behaͤlter B ausfließt. Sechs solcher Steigroͤhren, die ihr
Wasser in den Behaͤlter B entleeren, sieht man in
Fig. 1.
Aus dem Behaͤlter B kann man das gehobene Wasser zum Behufe der
Erzielung einer mechanischen Kraft durch einen Canal M
auf ein Wasserrad, und dann wieder in den Behaͤlter A zuruͤkgelangen lassen. Sollte in diesem Falle die Bewegung des
Wasserrades angehalten werden muͤssen, so koͤnnte der Schieber oder
die Klappe N mit der Schnur O geschlossen werden, wo dann kein Wasser mehr durch den Canal M stroͤmen, sondern durch das Rohr P in den Behaͤlter A
zuruͤkgelangen wuͤrde. Die Rollen Q, Q
sind bloß Leitungsrollen, uͤber welche die Schnur O laͤuft, damit sie durch die im Behaͤlter B befindliche Leitungsroͤhre R endlich in den Bereich des bei S befindlichen Arbeiters kommt.
Nun erst will ich zur Beschreibung jenes Theiles meines Apparates uͤbergehen,
in welchem die kreisenden Canaͤle enthalten sind, und den ich das
Canalgehaͤuse nenne. Fig. 2 ist ein
durchschnittlicher Grundriß des Canalgehaͤuses, nach der in Fig. 3 angedeuteten Linie
W, W genommen. Der Theil T paßt an den Bottich C, Fig. 1, und bildet den von
mir sogenannten Hals; dieser hat flache Seiten, und ist innen in 5 Faͤcher
a, b, c, d und e
getheilt, welche saͤmmtlich in einen entsprechenden kreisrunden Canal im
Canalgehaͤuse fuͤhren. Die Waͤnde, welche die kreisrunden
Canaͤle bilden, sind mit f, g, h und l bezeichnet. Der Boden eines jeden einzelnen dieser
Canaͤle besteht aus einer schiefen Flaͤche, welche von dem Punkte aus,
an welchem sie mit dem Halse in Verbindung steht, bis zu dem Scheitel des Halses
allmaͤhlich emporsteigt; waͤhrend von hier an der horizontale Scheitel
des Halses den Boden des kreisrunden Canales bildet. In jeder der Waͤnde f, g, h, l sind beinahe in der Hoͤhe derselben
uͤber dem Halse stuͤkpfostenaͤhnliche Oeffnungen angebracht:
und zwar strahlenfoͤrmig vom Mittelpunkte aus, so daß, obschon die Oeffnungen
der inneren Scheidewand vierekig sind, dieselben nach Außen hin immer mehr und mehr
eine laͤngliche Gestalt bekommen, bis sie sich endlich der
Austrittsroͤhre H gegenuͤber wieder so
zusammenziehen, daß sie wieder vierekig werden. Die zwischen diesen
Stuͤkpfostenoͤffnungen befindlichen Theile der Scheidewaͤnde
sind seiherartig durchloͤchert, waͤhrend die senkrechten Seiten
derselben zur Erleichterung des Austrittes des Wassers durch die
Stuͤkpfostenoͤffnungen, wie Fig. 10 zeigt, unter
einem Winkel abgeschnitten sind, der mit dem Kreise, in welchem sich das Wasser
bewegt, eine Tangente bildet.
Fig. 3 ist ein
senkrechter Durchschnitt des Halses und des Canalgehaͤuses nach der Linie X, X von Fig. 2.
Fig. 4 ist ein
aͤhnlicher Durchschnitt, woran die Scheidewaͤnde, die die kreisrunden
Canaͤle bilden, weggelassen sind.
Fig. 5 ist ein
Seitenaufriß des Halses und des Canalgehaͤuses.
Fig. 6 ist das
gebogene Ende der Austrittsroͤhre H; es ist an
dem einen Ende an die vierekige Austrittsroͤhre H, und an dem anderen an das kegelfoͤrmige Ende I mit Randstuͤken gebolzt. Dieses gebogene Stuͤk muß also in
seiner ganzen Laͤnge seine Form auf solche Weise aͤndern, daß es an
dem einen Ende die aus Fig. 7 ersichtliche
vierekige, an dem anderen hingegen die aus Fig. 8 ersichtliche runde
Gestalt hat.
Fig. 11 ist
ein Grundriß des in Fig. 1 abgebildeten Apparates, uͤber welchen ich, da sich gleiche
Buchstaben auf gleiche Gegenstaͤnde beziehen, nichts weiter mehr zu sagen
brauche. Nur bemerke ich, daß man hier die ganze Reihe saͤmmtlicher
Steigroͤhren ersieht, waͤhrend der Behaͤlter B nicht sichtbar ist, indem der Grundriß nach der in
Fig. 1
gezogenen Linie Z, Z genommen ist. Die punktirten Linien
des Halses zeigen die Tangente, unter welcher das Wasser aus den Canaͤlen des
Halses in die kreisrunden Canaͤle eintritt. D ist
die Klappe, durch welche das Wasser aus dem Behaͤlter A in den Hals eintritt.
Da auch einige der Dimensionsverhaͤltnisse an meiner Erfindung von großem
Belange sind, so fuͤge ich hieruͤber Folgendes bei. 1) Die mittlere
Oeffnung in dem Canalgehaͤuse soll beilaͤufig den sechsten Theil des
Durchmessers des aͤußeren kreisrunden Canales haben. 2) Die
Scheidewaͤnde zwischen den kreisrunden Canaͤlen muͤssen so
duͤnn seyn, als es sich mit der noͤthigen Staͤrke derselben
vertraͤgt; und die Canaͤle selbst muͤssen vom Mittelpunkte aus
in geometrischer Progression an Durchmesser oder Weite zunehmen, wobei die mittlere
Oeffnung das erste Glied der Progression ist. 3) Jede der
stuͤkpfostenfoͤrmigen Oeffnungen, die sich in den kreisrunden
Canaͤlen befinden, muß 1/6 des ganzen Umfanges des Canales in der Weite, und
5/6 der Hoͤhe der Oeffnung, mit welcher der Hals in den kreisrunden Canal
eintritt, in der Hoͤhe haben. 4) Die Summe der Oeffnungen an dem Ende der
zwoͤlf Kegel I muß 10/17 der Summe der Oeffnungen
der fuͤnf Canaͤle des Halses in die fuͤnf kreisrunden
Canaͤle gleichkommen. 5) Endlich muß die Entfernung zwischen dem Ende des
Kegels I und dem Scheitel der kegelfoͤrmigen
unterhalb befindlichen Oeffnung, durch welche das Wasser in die Steigroͤhre
eindringt, beilaͤufig die Haͤlfte oder 3/4 des Durchmessers der am
Ende des Kegels befindlichen Oeffnung betragen; auch soll die unterhalb befindliche
kegelfoͤrmige Oeffnung an ihrem kleineren oder unteren Ende um 1/12 weiter
seyn, als die Oeffnung an dem unteren Ende des Kegels I.
Tafeln