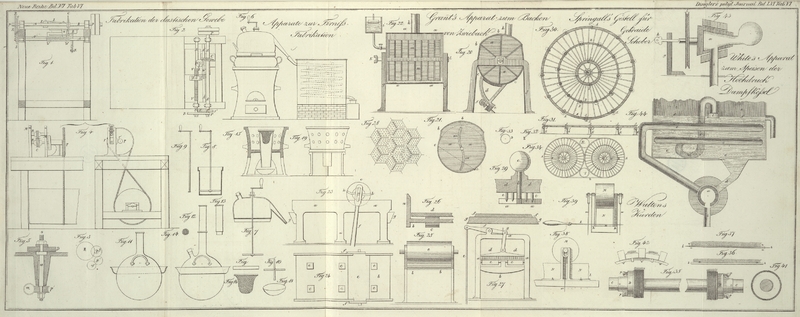| Titel: | Beschreibung des von Hrn. Thomas Grant erfundenen Apparates zum Baken von Zwiebak für Schiffe etc. |
| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LIX., S. 325 |
| Download: | XML |
LIX.
Beschreibung des von Hrn. Thomas Grant erfundenen
Apparates zum Baken von Zwiebak fuͤr Schiffe etc.
Aus den Transactions of the Society of Arts im
Mechanics'
Magazine, No. 606.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Grant's Apparat zum Baken von Zwiebak fuͤr Schiffe
etc.
Der erste Apparat dieser Art, der von Hrn. Thomas Grant,
Beamten an der koͤnigl. Werfte in Portsmouth, erfunden worden war, und
fuͤr welchen ihm die Regierung eine Belohnung von 2000 Pfd. Sterl.
bewilligte, wurde an dem Weovill-Victualling-Etablissement
errichtet.Wir haben im Polyt. Journale Bd. XLVIII. S.
420 Nachricht von der Maschine des Hrn. Grant gegeben; die neulich an derselben angebrachten
Verbesserungen veranlassen uns jedoch noch ein Mal auf sie
zuruͤkzukommen und auch eine Abbildung davon zu geben. Wir hoffen
hiedurch Vielen einen angenehmen Dienst zu erweisen. A. d. R. Seither schafften sich auch die beruͤhmten Schiffszwiebakfabrikanten
Fraser und Hullah in
Wapping einen solchen Apparat an, und diesen wollen wir mit den neuerlich daran
angebrachten Verbesserungen beschreiben und abbilden. Vorher erlauben wir uns jedoch
folgende Bemerkungen vorauszuschiken.
Die Vorzuͤge der neuen Methode vor der alten sollen in groͤßerer
Wohlfeilheit und Geschwindigkeit, groͤßerer Reinlichkeit bei besserer
Qualitaͤt des Fabrikates bestehen. Die bisherige Methode, nach welcher man in
der koͤnigl. Baͤkerei in Portsmouth den Schiffszwiebak fabricirte, war
folgende. Fuͤr den Dienst eines jeden der neun Oefen waren 5 Personen
aufgestellt, so daß also im Ganzen 45 Personen beschaͤftigt waren. Der erste
dieser 5 Arbeiter, der sogenannte Mischer, hatte das Mehl in gehoͤrigem
Verhaͤltnisse mit Wasser zu vermengen, und diese Materialien so genau als
moͤglich mit einander zu vermischen. Dieß vollbrachte er, indem er mit den
nakten Armen bis zu den Ellenbogen in die Masse fuhr, sie abknetete, und endlich
auch noch, indem er in den Trog sprang, und sie mit den Fuͤßen abtrat. Der
zweite Arbeiter vollendete das Kneten mittelst eines Hebels, auf den er mit seinem
ganzen Gewichte druͤkte; diesen Theil der Operation nannte man das
Niederreiten des Teiges. Der dritte Arbeiter theilte den Teig in Klumpen, die etwas
groͤßer waren, als ein Ei, und die dann in die Haͤnde seines
Gehuͤlfen kamen; dieser formte sie mit der Hand in die Zwiebake, und stach
sie mit einem eisernen Instrumente an, damit sich waͤhrend des Bakens im
Inneren keine Blasen bildeten. Die geformten Zwiebake wurden von dem vierten
Arbeiter auf die Schaufel des Schießers gelegt, der sie in den Ofen einschoß. Jeder
Ofen faßte 450 Bisquite, welche zusammen einen Centner wogen, und 2 Ladungen oder
900 Bisquite wurden jedes Mal in einer Stunde gebaken.
Dieses Verfahren war nicht nur sehr langsam, sondern es brachte auch noch folgende
Nachtheile mit sich. Der Mischer und der Kneter konnten selbst mit aller Sorgfalt
keine durchaus vollkommene und gleichfoͤrmige Mischung des Mehles und des
Wassers zu Stande bringen; und die Folge davon war, daß sich in den naͤsseren
Theilen Wasser aufhielt, bis es siedend heiß geworden, und daß es in diesem Zustande
auf das Staͤrkmehl des Mehles wirkte, wodurch der Zwiebak beim Troknen einen
glasigen Bruch und eine beinahe steinartige Haͤrte bekam. Der Schießer konnte
ferner die Masse nicht in vollkommen gleiche Portionen abtheilen; die Bisquite
bekamen also ungleiche Dike, und die Folge davon war, daß die duͤnneren
beinahe geroͤstet wurden, waͤhrend die dikeren so wenig gebaken waren,
daß sie in dem Schiffsraume bald schimmelig werden mußten.
An Hrn. Grant's Apparat wird nun der groͤßte Theil
der Arbeit durch Dampf verrichtet; die neun Oefen werden durch eine einzige
ununterbrochene Feuerstelle geheizt, indem die Flamme mittelst eines Registers in
jeden einzelnen Ofen eingelassen wird, sobald der fruͤhere Einsaz
herausgeschafft worden ist. Die Oefen sind auf diese Welse in 5 Minuten
gehoͤrig geheizt, und brauchen 14 bis 15 Minuten zum Ausbaken eines jeden
Einsazes; es koͤnnen mithin in jeder Stunde drei Einsaͤze gebaken
werden, und hiedurch wird, im Vergleiche mit der alten Methode, beinahe die
Haͤlfte an Zeit erspart.
Die erste der zu diesem Apparate gehoͤrigen Maschinen ist der sogenannte
Mischer (mixer), den man in Fig. 20 im Endaufrisse,
in Fig. 21 im
Querdurchschnitte und in Fig. 22 im
Laͤngendurchschnitte sieht. Er besteht aus einem gußeisernen Gehaͤuse
a, a von beinahe 4 Fuß Laͤnge und 3 Fuß
Durchmesser, der jedoch an dem oberen Theile um einige Zoll uͤber die
Kreisform hinaus erweitert ist, wie man dieß in Fig. 21 durch Punkte
angedeutet sieht. Die Halbmesser oder Radien, welche man in Fig. 20 sieht, dienen
bloß dazu, dem Gehaͤuse groͤßere Festigkeit und Staͤrke zu
geben. Die Thuͤre b, b oͤffnet sich nach
der ganzen Laͤnge des Gehaͤuses nach Innen, so daß der Arbeiter
jederzeit in das Innere schauen kann; eine andere groͤßere Thuͤre c, c oͤffnet sich nach Unten, und bei dieser wird
der Inhalt des Gehaͤuses herausgeschafft. Diese leztere Thuͤre wird
mit Huͤlfe eines gezaͤhnten Quadranten d
geoͤffnet und geschlossen, indem in diesen eine Schraube ohne Ende e eingreift, welche ihrerseits wieder durch die beiden
Winkelgetriebe f, die mittelst einer kleinen, in den
Tragpfosten g, g ruhenden Kurbel umgetrieben werden, in
Bewegung gesezt werden.
Diese Maschine vollbringt nun folgende Arbeit. Durch den Schlauch h gelangt aus dem oberen Stokwerke die erforderliche
Quantitaͤt Mehl in das Gehaͤuse herab; die noͤthige Wassermenge
wird durch eine Roͤhre mit einem Hahne aus dem kleinen Wasserbehaͤlter
i herbeigeschafft, und in diesem befindet sich ein
Schwimmer und ein Eichmaaß mit einer Schnur und Rolle, wodurch die Menge Wassers
bestimmt wird, die aus einem hoͤher gelegenen groͤßeren
Wasserbehaͤlter herabgelangte. Sobald das Mehl und das Wasser eingetragen
sind, laͤßt man die Dampfkraft auf die mitten durch das Gehaͤuse
laufende Welle k, l wirken, indem man die Welle durch
die Koppelbuͤchse k mit der Dampfmaschine in
Verbindung bringt. Die Welle, welche hiedurch sehr rasch umgetrieben wird,
fuͤhrt hiebei einen Rahmen mit 18 Messern oder Mischern m, m mit sich. Diese Messer, welche, wie Fig. 21 zeigt, etwas
gebogen sind, sind 2 Zoll breit und am Ruͤken 3/8 Zoll dik; sie sind an ihren
Enden mit aͤhnlichen, der Laͤnge nach laufenden Messern verbunden,
welche beim Umdrehen beinahe den Boden des Gehaͤuses beruͤhren. Auf
diese Weise wird das Mehl in sehr kurzer Zeit durch und durch innig mit dem Wasser
vermengt, und sobald dieß geschehen ist, wird der Teig mit den Haͤnden bei
der Thuͤre c, c herausgeschafft, und auf einen
Tisch gebracht, der sich so nahe als moͤglich an dem Mischer befinden muß,
und der nun sogleich beschrieben werden soll.
Fig. 23 ist
ein Aufriß, Fig.
24 ein Grundriß und Fig. 25 ein
Querdurchschnitt dieses Tisches. Er besteht aus einem gußeisernen Gestelle a, a, a mit eben solchen Fuͤßen, und aus einer
gußeisernen Tafel b, b von 6 1/2 Fuß Laͤnge und 3
Fuß Breite; in lezterer befinden sich die 6 Loͤcher c,
c etc., welche zur Aufnahme der Reibungsrollen dienen, auf denen die
Bretter, auf welche der Teig gelegt wird, laufen. Fig. 26 gibt einen
Durchschnitt der Seite a des Tisches in groͤßerem
Maßstabe. b ist die Tafel, c
eine der Reibungsrollen und d das Brett. Die Seiten a, a des Tisches tragen eine sehr schwere gußeiserne
Walze e von 18 Zoll im Durchmesser, welche, wenn sie auf
dem Tische aufruht, beilaͤufig 2 Zoll weit von dem Brette d entfernt ist. Diese Walze laͤuft abwechselnd
und mit großer Geschwindigkeit von einem Ende des Tisches zum anderen, und zwar
mittelst zweier Balken von 10 oder 11 Fuß Laͤnge, welche unter dem Boden des
Tisches an einem Zapfen aufgezogen und durch einen Winkelhebel der Dampfmaschine hin
und her bewegt werden. Das obere Ende des einen dieser Balken sieht man in Fig. 23 bei
f; man bemerkt hier an diesem oberen Ende das Fenster, in
welchem die Achse oder Welle der Walze spielt.
Hieraus erhellt offenbar, daß, wenn ein Stuͤk Teig aus der Mischmaschine
genommen und auf den Tisch gelegt wird, die Walzen dasselbe in einen Kuchen
auswalzen, der so dik ist, als die Walze von dem Brette entfernt ist; d.h., dessen
Dike hier in diesem Falle zwei Zoll betraͤgt. Waͤhrend dieses
Processes wird eine bedeutende Menge trokenes Mehl auf den Teig und die Tafel
gestreut, und damit nichts von diesem verloren gehen koͤnne, sind an dem Ende
der Tafel die Troͤge g, g angebracht, die das
Mehl aufnehmen, welches allenfalls durch die Walzen fortgeschleudert wird. Dieses
Bestreuens mit trokenem Mehle ungeachtet wuͤrde zuweilen etwas Teig an der
Walze haͤngen bleiben, wenn dieselbe nicht bestaͤndig rein erhalten
wuͤrde. Es geschieht dieß mittelst zweier duͤnner Messer oder Klingen,
die sich ihr gegenuͤber der ganzen Laͤnge nach erstreken, und welche
an zwei Paaren gebogener Arme angebracht sind, von denen man den einen h, h an dem Balken f
befestigt sieht. Wenn diese Operation voruͤber ist, so wird die Tafel mit dem
Teige weggeschafft, und eine andere, auf der dieselbe Operation von Neuem beginnt,
an deren Stelle gebracht. Die erste Tafel mit dem darauf befindlichen Teige gelangt
auf einer Reihe von Reibungsrollen auf einen zweiten vollkommen aͤhnlichen
Tisch; nur naͤhert sich hier die Walze der Tafel so weit, als es die Dike des
Bisquits erfordert. Der Teig, der auf dem ersten Tische in Kuchen von 2 Zoll Dike
ausgewalkt worden ist, wird in Stuͤke geschnitten, und in solchen auf die
zweite Tafel gelegt, auf der ihm dann schnell jene Dike gegeben wird, die das
Bisquit bekommen soll. Die Tafel oder das Brett, auf welchem sich diese
duͤnnen Teigschichten befinden, wird hierauf, fortwaͤhrend auf
Reibungsrollen laufend, in eine Maschine getrieben, die sogleich beschrieben werden
soll, waͤhrend der an dem zweiten Tische beschaͤftigte Arbeiter mit
einer neuen, vom ersten Tische heruͤber gelangenden Teigmasse auf gleiche
Weise verfaͤhrt.
Die Maschine, in welche der zur Zwiebakdike ausgewalzte Teig nunmehr laͤuft,
sieht man in Fig.
27. Sie besteht aus einem starken gußeisernen Gestelle a, a, a mit Querbalken b, in
welchem drei oder mehrere Walzenpaare c, c aufgezogen
sind; auf lezteren laͤuft das Brett oder die Tafel. Unmittelbar oberhalb
befindet sich eine dike Eisenplatte d, d von 3 Fuß im
Gevierte, und diese wird durch ein Excentricum, welches auf die Stange e, den Hebel f und die
Fuͤhrstange g wirkt, abwechselnd auf und nieder
bewegt. In der Zeichnung sieht man die Eisenplatte d in
ihrer tiefsten Stellung; in der hoͤchsten Stellung hingegen befindet sie
sich, wenn der Teig und die Tafel unter sie geschafft werden. So wie dieß geschehen ist, steigt die Platte
naͤmlich herab, um den Teig mittelst kleiner zollbreiter Messer, die an ihrer
unteren Flaͤche angebracht sind, in sechsekige Stuͤke oder Zwiebake zu
schneiden. Ein kleines Stuͤk der unteren Flaͤche dieser Platte a, a sieht man in Fig. 28 in
groͤßerem Maßstabe; und hier sieht man außer den im Sechseke gestellten
Schneidmessern auch noch eine Anzahl kleiner Punkte, welche Stifte vorstellen, mit
denen die Zwiebake vor dem Baken angestochen werden. Diese Stifte sind deßhalb auch
so lang, als die Messer breit sind, d.h. sie haben eine Laͤnge von 1 Zoll und
1/3 Zoll im Durchmesser; ihre Enden laufen jedoch spizig zu. Damit der Teig nicht an
der Platte a haͤngen bleibe und mit ihr in die
Hoͤhe gehoben werde, hat Hr. Grant eine sehr
sinnreiche Vorrichtung erfunden, welche man in Fig. 28 zum Theil
abgebildet sieht. In jedem Sechseke sieht man naͤmlich in der Mitte drei an
einander stoßende Arme, welche aus Eisen bestehen, und mit einem kleinen senkrechten
eisernen Stiele in Verbindung stehen. Diese Stiele gehen durch die Platte d, und sind an ihrem Ende mit einer eisernen Kugel von 2
Zoll im Durchmesser versehen, durch deren Gewicht der Stiel und die drei daran
befindlichen Arme nach Abwaͤrts gedruͤkt werden. Eine dieser Kugeln
mit ihrem Stiele und diesen Armen, so wie einen Theil der Platte d, d sieht man in Fig. 29, wo a, a die drei Arme, b den
Stiel, c die Kugel, f, f ein
Stuͤk Teig und g, g einen Theil der darunter
befindlichen Tafel vorstellt. Man wird hieraus ersehen, daß, so wie die Platte d, d emporsteigt, der Stiel b durch das Gewicht der Kugel c herabsinken,
und mit den Armen a, a so auf den Teig wirken muß, daß
dieser sowohl von den Schneidmessern, als von den Stiften losgemacht wird; dagegen
werden aber die Arme a, a, a, wenn die Platte d, d zum Behufe des Ausschneidens des Teiges
herabsteigt, an die Platte d, d emporgedruͤkt
werden. An jeder Platte von 3 Fuß im Gevierte befinden sich so viele Kugeln und
Stiele mit Armen, als Zwiebake ausgeschnitten werden sollen, naͤmlich ihrer
60. Man koͤnnte die Kugeln auch in Fig. 27 an der oberen
Flaͤche der Platte d sehen, wenn sie hier nicht
zu groͤßerer Deutlichkeit der uͤbrigen Theile weggelassen
waͤren.
Die sechsekigen Schneidinstrumente zertheilen uͤbrigens die Teigplatten nicht
so vollkommen, als daß dieselben nicht in einem Stuͤke in den Ofen
eingeschlossen werden koͤnnten. Dieses Einschließen geschieht mittelst einer
Eisenplatte, welche mit einem Bajonettgefuͤge an dem Stiele der Schaufel
befestigt ist. Die gebakenen Stuͤke werden endlich mit Leichtigkeit in
Zwiebake von der verlangten sechsekigen Form gebrochen.
Die ganze Anordnung aller dieser Maschinen haͤngt gewisser Maßen von dem
Gebaͤude, welches man zur Verfuͤgung hat, und von verschiedenen
anderen Umstaͤnden ab. Jedenfalls sollen sie so nahe als moͤglich an
einander angebracht werden, damit die Tafeln leicht auf Rollen aus einer Maschine in
die andere geschafft werden koͤnnen. Die Mischmaschine muß sich in der
Naͤhe des Wasser- und Mehlvorrathes, und die Schneidmaschine in der
Naͤhe des Ofens befinden. An der Wand soll eine Reihe von Rollen oder Walzen
angebracht seyn, auf denen die leeren Bretter wieder auf den ersten Tisch
zuruͤkgeschafft werden koͤnnen. In Portsmouth werden diese Walzen
mittelst der Dampfmaschine bestaͤndig umgedreht, damit die leeren Bretter an
die Mischmaschine zuruͤklaufen, ohne daß man irgend weiter Acht darauf zu
haben brauchte.
Tafeln