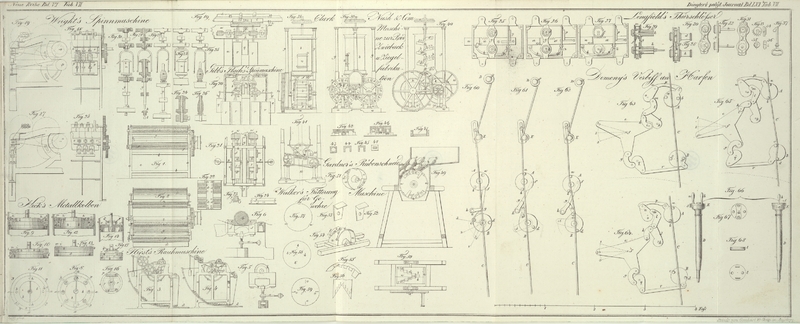| Titel: | Bericht des Hrn. Francoeur über eine Verbesserung, welche Hr. Domény in Paris, rue du Faubourg Saint-Denis, No. 82 an den Harfen mit sogenannter doppelter Bewegung anbrachte. |
| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LXX., S. 405 |
| Download: | XML |
LXX.
Bericht des Hrn. Francoeur uͤber eine Verbesserung,
welche Hr. Domény in Paris, rue du Faubourg Saint-Denis, No. 82 an den Harfen mit sogenannter
doppelter Bewegung anbrachte.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement. Januar 1835, S. 19.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Verbesserung an den Harfen mit sogenannter doppelter
Bewegung.
Die Harfen, deren man sich lange Zeit hindurch bediente, waren sowohl in Hinsicht auf
die Reinheit und den Klang der Toͤne, als in Hinsicht der daran
noͤthigen mechanischen Vorrichtungen nach fehlerhaften Methoden gebaut. Die
HH. Nadermann, bekannte und gewandte Kuͤnstler,
waren die ersten, die an diesem Instrumente wesentliche und so ausgezeichnete
Verbesserungen anbrachten, daß dieselben bald allgemein angenommen wurden.
Ich muß vorlaͤufig erinnern, daß die Harfen in Mi
Bmol aufgezogen sind, so daß jede Octave nur die Toͤne dieser
Tonleiter gibt. Um nun von dieser Tonart in eine andere uͤberzugehen,
muͤssen gewisse Saiten verkuͤrzt werden, um deren Stimmung zu
erhoͤhen; wenn z.B. eine Arie in Si Bmol gespielt
werden soll, so werden alle Mi natuͤrlich
gemacht, indem man sie um einen halben Ton erhoͤht, und eben so
verhaͤlt sich's auch bei den uͤbrigen Tonleitern. Diese
Verkuͤrzung gewisser Saiten geschieht durch einen eigenen Mechanismus, indem dieser mittelst
der Pedale senkrechte eiserne Stangen anzieht, die in der hohlen Saͤule der
Harfe verborgen sind. Diese Stangen pflanzen naͤmlich den auf das Pedal
ausgeuͤbten Druk an den oberen Theil der Saite fort: und zwar in der
Naͤhe der Schraube, die zum Spannen dieser Saite dient; es wird dadurch ein
Apparat in Bewegung gesezt, der beinahe dieselben Verrichtungen versieht, wie sie
der Violinspieler durch den Druk des Fingers auf die Saiten vollbringt.
Dieser Apparat der HH. Nadermann, der unter den
Kuͤnstlern unter dem Namen des Hakenapparates (appareil à crochet) bekannt ist, weil dessen wesentlichster Theil
in einem Haken besteht, bedarf hier keiner weiteren Beschreibung, indem er in keiner
Beziehung zu dem Apparate des Hrn. Domény steht.
Es mag genuͤgen, wenn wir bemerken, daß ein kleiner Hebel, welcher oben an
der Harfe in dem Bande verborgen ist, sobald er beim Aufdruͤken auf das Pedal
von seiner Stange angezogen wird, seinerseits ein Messingstuͤk, den
sogenannten Finger oder Schuh (sabot), anzieht, und ihn
mit so viel Kraft gegen die Saite fuͤhrt, daß diese dadurch gehoͤrig
an das Band angedruͤkt wird. Dieser Finger oder Schuh ist daher, wie man
sieht, ein vollkommenes Analogon des Fingers des Violinspielers.
Die Nadermann'sche Harfe hat demnach an ihrem unteren
Theile eine Krone, aus welcher sieben staͤhlerne, in senkrechten Spalten
bewegliche Pedale hervorragen. Um die Tonart zu veraͤndern, sezt man daher
den Fuß auf jenes dieser Pedale, welches der neuen Tonart entspricht, wodurch das
Pedal herabgedruͤkt und einer Querspalte gegenuͤber gebracht wird, in
die man es einschiebt. In dieser Stellung verbleibt dann das Pedal so lange, als
diese Tonart beibehalten wird, worauf man es wieder frei macht, damit die primitive
Tonart wieder hergestellt werde. Wenn nun das Pedal auf solche Weise
herabgedruͤkt wird, so bewirkt es an einer Stange einen Zug, und diese treibt
dann einen kleinen Finger oder Schuh gegen die Saite, wodurch diese gegen das Band
angedruͤkt und mithin verkuͤrzt wird. Dieser Schuh wird von dem
Fabrikanten genau an einem solchen Punkte angebracht, daß der Ton dadurch um einen
halben Ton erhoͤht wird; und dieser Punkt laͤßt sich durch eine ganz
einfache Berechnung auffinden, indem die Totallaͤnge der Saite fuͤr
jeden Ton bekannt ist. Da dieses Instrument einen fixen Ton hat, so wird es wie die
Fortepianos nach den Gesezen der gleichen Intervallen oder der gleichen Temperatur
gestimmt.
Man hat gegen diese Harfe Nadermann's verschiedene
Einwuͤrfe gemacht; ihr Mechanismus ist auch etwas roh, er geraͤth leicht in Unordnung, und
die zu ihrer Stimmung noͤthige Temperatur entzieht den Toͤnen einen
Theil ihrer Genauigkeit. Sebastian Erard erfand daher vor
laͤngerer Zeit seine Harfe mit doppelter Bewegung, deren Toͤne viel
genauer und richtiger sind, und deren Mechanismus auch leichter beweglich ist. Die
Pedale ziehen auch hier an Stangen, welche zum Behufe der Verkuͤrzung der
Saiten auf Apparate wirken, die in dem oberen Bande angebracht, und eben so einfach
als sinnreich sind. Man sieht an dem Bande der Erard'schen Harfe naͤmlich außen unter jeder Saite eine kleine Scheibe,
den sogenannten Knebel (tourniquet), an welchem sich zwei starke senkrechte Zapfen befinden,
zwischen denen die Saite durchgeht, ohne sie zu beruͤhren. Wenn man auf das
Pedal tritt, so dreht sich dieser Knebel um seine Achse, wo dann die Saite, die
fruͤher keinen der Zapfen beruͤhrte, in leichtem Zigzag gegen
dieselben angedruͤkt wird. So wie man diese Vorrichtung, die eine Gabel (fourchette) genannt wird, um die Centralachse dreht, so
draͤngt sie ihre beiden Zaͤhne oder Zapfen gegen die Saite, und sperrt
dieselben daran, so daß also schon auf diese Weise eine Verkuͤrzung der Saite
erfolgt, wenn man das Pedal in die horizontale, ihm entsprechende Fuge
einhaͤngt. Dieß ist jedoch noch nicht Alles; denn wenn man das Pedal nicht in
diese Fuge einschiebt, sondern noch etwas weiter herabdruͤkt, so wird sich
eine zweite horizontale Fuge darbieten. Man bemerkt zu diesem Behufe an dem oberen
Bande eine zweite Reihe von Knebeln, welche in einer gebogenen Linie unter den
ersteren angebracht, und gleichfalls mit Gabeln versehen sind, die auch ihrerseits
wieder die Saiten erfassen, und sie abermals um einen halben Ton verkuͤrzen.
Diese Gabeln bewegen sich das erste Mal kaum von ihrer Stelle und vollbringen erst
beim zweiten Male ihre Verrichtungen. Die Erard'sche
Harfe mit doppelter Bewegung braucht daher nicht mehr durch Intervallen oder
Temperatur zu stimmen; das Si Bmol ist nicht mehr
dasselbe wie das Kreuz, sondern wird von einer anderen Saite gegeben. Wenn man das
Pedal zum ersten Male einhaͤngt, wodurch der Bmol-Ton der Saite unberuͤhrt gemacht wird, so gibt man dieser
den natuͤrlichen Ton wieder; so wie man dasselbe aber zum zweiten Male
einhaͤngt, so wirkt nun auch der untere Knebel, und spannt die Saite bis zum
Kreuz: so daß man also hier wirklich 21 Toͤne in der Tonleiter finden kann,
waͤhrend man mir der Nadermann'schen Harfe ihrer
nur 12 erhielt.
Da heut zu Tage beinahe nur mehr diese Harfe mit doppelter Bewegung
gebraͤuchlich ist, so suchte Hr. Domény
dieses Instrument noch auf zweierlei Weise zu vervollkommnen. Erstlich erhellt von
selbst, wie schwer es ist, die Gabeln ganz genau so anzubringen, daß die kleinen
Zwischenraͤume der Komma's, die nur bei der Ausfuͤhrung eines
Musikstuͤkes bemerkbar sind, dadurch ausgedruͤkt werden. Da
uͤberdieß jeder Theil seine bestimmte und fixe Stelle hat, so bemerkt man
erst sehr spaͤt, und wenn das Instrument bereits fertig ist, daß man ihm
nicht die gehoͤrige Stelle angewiesen hat. Hr. Domény kam daher auf die Idee, der Gabel eine Bewegung auf dem
Knebel zu geben, und brachte zu diesem Behufe die beiden Zapfen auf einem
Stuͤke an, welches sich in einem schwalbenschwanzfoͤrmigen Falze
bewegt, und welches durch zwei Drukschrauben festgestellt werden kann. Wenn demnach
der Fabrikant oder auch nur der Spielende in irgend einem Knebel einen Fehler in der
Tonart erkennt, so kann er ihm leicht abhelfen; d.h. er braucht nur die beiden
Schrauben nachzulassen, um sie, nachdem der Traͤger der Gabel um etwas
verschoben worden ist, neuerdings wieder anzuziehen. Es wird hiedurch sehr leicht
die Gabel an jene Stelle zu bringen seyn, die sie haben muß, damit die Saite die zur
Genauigkeit der Stimmung erforderlichen Toͤne gibt; es wird zwar freilich ein
sehr geuͤbtes Ohr hiezu erforderlich seyn; allein eine solche Operation wird
auch nur von einem solchen Ohre fuͤr noͤthig gefunden werden. Dieser
von Hrn. Domény erfundene Mechanismus ist sehr
nuͤzlich und sehr einfach; uͤbrigens besteht die Erfindung nicht in
ihm allein.
Die Stangen, welche an der Erard'schen Harfe auf die
Knebel wirken, sind zwar allerdings sehr gut eingerichtet; allein man entdekte doch
auch an ihnen einige Maͤngel, und diesen hat Hr. Domény durch einen neuen, von ihm in Vorschlag gebrachten
Mechanismus abgeholfen. Wenn man naͤmlich auf ein Pedal tritt, um es das
erste Mal einzuhaͤngen, so bewegt sich der obere Knebel allein fuͤr
sich, waͤhrend der untere unbeweglich bleibt, und erst dann in
Thaͤtigkeit kommt, wann man das Pedal noch weiter herabdruͤkt. Dieß
war fruͤher nicht der Fall; denn hier drehte die erste Bewegung die beiden
Knebel gemeinschaftlich, und zwar den oberen vollkommen, und den unteren zum Theil,
so daß dieser leztere seine Umdrehung erst bei der zweiten Bewegung des Pedales
vollendete; die Folge hievon war, daß sich der untere Knebel im ersten Falle
zuweilen zu weit bewegte, und daß die Saiten also zuweilen anstreiften.
Wir muͤssen uͤbrigens hier bemerken, daß noch saͤmmtliche
Methoden die Saiten der Harfen zu verkuͤrzen nichts weniger als vollkommen
sind; denn man veraͤndert einerseits die Spannung, wodurch der Ton mehr
veraͤndert wird, als es durch die einfache Verkuͤrzung geschehen
sollte; und andererseits ruht die Saite, wenn sie solcher Maßen zwischen den beiden
Zaͤhnen der Gabel festgehalten wird, und wenn sie folglich kleine
kniefoͤrmige Biegungen macht, auf der Oberflaͤche eines Cylinders, so
daß die Beruͤhrungspunkte also bei den Schwingungen der Saite nothwendig
einige leichte Veraͤnderungen erleiden muͤssen. Daraus entsteht eine
Art von Anstreifen, indem die Totallaͤnge der vibrirenden Saite einigen
Veraͤnderungen unterworfen ist, und dadurch leidet die Reinheit des Tones
Schaden; so wie denn auch Jedermann weiß, daß die unbetasteten Saiten der Violinen
und Violoncelle einen klangvolleren Ton haben, als die mit den Fingern gegriffenen.
Aus diesem Grunde, und um alle Contraste zu vermeiden, suchen die Kuͤnstler
das Anspielen ungegriffener Saiten so viel als moͤglich zu umgehen. Bei der
Harfe ist dieser Mangel in hohem Grade fuͤhlbar. Dessen ungeachtet
haͤlt aber die Commission die Verbesserungen, welche Hr. Domény an der Harfe anbrachte, fuͤr so
wesentlich, daß sie dieselben durch den Bulletin bekannt
zu machen, und ihm den Dank der Gesellschaft dafuͤr auszubruͤten
vorschlaͤgt.
Bevor wir hier in eine specielle Beschreibung des Mechanismus der Harfe des Hrn. Domény eingehen, muͤssen wir zu
groͤßerer Deutlichkeit noch eine kurze Beschreibung jener Vorrichtung
vorausschiken, auf welche sich im August 1811 Hr. Erard
ein Patent fuͤr 15 Jahre ertheilen ließ, und welche man in der Description des brevets Th. XIV. S. 10
ausfuͤhrlich beschrieben findet.
Fig. 60 zeigt
die Scheiben der Gabeln nachgelassen und in solchem Zustande, daß die Saite C frei ist, und sich im Bmol
Tone befindet Die Gabel A der ersten Einhaͤngung
hat zwei Zapfen a, b, welche die Saite fassen; die
zweite Gabel B ist mit zwei aͤhnlichen Zapfen c, d versehen, welche dasselbe Geschaͤft
verrichten. Das von dem Hebel h und der Platte e gebildete Winkelstuͤk ist dazu bestimmt, die
Platte g, f durch eine Kreisbogenbewegung außer ihrer
Linie zu bringen, um sie dadurch strebepfeilerartig an den Stuͤzpunkt der
ersten Einhaͤngung zu bringen, wie man dieß in Fig. 61, wo die Saite in
der Stellung des natuͤrlichen Tones ersichtlich ist, bemerkt.
Sobald die Bewegung zur ersten Einhaͤngung geschehen ist, bildet das
Stuͤk h nur mehr eine gerade Linie mit der Platte
g, f, wo dann diese leztere Platte, indem sie sich
einerseits gegen den Zapfen des Stuͤkes h, und
andererseits gegen die Tangente der oberen Scheibe, Fig. 61 stemmt, wie in
einem Schraubstoke festgehalten ist, und einen solchen Widerstand leistet, daß aller
weitere Druk auf das Pedal keinen Einfluß auf sie hat. Die zweite
Einhaͤngung, Fig. 62, bei der sich die Saiten in der Stellung der Bekreuzung befinden,
erfolgt auf eine von der ersten vollkommen unabhaͤngige Weise; denn sie geschieht nur mehr
durch die Bewegung der Platte e, wodurch die untere
Scheibe durch Umdrehung um den Punkt g, allein ohne
Beeintraͤchtigung der Linie h, g, f, an den
Einhaͤngepunkt gebracht wird.
Die in Fig. 60
ersichtlichen Linien 1, 2 und 3 bezeichnen die verschiedenen Stellungen der Gabeln;
befindet sich der Hebel i an dem Punkte 1, so ist die
Saite frei; befindet er sich an dem Punkte 2, so ist sie von der oberen Gabel
gefaßt, und befindet er sich endlich dem Punkte 3 gegenuͤber, so ist sie von
beiden Gabeln ergriffen.
Bei der zweiten Einhaͤngung hat der Druk des Fußes auf das Pedal eine
groͤßere Wirkung, als bei der ersten; allein dieser Druk genuͤgt, um
der auf die Schraube D aufgewundenen und uͤber
den ausgefalzten Kamm E laufenden Saite C die gehoͤrige Festigkeit zu geben.
Hr. Domény hat an seiner neuen Harfe, auf welche er
sich am 24. September 1834 ein Patent fuͤr 5 Jahre ertheilen ließ, eine
solche Einrichtung getroffen, daß in dem Augenblike, in welchem die Saite erfaßt
werden soll, die untere Gabel der oberen genaͤhert oder davon entfernt wird.
Anstatt daher diese Gabel an ihrer Achse zu fixiren, macht er sie beweglich, so
zwar, daß sie entweder oben oder unten nach Belieben um eine bestimmte
Quantitaͤt excentrirt werden kann. Wenn daher der Ton zu tief ist, so
laͤßt der Spielende die Gabel herab, wo dann die Saite kuͤrzer und der
Ton folglich staͤrker wird; ist der Ton hingegen zu hoch, so schafft er die
Gabel wieder hinauf, wodurch die Saite laͤnger und mithin der Ton tiefer
wird. Ist die wahre Stellung der Gabel bestimmt, so befestigt man sie mittelst eines
Steges, der mit zwei kleinen Schrauben angezogen wird. Diese neue Methode die
zweiten halben Toͤne zu reguliren, ist jedoch nur auf die lezten Saiten, d.h.
auf die 20 oder 24 hoͤchsten Noten anwendbar.
In Fig. 63 ist
die Saite C frei; in Fig. 64 ist sie von der
oberen Gabel gefaßt, und in Fig. 65 von beiden
zugleich. Die Gabeln werden mittelst eines dreiarmigen Winkeleisens e, an dessen einem Arme die Stange des Pedales
eingehaͤngt ist, in Bewegung gesezt. Dieses Winkeleisen, welches sich um den
Zapfen f bewegt, ist mit zwei gebogenen Hebeln g, h versehen, von denen der obere h, indem er sich um den Punkt i dreht, das Stuͤk k mit sich
fuͤhrt. Dieses leztere hat den Mittelpunkt seiner Bewegung in k, und ist mit einem zweiten Hebel l versehen, der an dem Punkte m mit einem um o beweglichen Schwengel n in Verbindung steht; an diesem Schwengel ist eine
Schleuder p angebracht, welche die Gabel A umdreht. An die Gabel B
hingegen wird die Bewegung durch einen Schwengel q, der mit der
Schleuder r in Verbindung steht, fortgepflanzt. Wenn
sich jener Arm des Winkeleisens e, an welchem sich die
Stange des Pedales befindet, in der hoͤchsten Stellung, d.h. an jenem Punkte
befindet, der in Fig. 63 mit 1 bezeichnet ist, so ist die Saite frei; wird er hingegen von
der Stange an den Punkt 2 gezogen, so wird die Saite von der oberen Gabel erfaßt,
waͤhrend die untere Gabel unbeweglich bleibt; gelangt er hingegen an den
untersten oder an den mit 3 bezeichneten Punkt, so kommt auch die Gabel B in Bewegung, so daß nun beide Gabeln zugleich
wirken.
Fig. 66 zeigt
die untere Gabel im Aufrisse, von Vorne und von der Seite, und zwar mit ihrer Achse
D versehen. In Fig. 67 sieht man sie im
Grundrisse, waͤhrend Fig. 68 einen
Grund- und Aufriß der Scheibe t gibt, in der zur
Aufnahme der Schrauben des Steges u zwei
Laͤngenspalten angebracht sind. Der untere Theil dieser Scheibe ist
schwalbenschwanzfoͤrmig geschnitten, und paßt zum Behufe der Excentrirung in
einen entsprechenden, in den Knebel E geschnittenen
Falz. Wenn die Gabel in die aus Fig. 66 ersichtliche
Stellung gebracht worden ist, so befestigt man sie in dieser, indem man die beiden
Schrauben des Steges u anzieht. Wenn demnach die Gabel
B der Gabel A
genaͤhert werden muͤßte, um einen allenfallsigen zu hohen Viertelton
herunterzustimmen, so braucht man nur die beiden kleinen Schrauben des Steges u loszuschrauben, um die Scheibe t in ihrem Falzen schieben und so weit empor schaffen zu koͤnnen,
daß sie die in Fig.
66 ersichtliche Excentricitaͤt erhaͤlt. Schiebt man die
Scheibe hingegen von Oben nach Unten, so wird die Saite dadurch nothwendig
verkuͤrzt, und der Ton mithin erhoͤht werden.
Tafeln