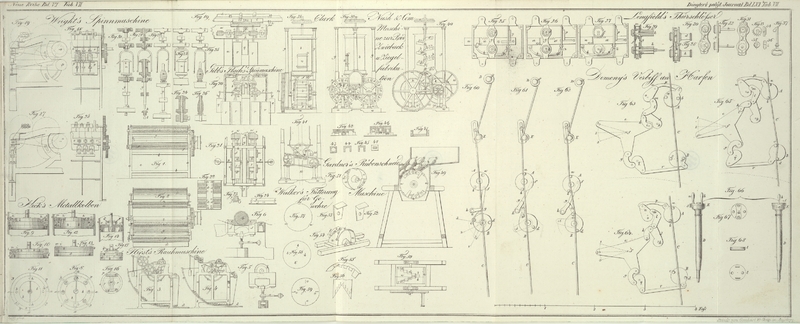| Titel: | Verbesserungen an den Thür- und anderen Schlössern, worauf sich William Longfield, Weißblech-Fabrikant von Otley, in der Grafschaft York, am 6. Septbr. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 56, Jahrgang 1835, Nr. LXXI., S. 411 |
| Download: | XML |
LXXI.
Verbesserungen an den Thuͤr- und
anderen Schloͤssern, worauf sich William Longfield, Weißblech-Fabrikant
von Otley, in der Grafschaft York, am 6. Septbr.
1834 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. April 1835, S.
1.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Longfield's Verbesserungen an den Thuͤr- und anderen
Schloͤssern.
Die unter gegenwaͤrtigem Patente begriffene Erfindung besteht in einem neuen
Mechanismus eines Schlosses, an welchem ein Hebelriegel (lever-bolt) so angebracht ist, daß er auf den gewoͤhnlichen
Schieberriegel (sliding-bolt) eines Schlosses
wirkt, und diesen festhaͤlt, sobald er beim Sperren des Schlosses vorgeschoben worden
ist. Durch die Anwendung dieses Hebelriegels kann der abgesperrte Schieberriegel
naͤmlich nicht eher nach Ruͤkwaͤrts bewegt werden, als bis man
das Ende des Hebelriegels vorher mit einem Schluͤssel zuruͤkzog.
Fig. 25 und
26
zeigen den inneren Bau eines nach diesem verbesserten Plane verfertigten Schlosses,
woran jedoch das Schloßblech weggenommen ist, damit man die beweglichen Theile
deutlich ersehen kann. a, a ist der Schieberriegel und
b, b der Hebelriegel, dessen Ende, wie man sieht, in
einen an der unteren Seite des Schieberriegels angebrachten Ausschnitt c einpaßt, wenn man verhindern will, daß lezterer aus
der Stellung gebracht werden kann, in der er sich befindet, wenn er abgesperrt ist.
Fig. 27
zeigt das Gerippe des Schlosses, woraus man die arbeitenden Theile noch deutlicher
ersieht.
An dem oberen Rande des Riegels a ist eine Zahnstange
gebildet, in welche zum Behufe der Verschiebung dieses Riegels die Zaͤhne des
Getriebes e eingreifen; dagegen ist unterhalb ein
Muschel- oder Klopfrad i angebracht, welches auf
den Hebelriegel b wirkt, um ihn herabzudruͤken.
Der Hebel ist zu diesem Zweke auch bei z an einem
Stuͤzpunkte angebracht, und wird durch die Feder y emporgehoben. Das Schluͤsselloch, durch welches der zur
Verschiebung des Riegels a dienende Schluͤssel
eingestekt wird, besteht aus einer cylindrischen Roͤhre d, welche so lang seyn soll, daß sie sich durch das Holz
der Thuͤre hindurch erstrekt, um außen in einer Flaͤche mit ihr zu
endigen. Hinter dieser Roͤhre befindet sich ein Getrieb e mit einem Ausschnitte, in welchen der Bart des
Schluͤssels eindringt, wenn dasselbe umgedreht werden soll. Da aber die
Zaͤhne dieses Getriebes in die an der oberen Seite des Schieberriegels a gebildete Zahnstange eingreifen, so muß, wenn der
Schluͤssel umgedreht wird, das Getrieb den Riegel hin und her bewegen. Die
Roͤhre h, welche dieselben Dimensionen hat, wie
die Roͤhre d, bildet das Schluͤsselloch
fuͤr den Schluͤssel, womit auf den Hebelriegel b gewirkt wird, und hinter dieser Roͤhre ist die Muschel-
oder Klopfwalze i angebracht, in welche der Bart des
Schluͤssels eingreift.
Fig. 28 ist
ein Querdurchschnitt des Schlosses, woraus man die Stellung dieser
Schluͤssellochroͤhren und des Getriebes e,
des Schieberriegels a, der Muschel- oder
Klopfwalze i, und des zwischen den beiden Platten f und g eingeschlossenen
Hebelriegels b ersieht. Fig. 29 ist ein
aͤhnlicher Durchschnitt, der durch die Schluͤssellochroͤhren
d und h, durch das
Getrieb e, durch den Schieberriegel a, die Muschelwalze i, den
Hebelriegel b und die parallelen Platten f und g
genommen ist. Fig. 30 zeigt
die innere Seite der parallelen Platte f, und Fig. 31
ebendiese Seite der parallelen Platte g. Fig. 32 zeigt die leztere
dieser Platten mit den Fuͤhr- oder Leitungszapfen k und l, welche in die
Schluͤssellochroͤhren hineinragen, von der Kante her dargestellt. Der
groͤßeren Deutlichkeit halber ist in Fig. 33 auch noch das
Getrieb e von Vorne, und in Fig. 34 von der Seite;
die Muschelwalze i in Fig. 35 von Vorne und in
Fig. 36
von der Seite, und in Fig. 37 der
Schluͤssel einzeln fuͤr sich abgebildet. Das Getrieb e wird in der Stellung, in der man es in Fig. 33 sieht, in sein in
der parallelen Platte f befindliches Lager, und die
Muschelwalze in ihr in ebendieser parallelen Platte angebrachtes Lager eingesezt;
und erst nachdem dieß geschehen ist, wird auch die andere parallele Platte g an Ort und Stelle gebracht, und wie man aus Fig. 28 und
29
ersieht, mit den Schrauben m, m befestigt. Auf diese
Weise werden dann die Schultern des Getriebes e und jene
der Walze i in ihren Lagern in den beiden parallelen
Platten festgehalten: jedoch so, daß sie sich frei umdrehen koͤnnen. Der in
Fig. 37
abgebildete Schluͤssel ist dem hier beschriebenen Schlosse angepaßt; die
Seiten seines Bartes passen genau in die Schluͤsselloͤcher oder
Oeffnungen in dem Getriebe e und in der Walze i, und die Stufen in dem Barte entsprechen Abstufungen,
welche bei n in dem hinteren Theile der Roͤhre
h angebracht sind. Der Patenttraͤger
beschraͤnkt sich uͤbrigens auf keine bestimmten Abstufungen in den
Schluͤsselbarten, sondern er modificirt dieselben auf verschiedene und
beliebige Weise; er bemerkt hiebei nur, daß die Schluͤsselloͤcher der
Roͤhren d und h, so
wie das Getrieb e, die Walze i und die Form der Abstufungen in der Roͤhre h dem Schluͤssel entsprechen muͤssen; und daß auch die
innere Form der Roͤhren eine solche seyn muͤsse, daß der
Schluͤssel eine oder mehrere Umdrehungen oder auch nur einen Theil einer
Umdrehung machen muß, bis er dahin gelangen kann, wo dessen Bart auf das Getrieb
oder die Muschelwalze wirken kann.
Wenn der Schluͤssel durch die Roͤhre d
eingefuͤhrt, und das Getrieb e umgetrieben worden
ist, so wird der Riegel vorgeschoben werden, wie man es in Fig. 25 sieht; und dann
wird der Hebelriegel b durch die Kraft der Feder y emporgehoben, und mit dem einen Ende so in den
Ausschnitt c des Schieberriegels eingetrieben werden,
daß lezterer in seiner abgesperrten Stellung festgehalten wird. Soll daher das
Schloß wieder geoͤffnet oder der Riegel zuruͤkgezogen werden, so muß
der Schluͤssel zuerst durch die Roͤhre h
eingefuͤhrt, und die Muschelwalze herum gedreht werden, bis sie in jene
Stellung geraͤth, in der man sie in Fig. 27 bei i sieht; denn dadurch wird der Vorsprung oder der Zahn an
dieser Walze auf den Hebelriegel wirken, ihn herabdruͤken, und dadurch dessen
Ende wieder aus dem Ausschnitte des Schieberriegels zuruͤkziehen. Die
Bewegung der Walze wird hiebei durch einen Zapfen o
beschraͤnkt, der aus der Platte g hervorragt, und
der sich zwischen zwei kleinen, an dem Umfange der Muschelwalzen befindlichen
Vorspruͤngen bewegt. Der Schluͤssel kann dann aus der Roͤhre
h gezogen und in die Roͤhre d gestekt werden, wo dann das Getrieb e so umgedreht werden kann, daß der Schieberriegel in
die aus Fig.
26 ersichtliche Stellung zuruͤkgeschoben wird. p ist eine Reibungsfeder, welche gegen die Seite des
Schieberriegels wirkt, und dadurch der Bewegung dieses lezteren eine groͤßere
Staͤtigkeit gibt. Es versteht sich, wie der Patenttraͤger bemerkt, von
selbst, daß man die Stellung des Hebelriegels h, und
jene der Zahnstange und des Getriebes e auch umkehren
kann, oder daß sich beide auch so anbringen lassen, daß sie auf eine und dieselbe
Seite des Schieberriegels wirken. Der Patenttraͤger erklaͤrt daher
hauptsaͤchlich auch die Anwendung des Hebelriegels, der den Schieberriegel
zuruͤkhaͤlt, als seine Erfindung, auf welche Weise diese Vorrichtung
auch immer angewendet werden mag.
Tafeln