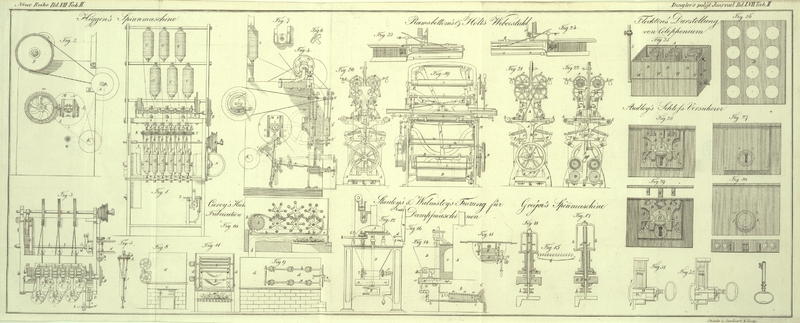| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zur Hutfabrikation, worauf sich George Daniell Carey, Hutfabrikant von Badford, in der Grafschaft Nottingham, am 22. Oktober 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 57, Jahrgang 1835, Nr. XIX., S. 103 |
| Download: | XML |
XIX.
Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zur
Hutfabrikation, worauf sich George Daniell Carey,
Hutfabrikant von Badford, in der Grafschaft Nottingham, am 22. Oktober 1834 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of
Arts. Mai 1835, S. 77.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Verbesserte Maschinen und Apparaten zur Hutfabrikation.
Gegenwaͤrtige Erfindung besteht in der Anwendung eines Walzensystemes zum
Behufe des sogenannten Vergoldens (ruffing or plaiting) der
Huͤte: d.h. zur Verkoͤrperung der Biber- oder sonstigen Haare
mit dem Filze oder dem Koͤrper der Huͤte ohne Beihuͤlfe der
gewoͤhnlich hiezu erforderlichen Handarbeit.
Fig. 8 ist ein
Fronteaufriß der Maschine; Fig. 9 stellt einen
Seitenaufriß vor; Fig. 10 ist ein Laͤngendurchschnitt, und Fig. 11 ein
Querdurchschnitt. Gleiche Buchstaben beziehen sich an allen Figuren auf gleiche
Gegenstaͤnde.
Auf einem Ziegelgemaͤuer oder einer anderen entsprechenden Basis ist ein Ofen
oder eine Feuerstelle a mit einem nach Abwaͤrts
steigenden Feuerzuge b angebracht, durch den der Rauch
entweicht. Ueber dem Ofen befindet sich eine Pfanne oder ein seichtes Gefaͤß
aus Blei c, c, welches zur Aufnahme einer sauren
Fluͤssigkeit, wie z.B. einer Aufloͤsung von Schwefelsaͤure in
Wasser bestimmt ist. Dieses Gefaͤß ist an drei Seiten von dem
hoͤlzernen Gehaͤuse d, d umschlossen,
waͤhrend man an der vierten Seite freien Zutritt zu demselben hat. In den
Seitenwaͤnden dieses Gehaͤuses sind uͤber einander zwei Reihen
von sogenannten Laternwalzen e, e, e und f, f, f aufgezogen, deren Achsen sich in diesen
Seitenwaͤnden drehen; ihre Umdrehungen werden durch Winkelgetriebe
hervorgebracht, die an den Enden ihrer Achsen befestigt sind, und in welche andere,
an den Wellen g und h
aufgezogene Winkelraͤder eingreifen. Das Ganze wird, wie Fig. 8 und 9 zeigen, mittelst einer
Kurbel eines Raͤderwerkes in Bewegung gesezt.
Wenn der Koͤrper oder der Filz der Huͤte auf die gewoͤhnliche
Weise zubereitet, und die gewoͤhnliche Schichte Biber- oder anderer
Haare darauf gelegt worden ist, so werden die Huͤte zwischen
Haartuͤcher gebracht, und mit diesen dann in Canevaß oder in einen anderen
geeigneten Umschlag eingeschlagen. Wenn auf diese Weise drei oder mehrere
Huͤte in jeden Umschlag gebracht worden sind, so stekt man diese Pakete
einzeln in die Soke oder Taschen eines aus Saktuch oder einem anderen geeigneten
Materiale verfertigten endlosen Bandes, und zieht dieses uͤber die
Laternwalzen der Maschine.
Zuerst, d.h. anfangs, wo die Haare nur an dem Filze befestigt werden sollen, zieht
der Patenttraͤger das endlose Band k, k, k mit
den darin befindlichen Huͤten uͤber die obere Reihe von Laternwalzen
f, f, f, damit das Haar nicht in Unordnung gerathe,
wenn die Huͤte allenfalls in die saure, in der Pfanne befindliche
Fluͤssigkeit eingetaucht wuͤrden, bevor noch das Haar gehoͤrig
befestigt worden ist. Nachdem dieß geschehen ist, wird das endlose Band k, k, k dann uͤber die unteren Laternwalzen e, e, e und die Fuͤhrwalze l, wie man dieß in Fig. 10 sieht,
gefuͤhrt; und nachdem sie auch durch diese gelaufen, untersucht man die
Huͤte, aͤndert deren Biegungen, schlaͤgt sie neuerdings in Flanell oder in andere
derlei Zeuge und bringt sie abermals in die Taschen des endlosen Bandes.
Wenn nun die Maschine auf die angegebene Weise in Bewegung gesezt wird, so werden die
Huͤte durch den ganzen Apparat gefuͤhrt, und dabei der heißen
Aufloͤsung, die sich in der Pfanne befindet, und dem Druke, so wie auch der
windenden Einwirkung der Rippen der Laternwalzen ausgesezt. Die Folge hievon ist,
daß die Enden der Haare sich so in den Filz der Huͤte einarbeiten, daß sie
mit gehoͤriger Festigkeit darin befestigt sind.
Der Patenttraͤger bemerkt, daß er sich nicht genau auf die hier beschriebene
Form der Maschine beschraͤnke, sondern er dieselbe verschieden modificire,
und namentlich den Riefen oder Rippen der Walzen verschiedene Formen
gaͤbe.
Tafeln