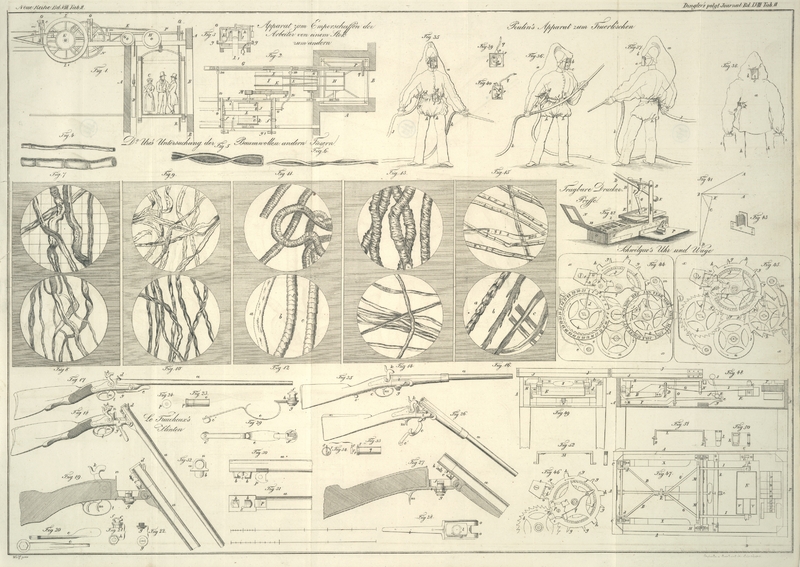| Titel: | Bericht des Hrn. Francoeur über eine Uhr, welche das Datum anzeigt, und über eine zum Hausgebrauch bestimmte Waage, beide von der Erfindung des Hrn. Schwilgué in Straßburg und in Paris, rue du Faubourg St. Denis, No. 88. |
| Fundstelle: | Band 58, Jahrgang 1835, Nr. XIII., S. 125 |
| Download: | XML |
XIII.
Bericht des Hrn. Francoeur uͤber eine Uhr, welche das
Datum anzeigt, und uͤber eine zum Hausgebrauch bestimmte Waage, beide von der
Erfindung des Hrn. Schwilgué in Straßburg und in
Paris, rue du Faubourg St. Denis,
No. 88.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement. April 1835, S. 149.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Bericht uͤber eine Uhr und eine zum Hausgebrauch bestimmte
Waage.
Es gibt bereits mehrere sehr sinnreiche Mechanismen, womit man bewirken kann, daß die
Zeiger eines Uhrwerkes die Namen der Monate und das Datum eines jeden Tages
andeuten. Diese Vorrichtungen, welche schon an und fuͤr sich ziemlich
complicirt sind, werden
es noch weit mehr, wenn man sich nicht darauf beschraͤnken will, daß die
Zeiger in jenen Monaten, die nur 30 Tage haben, das Datum 31 uͤberspringen;
sondern wenn man zugleich auch haben will, daß die Uhr von selbst anzeige, ob der
Februar 28 oder 29 Tage hat. Gewoͤhnlich hat man hier ein Rad, welches nur
innerhalb eines Jahres einen vollkommenen Umgang zuruͤklegt, wie dieß an den
sogenannten Aequationspendeluhren der Fall ist, und der dem Ende des Monates Februar
entsprechende Saum des Randes ist mit einer eigenen Vorrichtung versehen, in Folge
deren dieser Monat in den Schaltjahren um einen Tag mehr bekommt.
Hr. Schwilgué ist nun von allen den bisher
gebraͤuchlichen Methoden abgegangen, und der sinnreiche Apparat, den er
erfand, ist gewiß, was die Erreichung des fraglichen Zwekes betrifft, unter allen
der einfachste und beste. Er bedient sich naͤmlich keines Jahresrades,
sondern eines Rades, dessen Saum mit 31 Sperrzaͤhnen, die durch einen
Sperrkegel zuruͤkgehalten werden, versehen ist, und dessen Achse den Zeiger
fuͤhrt, der das Monatsdatum anzeigt; und eines zweiten Rades mit 12
Sperrzaͤhnen und einem Sperrkegel, in dessen Mittelpunkt sich der Zeiger
befindet, welcher die Monate andeutet. Diese Angaben kann man von verschiedenen
Zifferblaͤttern ablesen.
An einem Rade des Uhrwerkes, welches in 24 Stunden einen Umgang macht, sind senkrecht
gegen den Rand seiner Flaͤche hin zwei Zapfen eingesezt, von denen der eine
das Datumrad um einen Zahn weiter bewegt, so daß also dieses Rad sich an jedem Tage
um einen Zahn dreht. Der zweite dieser Zapfen hingegen dient zur Bewegung des
Monatsrades, und darf folglich nur am Schlusse eines jeden Monates in
Thaͤtigkeit kommen. Da es jedoch nicht moͤglich waͤre durch
eine bloße Beschreibung zu zeigen, auf welche Weise ein drittes Rad, welches das
Monatsrad fuͤhrt, und dessen Zaͤhne von ungleicher Dike sind, so von
dem Datumrade in Bewegung gesezt wird, daß der 31ste in jenen Monaten, wo es
noͤthig ist, uͤbersprungen wird, und da sich auch nicht begreiflich
machen ließe, auf welche Weise dieses dritte Rad ein kleines excentrisches Rad
traͤgt, welches in jedem gemeinen Jahre die Dike des Februarzahnes so
vermehrt, daß der 29ste, 30ste und 31ste zugleich uͤbersprungen werden, so
verweise ich in dieser Hinsicht auf die Abbildung und die dazu gehoͤrige
Erlaͤuterung. Ich beschraͤnke mich daher auf die Bemerkung, daß der
neue Mechanismus so einfach ist, als man es wuͤnschen kann, und daß er
folglich in Zukunft an die Stelle aller bisher gebraͤuchlichen und zu diesem
Zweke dienenden Vorrichtungen treten muß.
Ich muß der Gesellschaft aber auch noch eine andere Erfindung des Hrn. Schwilgué empfehlen. Die Gesellschaft erinnert
sich ohne Zweifel an die schoͤne Waage des Hrn. Quintenz
Man findet diese Waage im Polytechn. Journale Bd. XIV. S. 2 und Bd. XXIII. S. 289.A. d. R., die in ihrem Schoße selbst so guͤnstige Aufnahme fand, und welche
gegenwaͤrtig auf den Manthen, in den Seehafen, den Bureaux der Eilwagen, und
uͤberall, wo große Lasten gewogen werden muͤssen, allgemein angewendet
wird. Hr. Schwilgué, welcher Associé des
Hauses ist, welcher die Waage des Hrn. Quintenz ererbte,
suchte diesem schaͤzbaren Apparate eine Dimension und Form zu geben, die ihn
auch fuͤr den Hausgebrauch geeignet macht; denn man hat oft 20, 30 und 50
Kilogr. zu waͤgen, und reicht hiebei mit den gewoͤhnlichen Waagen
nicht aus.
Hr. Schwilgué brachte demnach den Koͤrper
der Quintenz'schen Waage in einen kleinen Tisch mit vier
Fuͤßen, den man, wenn er nicht als Waage dient, wie einen
gewoͤhnlichen Tisch benuzen kann. Die Gewichte sind an dieser Art von Waage
bekanntlich auf den zehnten Theil reducirt: d.h. ein Kilogramm wiegt eine Last von
10 Kilogr. oder 20 Pfd. auf. Will man einen Koͤrper abwaͤgen, so legt
man ihn auf den Tisch, und stellt dann auf die gewoͤhnliche Weise das
Gleichgewicht her, indem man die Schale der Waage mit gehoͤrigen Gewichten
beschwert, so daß man diese Gewichte nur mehr zusammenzuzaͤhlen braucht. Es
duͤrfte wenige Waagen geben, die groͤßere Bequemlichkeit
gewaͤhren, als die gegenwaͤrtige; ich halte daher eine Bekanntmachung
derselben von großem Nuzen.
Beschreibung der Datumuhr des Hrn.
Schwilgué.
Fig. 44 gibt
einen in natuͤrlicher Groͤße gezeichneten Grundriß dieser Uhr. Fig. 45 zeigt
denselben Mechanismus, woran jedoch der groͤßeren Deutlichkeit wegen die
Zifferblaͤtter abgenommen sind.
Fig. 46 zeigt
das Rad mit ungleichen Zaͤhnen und mit dem Sterne in der Stellung, in der es
den Zeiger vom 28. Februar zum 1. Maͤrz uͤberspringen macht.
a ist das Stundenrad, in dessen vordere Flaͤche
zwei senkrechte Zapfen von ungleicher Hoͤhe eingesezt sind; der eine dieser
Zapfen 1 sezt das Datumrad in Bewegung; der andere 2 treibt am Schlusse eines jeden
Monates das Monatsrad um einen Jahn weiter, so daß sich dieses Rad von Monat zu
Monat bewegt. b ist das Datumrad, welches 31
Sperrzaͤhne hat und von einem Sperrkegel c
zuruͤkgehalten wird. Ein an der vorderen Seite dieses Rades befestigter Zapfen 3 trifft, nachdem
dieses Rad einen Umgang vollendet hat, auf einen der ungleichen Zaͤhne des
Rades f; und dadurch wird bewirkt, daß der Zeiger von
einem Monate zum naͤchstfolgenden uͤberspringt. Die Achse des Rades
b traͤgt einen Zeiger d, der auf dem Zifferblatte e die Datums
anzeigt.
f ein drittes Rad mit 12 Zaͤhnen g, h von ungleicher Breite, auf welche, wie gesagt, nach
einander der Zapfen 3 druͤkt. Die sieben, mit g
bezeichneten Zaͤhne dienen fuͤr die Monate mit 31 Tagen; die vier zwei
Mal breiteren Zaͤhne h hingegen fuͤr jene
von 30 Tagen. Der Zahn i, der eine drei Mal
groͤßere Breite hat, ist dazu bestimmt, den Zeiger vom 29. Februar auf den 1.
Maͤrz uͤberspringen zu machen, wenn das Jahr ein Schaltjahr ist.
An der Achse dieses Rades f ist ein Zahnrad j aufgezogen, welches in ein anderes, an der Welle des
Monatsrades l aufgezogenes Zahnrad k eingreift. Dieses Monatsrad hat 12 Sperrzaͤhne,
in welche der Sperrkegel m eingreift, und auf welche am
Ende eines jeden der auf dem Zifferblatte o angedeuteten
Monate der Zapfen 2 druͤkt.
p ist ein excentrisches Sperrrad mit 6 Zaͤhnen,
welches auf der vorderen Flaͤche des Rades f
aufgezogen und mit einem Federsperrkegel q versehen ist.
Unter diesem Sperrrade und zugleich mit ihm sich umdrehend ist ein Stern r mit vier Fluͤgeln angebracht, von denen drei
die Dike des Zahnes i erhoͤhen, wenn der Zeiger
in gemeinen Jahren vom 28. Februar auf den 1. Maͤrz uͤberspringen
muß.
t ist eine Hemmung mit zwei Spizen u, v, von denen jede am Schlusse des Jahres das Sperrrad
p um einen Zahn vorwaͤrts treibt. Diese
Hemmung ist auf die Platte x geschraubt.
Der Mechanismus arbeitet auf folgende Weise. Waͤhrend das Rad a seine Umdrehung vollbringt, geht der Zapfen 1 unter
den Zaͤhnen des Rades l hinweg. Nach 24 Stunden
trifft dieser Zapfen auf einen der Zaͤhne des Datumrades b, und treibt dasselbe um einen Zahn weiter. Nach Ablauf
des Monates druͤkt dann der Zapfen 3 auf einen der Zaͤhne des Rades
f, wodurch, je nachdem der Monat 30 oder 31 Tage
hat, das Ueberspringen des Zeigers d vom 30. auf den 1.,
oder vom 31. auf den 1. hervorgebracht wird.
Um den Zeiger u von einem Monate zum anderen
uͤberspringen zu machen, dreht der Zapfen 2, indem er auf einen der
Zaͤhne des Rades l trifft, dieses Rad, welches
durch seine Verzahnung l auch das Rad f mit sich fuͤhrt.
Wenn das Rad f am 31. December eines jeden Jahres seine
Umdrehung vollendet hat, so kommt das kleine Sperrrad p
mit der Spize und der Hemmung t in Beruͤhrung,
und dadurch wird dieses Rad, so wie der unter demselben befindliche Stern um einen Zahn vorwaͤrts
bewegt.
Am naͤchstfolgenden 31. Januar trifft die zweite Spize v auf den zweiten Zahn des Sperrrades, so daß dieses abermals um einen
Zahn umgedreht wird. Am 28. Febr., wo der Stern r auf
dem Rade f die in Fig. 46 ersichtliche
Stellung angenommen hat, bedekt einer seiner Fluͤgel s einen Theil des Zahnes i dieses Rades, so
daß dieser Zahn einen Tag uͤber eine groͤßere Dike bekommt. Der Zapfen
3 bewirkt dann, indem er sich gegen diesen Fluͤgel stemmt, daß der Zeiger d einen Sprung von drei Tagen macht; d.h. daß er vom 28.
Febr. auf den 1. Mai uͤberspringt.
Da nur alle vier Jahre ein Schaltjahr eintritt, so gehen jedes Jahr zwei
Zaͤhne von den acht Sperrzaͤhnen des Rades p voruͤber; und da die Fluͤgel dann nicht in
Thaͤtigkeit kommen, so wirkt der Zapfen 3 lediglich auf den Zahn i, so daß der Zeiger vom 29. Febr. auf den 1. Mai
uͤberspringt.
Die Wirkung dieses hoͤchst einfachen und sinnreichen Mechanismus ist
unfehlbar; die einzelnen Stuͤke desselben sind leicht zu verfertigen und
nehmen auch keinen großen Raum ein.
Beschreibung der von Hrn. Schwilgué erfundenen
Waage.
Diese Waage, auf welche Hr. Schwilgué im Jahre 1831
in Gemeinschaft mit seinem Associé, Hrn. Rolle,
ein Patent nahm, ist nach dem Principe der Waage des Hrn. Quintenz erbaut; sie verbindet die moͤglich groͤßte
Bequemlichkeit mit der groͤßten Einfachheit des Mechanismus. Sie ist in Form
eines Tisches gebracht, und ihre Dimensionen sind nach dem Caliber und nach der
Tragkraft, die die Waage bekommen soll, verschieden. Uebrigens gibt es zweierlei
Arten dieser Waagen, indem an den einen das absolute Gewicht nur den zehnten, an den
anderen hingegen den 100sten Theil des relativen Gewichtes betraͤgt.
Fig. 47 gibt
einen Grundriß der Waage, an der sich die Hebel wie 1 zu 10 verhalten.
Fig. 48 ist
ein Laͤngendurchschnitt nach der Linie A, B, Fig. 47
genommen.
Fig. 49 ist
ein Querdurchschnitt nach der Linie C, D desselben
Grundrisses.
Fig. 50 zeigt
den Buͤgel, welcher die Haupthebel aufnimmt, von Vorne und im
Durchschnitte.
Fig. 51 ist
die Stuͤze des Rahmens, von Vorne und im Profile betrachtet.
Fig. 52 zeigt
den Querbalken, der sich auf die geknieten Hebel G
stuͤzt.
An allen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auch auf gleiche
Gegenstaͤnde.
A, A ist der Koͤrper des Tisches.
B, B sind gekniete Hebel, die sich an einer Querachse
a, a bewegen, und die Schneiden dieser lezteren
ruhen in den Pfannen C, C', welche an dem Gestelle des
Tisches befestigt sind. Diese Hebel vereinigen sich in einen Schnabel D, welcher messerfoͤrmig zugeschnitten ist, und
welcher in dem unteren Zapfenlager eines Zapfenbandes oder Buͤgels E ruht. Das obere oder umgekehrte Zapfenlager dieses
Zapfenbandes oder Buͤgels nimmt die Schneide des Schnabels F eines zweiten geknieten Hebels G, G, der sich an der Querachse b, b'
schaukelt, auf. Leztere Querachse bewegt sich mit ihren Messern in den an dem
Tischgestelle befestigten Zapfenlagern H, H.
Die Verlaͤngerung des Hebels G, G' besteht aus
zwei parallelen Stangen I, I', und diese endigen sich in
Schneiden oder Messer, auf denen die Zapfenlager, welche die Waagschale K tragen, aufruhen.
Die Tischplatte besteht aus zwei gleichen Theilen, von denen der eine J unbeweglich ist, waͤhrend der andere J' emporgehoben, und indem er sich um Charnirgelenke
dreht, auf ersteren zuruͤkgeschlagen werden kann. Wenn lezterer Theil
niedergesenkt ist, so bilden beide Theile gleichsam nur eine einzige Platte J, J', auf welche die zu waͤgenden
Gegenstaͤnde gelegt werden.
Der unbewegliche Theil der Tischplatte J ist unten mit
einem Rahmen X, X' versehen, welcher mit einer
Stuͤze L ausgestattet ist, deren Zapfenlager auf
den Messern oder Schneiden d, d' der Arme des geknieten
Hebels B, B' ruhen. Der gekniete Hebel G ist ferner von Unten mit zwei Messern oder Schneiden
versehen, auf denen die Zapfenlager eines Querstuͤkes M ruhen, welches sich seinerseits mittelst Messern in Zapfenlagern bewegt,
deren Stuͤzen oder Traͤger N, N an dem
Rahmen X, X, befestigt sind.
Die ganze Waage ist so eingerichtet, daß die geknieten Hebel gleiche Laͤnge
haben, waͤhrend jene Hebel, die die Waagschale tragen, 10 Mal so lang sind,
als die Hebel, auf denen die Tischplatte ruht. Der unbeweglich bleibende Theil der
Tischplatte ist unten mit einem Buͤgel O
versehen, welcher einen Hebel P aufnimmt, dessen
Mittelpunkt der Bewegung sich in Q befindet. An dem
vorderen Ende dieses Hebels befindet sich eine Rolle e,
welche excentrisch an einer Welle R, R' aufgezogen ist,
die einen mit einem Griffe versehenen Aufhalthebel S
traͤgt. Zieht man diesen Hebel nach Vorwaͤrts, so senkt sich das Ende
des Hebels solcher Maßen, daß es auf den Buͤgel O druͤkt,
wo dann die Platte J auf dem Rahmen ausruht. Schiebt man
den Hebel hingegen zuruͤk, so heben die an der Welle R, R befindlichen Zapfen f die Arme I, I', so wie die daran aufgehaͤngte Waagschale
empor. Auf diese Weise werden die Schneiden der an der Tischplatte befestigten
Zapfenlager frei, so daß der Mechanismus nicht laͤnger mehr mit der Platte in
Beruͤhrung steht.
g ist eine Feder, womit der Hebel P emporgehalten wird, damit er nicht auf den Buͤgel O druͤkt, waͤhrend der Aufhalthebel
emporgehoben ist, und waͤhrend das Abwaͤgen geschieht.
h ist ein an der Stange I
angebrachter Zeiger, durch dessen Zusammenfallen mit dem zweiten, an dem Rahmen
befestigten Zeiger i angedeutet wird, daß das
Gleichgewicht hergestellt ist.
T sind Gewichte, welche so in die Waagschale gerichtet
werden, daß sie leicht zusammengezaͤhlt werden koͤnnen.
U ist der Plaz fuͤr die Bruchgewichte, welche in
einen der Behaͤlter V, V' der Waagschale gelegt
werden.
Man bedient sich dieser Waage auf folgende Weise. Wenn die Last auf die Tischplatte
J gelegt worden ist, so senkt sich der Rahmen X ein, und zugleich wird auch durch das Stuͤk L der Hebel B herabgesenkt.
Der Schnabel D dieses Hebels zieht, indem er sich auf
den Buͤgel E stemmt, diesen an, und bringt den
Schnabel F des Hebels G zum
Nachgeben. Dieser leztere Hebel hebt, indem er sich auf seiner Schneide b schaukelt, die beiden Staͤbe, die eine
Verlaͤngerung desselben bilden, empor. Bringt man hierauf die Gewichte in die
Waagschale K, so senken sich die Staͤbe I, I herab, um sich ins Gleichgewicht zu sezen, bis
endlich der Zeiger h mit dem Zeiger i zusammentrifft. Ist das Abwaͤgen geschehen, so
hebt man den beweglichen Theil der Tischplatte empor, bringt die Gewichte wieder an
Ort und Stelle, senkt den Aufhalthebel herab, und schlaͤgt den beweglichen
Theil der Tischplatte J' wieder herunter. In diesem
Zustande stellt die Waage dann einen Tisch vor, und kann auch als solcher benuzt
werden. Fuͤr den Fall, daß man den Aufhalthebel, der den Mechanismus isolirt
und bewirkt, daß die Tischplatte auf dem Rahmen des Tisches aufruht, herabzusenken
vergaͤße; zwingt die Tischplatte selbst beim Niedersenken den Hebel die
gehoͤrige Stellung anzunehmen.
Tafeln