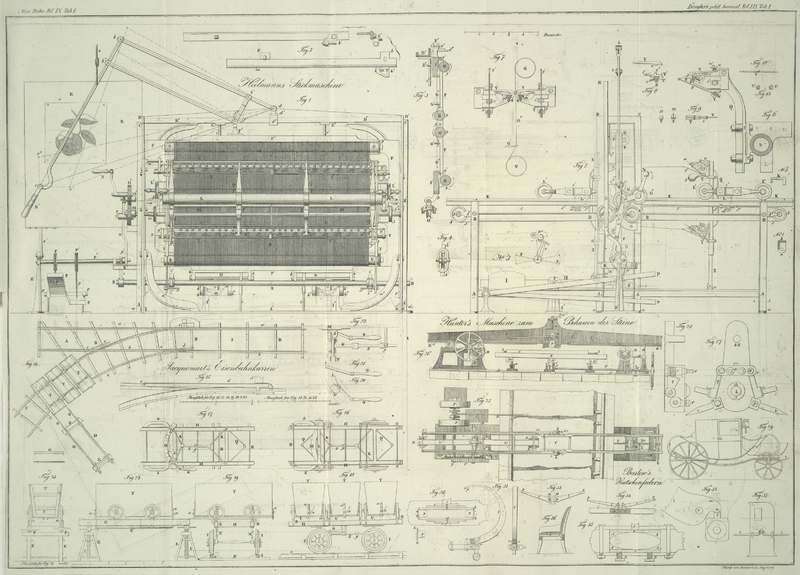| Titel: | Bericht des Hrn. Th. Olivier über einen von Hrn. Jacquemart in Paris, rue de Montreuil No. 39 erfundenen Eisenbahnkarren mit gebrochener Langwied. |
| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. I., S. 1 |
| Download: | XML |
I.
Bericht des Hrn. Th. Olivier uͤber einen von Hrn. Jacquemart in Paris, rue de Montreuil No. 39 erfundenen Eisenbahnkarren mit
gebrochener Langwied.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement, Mai 1835, S. 231.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Ueber Jacquemart's
Eisenbahnkarren.
Hr. Jacquemart, ehemaliger Zoͤgling der
polytechnischen Schule, hat der Gesellschaft einen Wagen mit gebrochener Langwied,
den er fuͤr das Huͤttenwerk in Quessy im Departement de l'Aisne erbaute, zur Pruͤfung unterstellt. Der erste
Wagen dieser Art, der eine Last von 1500 Kilogramm trug, durchlief Kreise mit einem
Halbmesser von 5 Meter (15 Fuß 4 Zoll 8 Linien); die Entfernung der beiden Achsen
von einander betrug, wenn sie parallel waren, einen Meter (3 F. 11 L.). Im Laufe des
Jahres 1833 zog man es jedoch wegen der groͤßeren Bequemlichkeit vor, lieber
große Wagen, auf deren Gestell drei Kisten von 1,50 Meter Rauminhalt angebracht
wurden, zu bauen. Diese Wagen, welche mit einer Last von 5500 bis zu 7000 Kilogramm
beladen werden, durchlaufen Kreise von 10 Meter (30 F. 17 Z. 4 L.) im Halbmesser;
die Entfernung der beiden Achsen betraͤgt hier im Zustande des Parallelismus
1,50 Meter.
Diese Wagen, welche sich seit 8 Monaten auf der Eisenbahn des Huͤttenwerkes
bewegen, sind noch in vollkommen gutem Zustande; sie rollen jedoch nur mit der durch
Pferde erreichbaren Geschwindigkeit und zwar auf Schienen, die auf hoͤlzerne
Balken gelegt sind. Diese Art von Bau, welche sich allerdings fuͤr den hier
gegebenen einzelnen Fall eignet, bietet natuͤrlich nicht dieselbe Festigkeit
dar, wie die großen fuͤr starken Verkehr bestimmten Eisenbahnen.
Die fraglichen Wagen sind nach denselben Principien gebaut, die ich am Ende einer
Abhandlung uͤber die Eisenbahnen im Bulletin
aufstellteWir werden diese Abhandlung in einem der naͤchsten Hefte des
Polytechn. Journales liefern. Zu bemerken ist jedoch noch, daß Hr. Laignel am 23. Julius 1830 ein Patent auf ein
verbessertes Eisenbahnsystem erhielt, in dessen Beschreibung folgende Stelle
vorkommt. „Um die großen Radien an den Eisenbahnen zu vermeiden,
und dieselben bis auf 10 Meter reduciren zu koͤnnen, bedarf man
solcher Raͤder, die sich nach Belieben bewegen lassen, und von
denen jedes mehrere Durchmesser hat.“
A. d. R.; nur hat Hr. Jacquemart statt eines ganzen
Kreises und vier Rollen nur einen halben Kreis und zwei Rollen angebracht, mit deren Huͤlfe nur das
Vordergestell allein eine drehende Bewegung um den unter dem Schwerpunkte des Wagens
angebrachten Stellnagel bekommt. Ein Sperrkegel verhuͤtet, daß sich das
Vordergestell um keinen groͤßeren Winkel drehen kann, als der Laͤnge
des Halbmessers des zu durchlaufenden Kreises entspricht.
Es waͤre sehr im Interesse der Industrie zur endlichen Loͤsung der
Frage uͤber die Curven an den Eisenbahnen mit den hier beschriebenen und
aͤhnlichen Wagen Versuche anzustellen, aus denen hervorginge, welche
Geschwindigkeit man ihnen geben kann, ohne daß sie von den Schienen abgleiten, und
welcher Verlust an Kraft nothwendig durch die Vermehrung der Reibung entstehen muß.
Hr. Jacquemart konnte diese Versuche bisher noch nicht
anstellen; allein ich glaube, daß die Gesellschaft diesen gewandten Ingenieur hiezu
veranlassen, und ihn ersuchen soll ihr seiner Zeit die Resultate, die sich ihm dabei
ergaben, mitzutheilen. Wenn man auf diese praktische Weise die verschiedenen zum
Behufe des Durchlaufens von Curven mit kleinen Radien vorgeschlagenen Systeme mit
einander vergleichen koͤnnte, so ließe sich noch am besten eine, wenn auch
nicht vollkommene, so doch gewiß praktisch hoͤchst nuͤzliche
Loͤsung dieser Frage erwarten.
Die Eisenbahn, welche Hr. Jacquemart fuͤr das
Huͤttenwerk in Quessy erbaute, macht es moͤglich, daß man
gegenwaͤrtig daselbst mit einem einzigen Pferde eben so viel leistet, als
fruͤher mit 12 und 14. Die ganze Bahn hat 800 Meter Laͤnge, und davon
kam der Meter auf 6 1/2 bis 7 Fr. zu stehen. Der Karren kostet beilaͤufig 500
Fr.
Da dieses neue System von Eisenbahnkarren vielleicht manchen anderen eben so
nuͤzlich werden duͤrfte, wie es Hrn. Jacquemart geworden, so beantrage ich diesem den Dank der Gesellschaft zu
votiren, den Karren selbst aber durch eine Abbildung und Beschreibung zur
allgemeinen Kenntniß zu bringen.
Fig. 14 gibt
einen Grundriß eines Theiles der Eisenbahn von Quessy und eines Theiles der daran
befindlichen Curve.
Fig. 15 zeigt
die bewegliche Schiene, mittelst welcher der Karren von der geraden auf die krumme
Bahn gebracht wird, im Grundrisse.
Fig. 16 ist
ein Grundriß des Wagens, der auf der Eisenbahn laͤuft, und welcher drei mit
den fortzuschaffenden Substanzen beladene Waͤgelchen traͤgt.
Fig. 17 zeigt
denselben Wagen von Unten, woraus man den Mechanismus, in Folge dessen sich das
Vordergestell umdreht, ersieht.
Fig. 18 zeigt
einen ebensolchen beladenen Wagen im Laͤngenaufrisse, waͤhrend ihn Fig. 19 von
dem einen Ende her gesehen darstellt.
Fig. 20 gibt
einen Grundriß und Fig. 21 einen Aufriß des Aushebhebels, der die Bewegung des
Vordergestelles gestattet oder hindert.
Fig. 22 ist
ein Aufriß der einen Rolle des Vordergestelles und der Gabel, die die Nabe
umfaßt.
Fig. 23 zeigt
das kleine Waͤgelchen im Durchschnitte, waͤhrend man es in Fig. 24 auf
einer Huͤlfseisenbahn, und in dem Augenblike, wo es abgeladen wird,
ersieht.
An allen diesen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben auch gleiche
Gegenstaͤnde.
A ist die Eisenbahn, welche aus zwei parallelen, auf den
hoͤlzernen Balken B ruhenden Schienen a, b besteht.
C ist die gebogene Eisenbahn, die durch zwei, um die
Punkte e bewegliche Schienen c,
d mit ersterer in Verbindung steht; das Ende dieser Schienen ist in die aus
Holz bestehenden Stuͤke f eingesezt.
D ist die mit der Curve C
verbundene Huͤlfseisenbahn, die auf den Boͤken E ruht. F, F sind Schrauben, auf denen die
Schienen dieser lezteren Bahn ruhen, und mit deren Huͤlfe man dieser eine
solche Neigung geben kann, daß die kleinen Waͤgelchen darauf fortrollen, ohne
daß sie von einem Pferde gezogen zu werden brauchen.
G, G sind Schienen, die an die Schienen der großen
Eisenbahn gehakt werden, und welche solcher Maßen die Communication zwischen dieser
und der Huͤlfseisenbahn herstellen.
H ist das Gestell des großen Wagens.
I die Raͤder, welche zweierlei Durchmesser
huͤben.
J die in der Mitte ihrer Laͤnge gebrochene
Langwied, die sich um den Stellnagel g dreht.
K, K sind gekniete Hebel, durch welche die Langwied mit
den Achsen in Verbindung steht.
L ist das Vordergestell, welches sich mit seinen beiden
Rollen h, h auf einer centrirten, unter dem Gestelle H befestigten Platte dreht. Seine Bewegung ist durch die
Aufhaͤlter oder Sperrer i, gegen die sich die
Rollen stemmen, beschraͤnkt.
N, N sind Pfosten, welche an den Achsen befestigt sind,
und den Rahmen H tragen.
O ist der mit einem Griffe versehene Aushebhebel,
welcher sich um die Achse der Rolle h dreht.
Druͤkt man auf diesen Hebel, so geraͤth er in Schwingung und hakt sich
mit seinem Haken k in ein in der centrirten Platte M befindliches Loch. In dieser Stellung ist der Hebel
unbeweglich, so daß die Wagenraͤder in gerader Linie fortlaufen muͤssen. Hebt man
hingegen den Hebel empor, so wird der Haken frei, so daß sich das Vordergestell
umdrehen kann.
P ist eine Gabel, die die Achse von Vorne umfaßt.
Q sind Zugketten, wodurch die großen Wagen mit einander
in Verbindung gebracht werden.
R, R sind Querschienen, sechs an der Zahl, welche auf
dem großen Wagen angebracht sind, und die zur Aufnahme der kleinen Waͤgelchen
dienen.
S, S Vorspruͤnge, welche außen an dem Gestelle
H befestigt sind, und die, indem sie auf die
horizontale, an einem Tragbloke der Eisenbahn angebrachte Rolle I treffen, den Wagen zum Abweichen von der geraden Bahn
veranlassen.
T, T, T sind die kleinen, auf vier Raͤdern
ruhenden und zur Aufnahme der fortzuschaffenden Substanzen dienenden
Waͤgelchen; sie sind der Quere nach auf dem großen Wagen angebracht und ruhen
mit ihren Raͤdern auf den Schienen R, R.
U ist ein beweglicher Boden, der aus zwei
Fluͤgeln besteht; diese Fluͤgel drehen sich um die Charniergelenke m, und werden durch einen Haken, der in ein eisernes
Stuͤk n einpaßt, zusammengehalten; so wie man
daher den Zapfen o auszieht, oͤffnet sich der
bewegliche Boden, und die in dem Waͤgelchen enthalten gewesenen Substanzen
entleeren sich in einen Behaͤlter, der zu deren Aufnahme angebracht worden
ist.
Will man nun den großen Wagen von der geraden auf die krumme Eisenbahn
uͤbergehen machen, so entfernt man zuerst die beweglichen Schienen c, d, so wie man dieß aus Fig. 15 ersieht; und hebt
dann den Aushebhebel empor, wodurch das Vordergestell frei wird. Wenn der Wagen nun
auf die Rolle l trifft, so wird das Vordergestell
gezwungen sich um den Stellnagel zu bewegen, wo dann die Raͤder auf die
krumme Bahn uͤbertreten, und auf dieser mit ihrem kleinen Durchmesser laufen.
Ist der Wagen auf diese Weise vor der Huͤlfseisenbahn angelangt, so stellt
man mittelst der beweglichen Schienen die Communication mit dieser her, und
laͤßt eines der drei auf dem Wagen befindlichen Waͤgelchen um das
andere in Folge seiner eigenen Schwere uͤber diese Bahn hinablaufen.
Tafeln