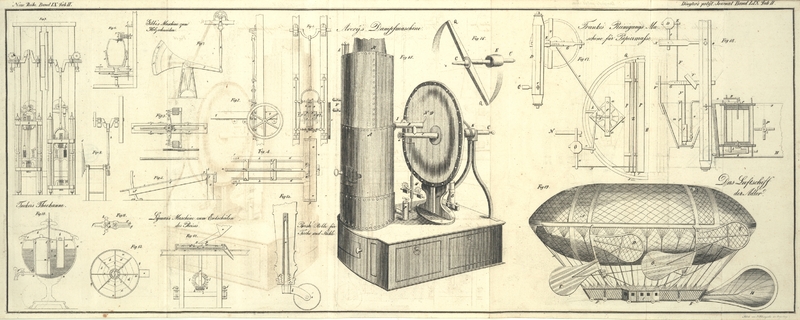| Titel: | Leopold Franke's patentirte Reinigungsmaschine für die Papiermasse. |
| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. XVI., S. 98 |
| Download: | XML |
XVI.
Leopold Franke's patentirte Reinigungsmaschine fuͤr die
PapiermasseAnleitung zur Anlage und Behandlung derselben, bei Bandenhoͤck in Goͤttingen. 1835. (Polytechnisches
Centralblatt, Nr. 46.).
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Franke's Reinigungsmaschine fuͤr die
Papiermasse.
Um die zerfaserte Substanz aus baumwollenen und leinenen Zeugen zu gewinnen, die zur
Fertigung des Papieres erforderlich ist, bediente man sich anfaͤnglich
einfacher Stampfwerke, welche wegen des geringeren oͤkonomischen Nuzeffects
und der unbequemeren Handhabung der Maschine von den Hollaͤndern durch
zerkleinernde Walzmaschinen verdraͤngt worden sind, die man in Deutschland
noch mit dem Namen der Hollaͤnder belegte. Konnte man mittelst derselben nun
auch in kuͤrzerer Zeit eine reinlichere und gleichfoͤrmigere Masse
bereiten, so hatten sie doch den bedeutenden Nachtheil, daß sie die knotenartigen
Theile der Hadern und die beim Zusammennaͤhen derselben geknuͤpften
Knoten nicht zerkleinerten. Wollte man diesem Nachtheile entgehen, so konnte man
entweder gleich anfaͤnglich aus den Hadern alle Naͤhte ausschneiden
und sie wegen Entfernung aller Knoten gehoͤrig aussuchen lassen, oder man
mußte Stampfwerke mit Walzenmaschinen vereinigt anwenden, wobei die ersten die
Hadern so umwandelten, daß den lezteren nur noch die gehoͤrige Verfeinerung
blieb, oder man mußte bei alleiniger Anwendung der Walzenmaschine, wenn man das
vorhergehende muͤhsame Sortiren scheute, aus dem bereits gefertigten Papiere
die Knoten ausheben, wodurch dasselbe allerdings Schaden leiden muß. Um die Bogen
ohne Knoten und Spuren der abgehobenen Knoten zu fertigen, wird in manchen Fabriken
auch die zubereitete Masse in Bogen geformt, die Bogen gepreßt, damit die Knoten
besser sichtbar werden und aus dem noch nassen Papiere gehoben werden koͤnnen, worauf die
so beschaͤdigten Bogen wieder in Masse verwandelt und das zweite Mal zu
Papier geformt werden.
Dem Verf. gelang es nach langjaͤhrigen Bemuͤhungen, alle diese
beschwerlichen und zeitraubenden Processe durch ein einfaches Ausscheiden der Knoten
mittelst einer Reinigungsmaschine zu ersezen, welche die Vortheile hat, daß sie
wenig Raum bedarf, in jeder Fabrik daher aufgestellt werden kann, keine neue
Handarbeit in die ganze Papierbereitung bringt, und, was die Hauptsache ist, sich in
verschiedenen Fabriken bereits bei Formen aller uͤblichen Papiersorten
bewaͤhrt hat. Der Betrieb dieses Reinigungsapparates fuͤr eine Butte
fordert ungefaͤhr eine Mannskraft, und die Maschinerie dient gewisser Maßen
dadurch als Regulator fuͤr die Arbeitsbutte, daß durch sie in derselben immer
eine gleichfoͤrmige Mischung von Masse und Wasser unterhalten wird.
Von den beiden mitgetheilten Abbildungen enthaͤlt Fig. 17 einen Grundriß,
und Fig. 18
einen Aufriß, jedoch so, daß die rechts liegende Arbeitsbutte im Durchschnitt, die
links weiter zuruͤkliegende Drukpumpe nur in der Seitenansicht gezeichnet
ist. Zwischen den vier Saͤulen aa befindet
sich ein aufrechtstehendes cylindrisches Drahtgeflecht, in dessen Mitte eine
stehende, mit neun radial gestellten Schaufeln versehene Welle sich befindet, die
auf dem von Unten heraufgeschraubten Spizzapfen b sich
bewegt. Oben und unten hat das Sieb eine hoͤlzerne Fassung; die Oeffnungen
desselben sind, je nachdem eine groͤber oder feiner gemahlene Masse gesichtet
werden soll, bei verschiedenen Sieben 1/40 – 1/80 groß, jedoch
moͤglichst gleichfoͤrmig im ganzen Siebe. Zwischen dem aͤußeren
Schaufelende und dem Siebe befindet sich 1/4'' Zwischenraum. Der obere Zapfen der
Welle ruht in Pfannen, die in dem Stege f versenkt sind,
und ist in einen Kurbelarm ausgebogen, durch den der Schaufelwelle eine
wiederkehrende kreisfoͤrmige Bewegung mitgetheilt wird. Aus dem Inneren des
Siebes fuͤhrt das Ableitungsrohr h die sich
absezenden Unreinigkeiten außerhalb der Arbeitsbutte weg; es ist beim Ausgange aus
der Butte mit einem Ventil, welches mittelst des Hebels k und des Zuges bei i gehoben werden kann, und
am Ende durch einen Pfropfen verschlossen.
Ein zweiter zur Maschine gehoͤrender Theil ist die in dem Gefaͤße m, dessen Vordertheil als weggehoben gezeichnet ist,
befindliche Drukpumpe; die Bodenweite des Gefaͤßes ist nicht uͤber
9'', damit beim Ansaugen des Papierbreies nichts zuruͤkbleibe, seine
Groͤße aber bestimmt sich nach dem Verbrauch der Papiermasse, und es kann
oben ungefaͤhr 23–30'' weit seyn, bei 28–30'' Hoͤhe. Die
Drukpumpe
l steht in der Mitte dieses Gefaͤßes mit dem
Einmuͤndungsrande 3/4'' uͤber dem Boden, wodurch groͤbere
Koͤrper am Eintritte in die Pumpe gehindert werden. Sie ist mit zwei Laschen
an einen Querriegel q angezogen, welcher auf der
Saͤule p ruht und in dem Rande des
Gefaͤßes gegen den Seitendruk etwas eingelassen ist. Das Drukrohr o fuͤhrt in sanften Biegungen von ihr nach dem
hohlen Raume des Cylindersiebes, um demselben die Masse zuzufuͤhren. Der
Kolben der Drukpumpe besteht aus kreisfoͤrmig geschnittenen Holzscheiben, die
in der Mitte eine Oeffnung haben, um gegen ein Gestemme an der Kolbenstange mittelst
einer durchgreifenden Schraube angezogen und zusammengepreßt werden zu
koͤnnen; die Filzscheiben schließen dicht an das Rohr an, und werden,
wenigstens die untere, durch eine neue ersezt, sobald dieß nicht mehr vollkommen der
Fall ist, weil, wenn etwas von der Papiermasse zwischen Kolben und Stiefel kommen
sollte, daraus leicht kleine Roͤllchen gebildet werden koͤnnten, die
das Sieb nicht aufzuhalten vermoͤchte. Durch die Kolbenstange Y haͤngt der Kolben mit dem bewegten Hebel G zusammen.
Zur Bewegung des ganzen Apparates wird von einem bewegten Werke aus eine Welle so
getrieben, daß sie sechszehn Umgaͤnge in der Minute macht, folglich mit dem
an ihr befindlichen Krummzapfen die abgebrochen gezeichnete Zugstange C ebenfalls sechszehn Mal hin- und herbewegt, und
dadurch vermoͤge des Kreuzarmes t der liegenden
Welle D eine kreisfoͤrmig wiederkehrende Bewegung
ertheilt, die sich durch den zweiten Arm E, die
Verbindungsstange F dem Hebel G und somit auch der Kolbenstange Y mittheilt.
Um den Hub der Kolbenstange nach Beduͤrfniß groͤßer und kleiner machen
zu koͤnnen, befinden sich theils an dem Hebel G
mehrere Angriffspunkte fuͤr die Zugstange F, an
denen sie mittelst Bolzen befestigt werden kann, theils ist die Kolbenstange Y, wo sie sich an den Hebel G schließt, mit drei horizontal neben einander befindlichen
Loͤchern versehen, welche eben so vielen in dem Hebel G entsprechen, und je nachdem der Bolzen in das weiter nach V zu liegende gestekt wird, eine Vermehrung des Hubes
auch dadurch moͤglich machen; sobald der Bolzen eingestekt ist, wird die
Klappe T vorgeschlagen und dadurch ein Ausheben der
Stange unmoͤglich gemacht. Der Hebel G bewegt
sich in der geschlizten Saͤule V, die ein
Hin- und Herschwanken verhindern soll. (Dasselbe ließe sich ebenfalls dadurch
erreichen, daß man die Zugstange F zum Verstellen an dem
Arme E und F einrichtete.)
An der fruͤher erwaͤhnten Welle, welche die Zugstange C in Bewegung sezt, befindet sich ein Rad von 67
Zaͤhnen, das in ein Getriebe von siebenzehn Stoͤken eingreift, und
mittelst desselben eine zweite ebenfalls vertikal stehende Welle umdreht, die mittelst einer Kurbel
die Lenkerstange N, dadurch aber auch die Arme u, v, x der neben der Arbeitsbutte stehenden Welle O in wiederkehrende Bewegung versezt. Mit dem Arme v ist die Stange w
verbunden, die an ihrem anderen Ende in den fruͤher erwaͤhnten
Kurbelarm g der Schaufelwelle greift, und daher zur
Bewegung der lezteren dient. Mittelst des Armes x und
der Zugstange y wird aber die Fluͤgelwalze z bewegt, deren vier Fluͤgel PP in beiden Abbildungen ersichtlich sind, und
welche vermoͤge ihrer Ausdehnung uͤber die ganze Arbeitsbutte die
Masse nicht zu Boden sinken laͤßt, ein gleichfoͤrmiges Gemisch von
Wasser und Papierstoff durch die Butte erhaͤlt, und die unter bestimmten
Umstaͤnden sich zusammensezende Papiermasse wieder gehoͤrig
auseinander treibt. Sie ruht mit zwei Spizzapfen in Pfannen an der Wand der Butte;
der Zapfen bei Q ist fest, dagegen der bei R beweglich und durch die Schraube S verstellbar, daß die Walze immer im schließenden Gange
bleibe.
Vermoͤge der angegebenen Verhaͤltnisse wird bei sechszehn Kolbenhuben
die Schaufelwalze 126 Schwingungen im Cylindersiebe machen, die am aͤußersten
Ende 7–8'' betragen, die Fluͤgelwalze dagegen eben so viel von 4''
Bogenlaͤnge. Fuͤr feingemahlene Masse ist die angegebene Anzahl
Umdrehungen der Schaufelwalze vollkommen hinreichend, kann jedoch ohne Nachtheil um
1/8 verringert werden; bei langfaserigem Papierstoffe darf die Zahl ihrer
Umdrehungen nicht unter 120 in der Minute sinken. Ein anderes Mittel, den
gehoͤrigen Gang hervorzubringen, gibt die Vermehrung oder Verminderung der
Bogenlaͤnge der Schwingung ab, die man durch Aenderung der Dimensionen an den
Armen u, v, g erreichen kann, wobei jedoch zu bedenken
ist, daß man durch kuͤrzeren Ausschlag die Maschine mehr schont.
Soll der beschriebene Apparat nun in Wirkung treten, so wird die Arbeitsbutte so weit
mit Wasser gefuͤllt, daß wenn die Papiermasse zugegeben wird, die
Fluͤssigkeit eine solche Hoͤhe erreicht, daß Cylinder und
Schaufelwalze bedekt sind, und bis an den Rand der Butte noch 3–4''
uͤbrig bleiben. Hierauf fuͤlle man m voll
Papierstoff, und bewege gleichzeitig den Kolben und die Schaufelwalze im Siebe, so
wird der Stoff in die Arbeitsbutte uͤbergetrieben werden. In das
Gefaͤß m fuͤllt man unterdessen so lange
nach, bis die Masse in der Butte diejenige Consistenz erreicht hat, die zur
bestimmten Staͤrke einer Papierart erforderlich ist. Beginnt nun das
wirkliche Fertigen der Bogen, so schoͤpft man so viel Masse in das
Pumpengefaͤß, als fuͤr eine bestimmte Anzahl Bogen erforderlich ist,
und stellt den Hub der Pumpe so, daß in derselben Zeit, die der Arbeiter zum Formen braucht, die
Masse in die Butte uͤbergeht; man erlangt hiedurch außer dem Vortheile, ein
Papier ohne Knoten je nach der Feinheit des Siebes zu erhalten, noch eine
gleichfoͤrmige Consistenz der Papiermasse in der Arbeitsbutte, wodurch es dem
Arbeiter viel leichter faͤllt, immer Bogen von gleicher Staͤrke
auszuschoͤpfen, als wenn er an einer Butte arbeitet, in welche die Masse von
etwa 180 Bogen auf einmal eingetragen wird, und die Consistenz am Ende etwa bloß ein
Drittel so groß ist, als am Anfange. Die in dem Siebe zuruͤkbleibenden
knotenartigen Ruͤkstaͤnde werden nach 5–6stuͤndiger
Arbeit entfernt. Man haͤngt zu dem Ende den Pumpenkolben ab, laͤßt
noch einige Zeit die Schaufelwalze in Bewegung, wodurch sie alle Papiermasse
austreibt, sezt diese dann auch in Ruhe, oͤffnet das Bodenventil mittelst des
Hebels k, und laͤßt ein Paar Handeimer Wasser
unter ganz langsamer Walzenbewegung abfließen, wodurch die Unreinigkeit aus den
Winkeln weggespuͤlt wird.
Tafeln