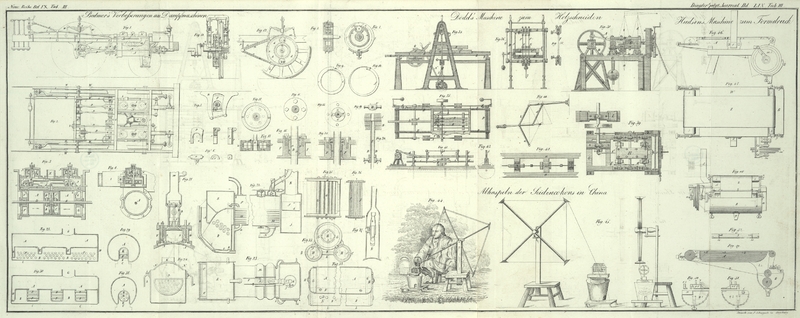| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen und an den Dampfkesseln für stationäre und Locomotivdampfmaschinen, worauf sich John George Bodmer, Civilingenieur von Bolton-le-Moors, am 24. Mai 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. XXVI., S. 162 |
| Download: | XML |
XXVI.
Verbesserungen an den Dampfmaschinen und an den
Dampfkesseln fuͤr stationaͤre und Locomotivdampfmaschinen, worauf sich
John George Bodmer,
Civilingenieur von Bolton-le-Moors, am 24. Mai 1834 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. November 1835, S.
138.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Bodmer's verbesserte Dampfmaschinen und Dampfkessel.
Die unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen Erfindungen umfassen mehrere neue
Einrichtungen an den Dampfmaschinen und Dampfkesseln. Sie bestehen 1) in Hinsicht
auf die Dampfmaschinen in der Anwendung zweier Kolben, die sich in einem und
demselben Cylinder nach entgegengesezten Richtungen bewegen, und von denen jeder
einen eigenen, jedoch an einer und derselben Welle angebrachten Kniehebel in
Bewegung sezt, damit auf diese Weise die der Welle mitgetheilte Kraft ausgeglichen
wird. Denn, waͤhrend der eine Kolben seinen Kniehebel durch die
Haͤlfte eines Umganges treibt, treibt der andere seinen Kniehebel durch die
andere Haͤlfte; und dadurch wird die Welle in kreisende Bewegung versezt,
ohne daß sie irgend eine Gewalt auf ihre Zapfenlager ausuͤbt. Da ferner die
Expansivkraft des Dampfes auf die Kolben und durch diese auf die Kniehebel allein
wirkt, so erhellt offenbar, daß auf keinen Theil des Gestelles oder der Grundlage
der Maschine irgend eine Gewalt ausgeuͤbt wird. Durch die Anwendung zweier
Kolben wird die Kraft verdoppelt, und folglich werden zwei Kniehebel, jeder mit
einem Halbmesser von 4 Zoll, eine eben so große Kraft auf die Welle ausuͤben,
wie ein Kniehebel, dessen Halbmesser 8 Zoll betruͤge. Die Geschwindigkeit der
Maschine laͤßt sich demnach verdoppeln, ohne daß die Kolben und Cylinder
einer groͤßeren Abnuͤzung ausgesezt waͤren, als dieß an den
gewoͤhnlichen Dampfmaschinen bei einer um die Haͤlfte geringeren
Geschwindigkeit der Fall ist. Ueberdieß laͤßt sich bei der Kuͤrze der
Kolbenhube und der vermehrten Groͤße der Dampfwege eine große Geschwindigkeit
erzielen, ohne daß dadurch die Kraft der Maschine beeintraͤchtigt
wuͤrde.
Die zweite neue Einrichtung besteht in der Compensirung oder Ausgleichung des Drukes,
den die Spannkraft oder Elasticitaͤt des Dampfes auf die Schiebventile
ausuͤbt. Der Patenttraͤger ist hiedurch im Stande den
Flaͤchenraum der Dampfwege und folglich auch die Oberflaͤchen der
Ventile auf jede erforderliche Dimension zu vergroͤßern, ohne daß, die
Reibung in demselben Verhaͤltnisse zunaͤhme.
Die dritte Erfindung besteht in der Anwendung von kreisbogenfoͤrmigen
Fuͤhrern, in denen sich die Zapfenlager der Kniehebelwelle bewegen. Die
Kolben und Schiebventile sind hiedurch gezwungen sich unabaͤnderlich in dem
geeigneten Raume zu bewegen, in was immer fuͤr einer Stellung sich die
Kniehebelwelle befinden mag.
Die vierte Erfindung bezieht sich auf den Bau und die Aufziehmethode von doppelten
Zapfenlagern fuͤr die Kniehebelwelle, zwischen welchen Lagern die
Laufraͤder angebracht sind; ferner aber auch auf eine solche Verbindung der
Wagenraͤder mit diesen Zapfenlagern und dem Wagengestelle, daß der Druk auf
die beiden Zapfenlager gegen einander ausgeglichen wird. In Folge dieser Einrichtung
kann das Gewicht oder der Druk des Wagens nicht auf die Kniehebel wirken.
Die fuͤnfte Erfindung bezwekt eine verbesserte Methode die metallene Liederung
der Kolben auszudehnen, und die Verhinderung der Abnuͤzung der Kolben und
Cylinder, wenn sie horizontal angebracht sind.
Die sechste Erfindung endlich betrifft eine Methode die Geschwindigkeit eines
Dampfwagens auf einer horizontalen Schienenbahn zu erhoͤhen, ohne zugleich
auch die Geschwindigkeit der Kniehebelwelle zu vermehren.
Fig. 1 ist ein
senkrechter Laͤngendurchschnitt durch die Maschine. Fig. 2 zeigt dieselbe im
Grundrisse oder in einer horizontalen Ansicht. Fig. 3 ist ein
Laͤngendurchschnitt durch einen der Cylinder, der Kolben und der
Schiebventile in etwas groͤßerem Maaßstabe. Fig. 4 gibt einen
Querdurchschnitt und eine Endansicht derselben Theile. A,
A sind die Cylinder, von denen jeder zwei Kolben B,
C hat, welche sich in ihm bewegen. Die Kolbenstangen D, E gehen durch Stopfbuͤchsen in den Dekeln F, G. H ist ein Schiebventil, welches sich in der Dampfkammer I bewegt; leztere steht mit der von dem Dampfkessel
herfuͤhrenden Dampfroͤhre K in Verbindung.
a, b und c sind die
Dampfwege des Cylinders; sie dienen abwechselnd je nach der Stellung des
Schiebventiles als Eintritts- oder Austrittsmuͤndungen. Das
Schiebventil ist hohl und bildet die Austrittsmuͤndung des Dampfes, der durch
die Canaͤle oder Wege d, e in den Rauchfang
entweicht. Gesezt die Kolben und Ventile befinden sich in der aus Fig. 3 ersichtlichen
Stellung: d.h. die Canaͤle b, c, durch welche der
Dampf austritt, seyen nach Innen gegen das Schiebventil offen, so wird der Canal a zum Behufe des Eintrittes des Dampfes in den Cylinder
offen stehen, wo dann der Dampf zuerst zwischen die Kolben B,
C gelangen, und in Folge seiner Expansivkraft die beiden Kolben gegen die
Enden des Cylinders hin nach der Richtung der Pfeile aus einander treiben wird. Wenn
die Kolben an den Enden ihrer Hube angelangt sind, so hat sich das Schiebventil in
der Richtung des Pfeiles bewegt, wo dann die Oeffnung d
dem Dampfwege a offen stehen wird, so daß lezterer
nunmehr zum Austrittscanale wird. Zugleich oͤffnen sich aber die gegen die
beiden Enden des Cylinders hin befindlichen Canaͤle oder Wege b und c; und da dann der
Dampf durch diese beiden Wege in das Innere des Cylinders gelangen kann, so werden
die Kolben nun durch die Elasticitaͤt des Dampfes wieder gegen die Mitte des
Cylinders hin getrieben werden, wie man dieß aus Fig. 3 sieht.
Waͤhrend dieß geschieht, kehrt das Ventil wieder in seine fruͤhere
Stellung zuruͤk. Die Austrittsoͤffnung d
ist, wie man sieht, so groß, daß sie dem Austrittscanale e immer geoͤffnet ist.
Die Compensation oder Ausgleichung des Drukes des Dampfes auf das Schiebventil
ersieht man am besten aus Fig. 3 und 4. Sie ist folgender Maßen
bewerkstelligt. Mit den Ventilen H stehen durch Stangen
die beiden dampfdichten Kolben M, M in Verbindung; und
diese Kolben sind so gebaut, daß die Expansivkraft des Dampfes deren
Seitenwaͤnde so nach Außen druͤkt, daß sie in inniger
Beruͤhrung mit den kleinen Cylindern N, N stehen.
Die Seiten der Kolben M sind wegen der Duͤnnheit
des Metalles, in welches bis auf 2/3 seiner Dike drei oder mehrere
Saͤgefurchen oder Spalten geschnitten sind, elastisch. Uebrigens eignet sich
irgend eine andere Art dampfdicht schließender Kolben eben so gut. Die Kolben M, M bewegen sich in den beiden kleinen Cylindern N, N, welche uͤber der Oeffnung f, f des Ventilgehaͤuses oder der Dampfkammer I befestigt sind.
Das aͤußere Ende dieser Cylinder N, N ist dem
Zutritte der Luft offen. Der in die Kammer I
eingetretene Dampf uͤbt seine Expansivkraft auf die Oberflaͤche des
Schiebventiles H, und durch die Oeffnungen ff auch auf die Kolben M,
M. Es ist daher offenbar, daß die auf die Kolben M,
M ausgeuͤbte Dampfkraft durch die Stangen L,
L streben wird die Oberflaͤche des Ventiles H außer Beruͤhrung mit der Oberflaͤche des Cylinders zu
bringen; und daß folglich diese Oberflaͤche von dem Druke des Dampfes befreit
wird, indem lezterer durch die auf die Kolben ausgeuͤbte Kraft compensirt
ist. Da jedoch der Flaͤchenraum der Kolben M, M
etwas kleiner ist, als jener der mit dem Cylinder in Beruͤhrung stehenden
Ventiloberflaͤche, so wird das Ventil dennoch immer mit dem Cylinder in
Beruͤhrung erhalten werden, und zwar mit einem Druke, der von dem
Flaͤchenraume der Kolben M, M abhaͤngt. In
Folge dieser Befreiung des Schiebventiles von dem Druke des Dampfes koͤnnen die
Eintritts- und Austrittsoͤffnungen der Cylinder in beliebigem Grade
vergroͤßert werden, ohne daß man auf die Reibung, welche durch den Druk des
Dampfes auf die hiedurch vergroͤßerten Beruͤhrungsoberflaͤchen
hervorgebracht wird, Ruͤksicht zu nehmen braucht; denn diese Reibung kann
durch den Flaͤchenraum der Kolben M, M
ausgeglichen oder compensirt werden. Die Maschine kann mithin mit großer
Geschwindigkeit arbeiten, ohne hiebei durch einen Mangel an hinreichendem
Dampfzuflusse beschraͤnkt zu werden, wie dieß an den gewoͤhnlichen
Maschinen der Fall ist.
Zur weiteren Erlaͤuterung der Bewegung des Schiebventiles muß bemerkt werden,
daß wenn sich das Schiebventil zum Behufe der Verwechselung der Eintritts-
und Austrittscanaͤle a, b und c bewegt, die massiven Theile des Ventiles diese
Oeffnungen bedeken.
Der Dampf in dem Cylinder wird in Verbindung mit dem auf die Kolben M, M wirkenden Dampfe dahin wirken das Ventil außer
Beruͤhrung mit dem Cylinder zu bringen, was jedoch durch folgende
Vorrichtungen verhuͤtet wird. Die Kolben M, M
werden durch die cylindrischen Theile g, g, die sich in
den Fuͤhrern h, h bewegen, und durch die Zapfen
i, i, die sich in den hohlen Stellschrauben k, k bewegen, dirigirt oder in ihrer Bewegung gerichtet.
Die Schrauben k, k, welche durch Mutterschrauben gehen,
die in dem oberen Theile der Cylinder N, N angebracht
sind, sind mit Schraubenmuttern versehen, und so regulirt, daß genau in demselben
Momente, in welchem die massiven Theile des Schiebventiles die Dampfwege a, b, c bedeken, die Schultern l,
l der Kolben mit dem Ende der Schrauben in Beruͤhrung kommen. Da
hiedurch die Wirkung der Kolben M, M unterbrochen wird,
so wird folglich in demselben Momente die ganze Kraft des in der Kammer I enthaltenen Dampfes auf das Ventil wirken, indem
dadurch, daß sich die Kolben gegen die Stellschrauben stemmen, die Compensation oder
Ausgleichung ihrer Kraft fuͤr diesen Augenblik verhindert wird.
Sollte die Maschine ploͤzlich angehalten oder deren Gang umgekehrt werden
muͤssen, – und Lezteres wuͤrde der Fall seyn, wenn die massiven
Theile des Schiebventiles die Dampfwege a, b, c
verdeken, so wuͤrde die Geschwindigkeit der Laufraͤder einer
Locomotivmaschine oder jene des Flugrades einer stationaͤren Dampfmaschine
bewirken, daß die Kolben den in dem Cylinder enthaltenen Dampf comprimiren, indem
dessen Entweichen aus dem Cylinder verhindert ist. Der hiedurch entstehende
Widerstand wuͤrde dann so groß werden, daß wenn der Dampf nicht entweichen
koͤnnte, einige Theile der Maschinerie nachgeben oder zerstoͤre werden
mußten. Damit dieß nicht
geschehen koͤnne, ist die Einrichtung getroffen, daß das Schiebventil etwas
weniges nachgeben kann, sobald der comprimirte Dampf in dem Cylinder eine solche
Kraft erlangt hat, daß er die Kraft des Dampfes in der Kammer I zu uͤberwaͤltigen im Stande ist. Zu diesem Behufe ist die
Verbindung zwischen den Staͤben oder Gelenkstuͤken L, L und den Schiebventilen H,
H durch einen kurzen Spalt oder durch ein kurzes Fenster, wodurch der aus
Fig. 3
ersichtliche Zapfen m, m gestekt wird, vermittelt. Bei
diesem Baue kann der in dem Cylinder comprimirte Dampf das Schiebventil
uͤberwaͤltigen und entweichen, wodurch dem Brechen irgend eines
Theiles der Maschine vorgebaut ist.
Nach dieser vorlaͤufigen Beschreibung der ersten und zweiten der fraglichen
Erfindungen muß noch angedeutet werden, wie man die von den arbeitenden Kolben
ausgeuͤbte Kraft auf die Kniehebel wirken lassen kann, um eine
Locomotivmaschine oder einen Dampfwagen in Bewegung zu sezen. Die Enden der
Kolbenstangen D, D bewegen sich zwischen V foͤrmigen Leitern O,
O und stehen auf die gewoͤhnliche Weise mit den Stangen PP in Verbindung. An den anderen Enden sind diese
Stangen mit den an der Welle R befindlichen Kniehebeln
Q, Q verbunden. Die Kolbenstangen E, E bewegen sich gleichfalls zwischen Fuͤhrern
S, S und deren Enden bilden die Kolben der
Heißwasserpumpen T, T. An diesen Kolbenstangen sind auch
die Querhaͤupter U, U angebracht, mit deren Enden
die Stangen V, V in Verbindung stehen; leztere sind
ihrerseits mit den Armen oder Kniehebeln W, W verbunden,
die an der in dem Gestelle in Zapfenlagern aufgezogenen Welle X angebracht sind. Mit den Kniehebeln W, W
stehen aber ferner auch noch die Staͤbe Y, Y in
Zusammenhang; und diese fuͤhren an die an der Welle R aufgezogenen Kniehebel Z, Z, wodurch die von
den Kolben ausgeuͤbte Kraft auf die bereits beschriebene Art und Weise an die
Kniehebelwelle fortgepflanzt wird.
Die dritte Verbesserung an den Locomotivdampfmaschinen, naͤmlich die Anwendung
von KreissegmentenKreissegmeten als Fuͤhrer an den Zapfenlagern der Kniehebelwelle, ersieht man aus
Fig. 1 und
einzeln fuͤr sich aus Fig. 5. n, n sind diese Fuͤhrer, welche an dem Gestelle
des Wagens festgemacht sind, und an deren inneren Seiten Falzen angebracht sind, in
welchen sich die an den Tragstuͤken p
befindlichen Leisten o, o schieben, wie man dieß aus
Fig. 6
ersieht. Die Stuͤke pp tragen den Druk des
Wagens auf die Zapfenlager der Kniehebelwelle R. Wenn
der Wagen in Folge irgend einer außerordentlichen Belastung oder durch einen
ploͤzlichen Stoß herabsinkt, so werden auch die Fuͤhrer n, n, und mit diesen die Cylinder und Kolben
herabsinken; und wegen
der eigenthuͤmlichen Form dieser Fuͤhrer wird hiebei jederzeit
zwischen den Enden der Kolbenstangen D, D und dem
Mittelpunkte der Kniehebelwelle, so wie zwischen diesen und den Hebelarmen W, W eine und dieselbe Entfernung beibehalten bleiben.
Die Fuͤhrer bilden naͤmlich einen Theil eines Kreises, dessen
Mittelpunkt in den Zapfen liegt, durch welche die Kniehebelarme mit den
Kolbenstangen verbunden sind. Auf diese Weise sind also der Kolben und die
Schiebventile gezwungen sich innerhalb ihrer bestimmten Bewegungssphaͤre zu
bewegen.
Die vierte Erfindung, naͤmlich die Art der Verbindung und Aufziehung der
doppelten Zapfenlager der Kniehebelwelle, erhellt aus Fig. 1 und 2, so wie aus Fig. 6 und auch
aus Fig. 11
und 12. Das
Gewicht des Wagens und der Maschine wird von den Stangen q,
q getragen, deren untere Enden in Scheiden r
angebracht sind; leztere sind an den Seiten der Tragstuͤke p, p, die auf den Zapfenlagern der Kniehebelwelle ruhen,
gebildet. Diese Stangen q, q gehen durch Fuͤhrer,
welche an den Federn angebracht sind, und ihre oberen Enden sind mit Stellschrauben
versehen und mit dem Hebel s verbunden. An diesem Hebel
sind mittelst Zapfen zwei andere Hebel t, t angebracht,
mit deren Enden die Stangen u, u in Verbindung stehen.
Leztere umfangen und tragen die Federn v, v, an deren
Enden die Gelenkstuͤke w, w angebracht sind, die
mit dem Wagengestelle verbunden sind, so daß sich der Wagen und die Maschine also
auf solche Weise aufgehaͤngt befinden.
Bei dieser Einrichtung ist es nicht moͤglich, daß auf das Zapfenlager an der
einen Seite des Rades ein groͤßeres Gewicht oder eine groͤßere Gewalt
wirkt, als auf jenes der anderen Seite, indem das Gewicht zwischen beiden compensirt
oder ausgeglichen worden ist. Um jedoch ferner jeder ungleich auf die Zapfenlager
wirkenden Gewalt, die allenfalls dadurch entstehen koͤnnte, daß sich der
Wagen oder die Fuͤhrer nicht in einer senkrechten Linie mit der
Kniehebelwelle befinden, zu begegnen, sind die oberen Theile der Halsringe oder
Stuͤke x, x, in denen sich die Welle umdreht,
convex sphaͤrisch geformt, wie man dieß aus Fig. 6 ersieht; und diese
sphaͤrischen Theile passen in Scheiden, oder in entsprechende concave
Ausschnitte an der unteren Seite der Tragstuͤke p,
p. Mit Huͤlfe dieser Vorrichtung werden sich die Stuͤke x, x jederzeit nach Art eines Nußgefuͤges
stellen, so daß sie immer gehoͤrig und gleichmaͤßig auf der
Kniehebelwelle aufruhen. Die Zapfenlager werden mit Oehl oder irgend einem anderen
entsprechenden Stoffe schluͤpfrig erhalten, und zwar mittelst eines kleinen
Behaͤlters und einer Walze, welche mit der Welle in Beruͤhrung
laͤuft, wie dieß in den einzelnen Figuren angedeutet ist.
Die fuͤnfte Erfindung ersieht man in Fig. 7 und 8, von denen erstere einen
durchschnittlichen Grundriß des verbesserten Kolbens und leztere einen
Querdurchschnitt durch denselben darstellt. Die soliden Theile dieses Kolbens
bestehen aus zwei Haͤlften a, a, welche mittelst
eines doppelten Kegels an dem Ende der Kolbenstange b
angepaßt, und durch Schraubenbolzen an einander festgemacht sind. c, c sind metallene Ringe, von denen man in Fig. 9 einen
einzeln fuͤr sich abgebildet sieht. Diese Ringe drehen sich lose an einem
cylinderfoͤrmigen Theile des Kolbens; ihre aͤußeren
Oberflaͤchen sind zusammengewikelte Curven; ihre inneren Oberflaͤchen
hingegen bilden das verzahnte Kreissegment d, d, welches
in ein Getrieb e eingreift, das in einem in dem massiven
Theile des Kolbens befindlichen Ausschnitte angebracht ist. Die aͤußeren
Seiten dieser Ringe sind mit sogenannten kreisrunden Keilen oder Zwingen f, f, dergleichen man in Fig. 10 einen einzeln
fuͤr sich ersieht, umgeben. Diese Stuͤke zusammen bilden die
Liederung; ihre Enden sind mit Zapfen q an den massiven
Theilen des Kolbens d befestigt, damit sie nicht herum
gedreht werden koͤnnen, wenn die Liederung gespannt werden muß. Lezteres
geschieht, indem man durch die in dem Kolben befindliche Oeffnung h einen Schluͤssel in das vierekige Loch des
Getriebes fuͤhrt. Wenn man naͤmlich dieses leztere in der Richtung des
Pfeiles umdreht, so werden sich auch die zusammengerollten Ringe in dieser Richtung
bewegen, und die kreisfoͤrmigen Keile oder Zwingen f ausdehnen. Es versteht sich, daß die Gefuͤge dieser Zwingen nicht
in eine Linie mit einander gebracht werden duͤrfen, sondern uͤber
einander zu liegen kommen muͤssen, damit der Dampf nicht durch die Liederung
entweichen kann.
Bei diesem Baue der Kolben sind die Vortheile der massiven Kolben mit jenen der
Kolben mit elastischer Liederung vereint. Um die Abnuͤzung der Kolben und der
Cylinder, wenn sich diese in horizontaler Stellung befinden, zu verhuͤten,
laͤuft, wie Fig. 11 zeigt, wo jedoch nur ein Theil des Cylinders im Durchschnitte
dargestellt ist, nach der ganzen Laͤnge der unteren Seite des Cylinders ein
Falz i, in welchen eine aus gehaͤrtetem Stahle
verfertigte und mit Stellschrauben l versehene Stange
eingepaßt ist. Ein zweiter, aber schwalbenschwanzfoͤrmiger Falz ist an dem
Kolben oder dessen Liederung geformt, und in diesen ist ein anderes auf dem ersteren
ruhendes Stuͤk Stahl eingesezt, welches den Kolben traͤgt. Sollten
sich diese Theile durch die Reibung abnuͤzen, so kann die Stange k leicht durch die Stellschrauben nachgetrieben werden.
Da dieser Falz mit einer Hebelmaschine geschnitten wird, so raͤth der
Patenttraͤger die ganze innere Cylinderflaͤche auszuhobeln anstatt
auszubohren, indem man seiner Ansicht nach durch Hobeln einen vollkommneren Cylinder zu
erzielen im Stande ist, als durch Bohren.
Die sechste Erfindung, welche in einer verbesserten Methode die Geschwindigkeit des
auf horizontalen Schienenbahnen laufenden Wagens abzuaͤndern besteht, ersieht
man aus den senkrechten und Laͤngendurchschnitten Fig. 11 und 12. a, a ist die Kniehebelwelle, welche in Zapfenlagern, die
auf die oben beschriebene Weise compensirt sind, laͤuft. b ist eines der Laufraͤder, die sich lose an der
Kniehebelwelle, die gleichsam ihre Achse bildet, drehen. c ist ein an der Nabe des Laufrades befestigtes Zahnrad; d eine Scheibe, an deren innerer Seite ein verzahnter
Reifen e angebracht ist; f
eine andere, an der Kniehebelwelle befestigte Scheibe, die man auch einen doppelten
Kniehebel nennen kann. Diese Scheibe f fuͤhrt
zwei Zapfen g, g, an denen sich zwei Getriebe hh drehen, die in den verzahnten Reifen e und auch in das Zahnrad c
eingreifen. i ist ein Hals- oder Nabenring, der
sich an dem Ende der Kniehebelwelle schiebt; an ihm ist die Scheibe k, k angebracht, in der die beiden Zapfen l, l befestigt sind, und mittelst dieser Zapfen steht,
wie Fig. 11
zeigt, das Laufrad b mit der Scheibe d und mit dem inneren Rade e
in Verbindung, so daß sich saͤmmtliche Theile mit der Geschwindigkeit der
Kniehebelwelle mit dem Laufrade bewegen. Soll die Geschwindigkeit vermehrt werden,
so werden die Zapfen l, l aus der Scheibe d gezogen, indem man den Halsring i mittelst eines Hebels oder auf andere Weise an der Kniehebelwelle
verschiebt. Zugleich wird aber auch das innere Zahnrad e
in seinen Umdrehungen angehalten, und zwar mittelst eines Zaumes oder eines
Reibungsbandes m, m, welches die aͤußere
Oberflaͤche des Rades umfaßt, und welches durch die Stangen n, n und durch die an der Welle o, o angebrachten Excentrica damit in Beruͤhrung gebracht wird. Die
Welle o ist mittelst der Stange oder des
Gelenkstuͤkes p an dem Wagengestelle
aufgehaͤngt. Mit Huͤlfe dieser Vorrichtungen wird der verzahnte Reif
e allmaͤhlich zum Stillstehen gebracht; da
aber die Kniehebelwelle sich umzudrehen fortfaͤhrt, so werden sich die an der
Scheibe f befindlichen Getriebe h, h um ihre Achsen zu drehen beginnen, indem sie in die Zaͤhne des
nunmehr stillstehenden Rades e eingreifen, und hieraus
wird folgen, daß sich das Zahnrad c und mit diesem das
Laufrad b mit der vermehrten Geschwindigkeit von drei
Umgaͤngen auf einen Umgang der Kniehebelwelle bewegt. So wie man hingegen den
an der Stange q aufgehaͤngten Reibungszaum
nachlaͤßt, und die Zapfen l, l wieder mit der
Scheibe d in Verbindung bringt, werden die
Laufraͤder wie fruͤher wieder die Geschwindigkeit der Kniehebelwelle
bekommen.
Auf diese Erlaͤuterung meiner Verbesserungen an den Dampfmaschinen, sagt der
Patenttraͤger, muß ich nunmehr auch noch in Kuͤrze jene Theile der
Locomotivmaschine, an denen der Zeichnung gemaͤß meine Verbesserungen
angebracht sind, andeuten, um hierauf noch einige auf die stationaͤren
Dampfmaschinen oder auf die fuͤr Dampfboote bestimmten Maschinen
bezuͤgliche Modificationen zu bezeichnen. Die Cylinder A, A ruhen auf den Querriegeln 1, 1, 1 des Wagengestelles, von denen
zugleich auch der Kessel getragen wird. Die Schiebventile H,
H werden von den an der Kniehebelwelle R
befindlichen Excentricis 2, 2 in Bewegung gesezt. 3,3 sind Stangen, die von den
Excentricis an die Hebel 4, 4, die sich an der Welle X
gleichsam wie um ihren Stuͤzpunkt bewegen, fuͤhren. Die
entgegengesezten Enden dieser Hebel stehen mit den Stangen 5,5 in Verbindung, die
ihrerseits wieder mit den mit der Hand steuerbaren Hebeln 6,6 verbunden sind. Von
den Enden der lezteren laufen die Stangen 7,7 an die aus Fig. 1 und 2 ersichtlichen Stangen
8,8, welche durch Schraubengefuͤge damit verbunden sind. Die Stangen 8,8
selbst gehen durch cylindrische Fuͤhrer 9,9, welche in der Kammer I angebracht und mir Stopfbuͤchsen versehen
sind.Mehrere der Theile, auf welche sich der Patenttraͤger hier bezieht,
sind in der Abbildung, welche das London Journal
gibt, und die wir getreu wiedergeben, nicht mit den entsprechenden
Buchstaben und Zeichen versehen. Ebendieß ist auch noch bei einigen anderen
Figuren der Fall.A. d. R. Von den Stangen 8,8 aus ragen die Arme 10,10 in die Dampfkammer hinein, und
zwar durch die Oeffnung oder den Spalt 11 und zwischen den an den Scheiteln der
Schieber H, H angebrachten hervorragenden Leisten. Auf
diese Weise werden die Schiebventile in den erforderlichen Zeitraͤumen und
mittelst der Handsteuerung in Bewegung gesezt. Der auf der Platform 13 stehende
Maschinist kann die Bewegungen der Maschine umkehren, oder wenn es noͤthig
ist, die Maschine auch ganz stillstehen machen. Die
Ausfuͤhrungsroͤhren 14,14 stehen mit anderen in den Rauchfang
fuͤhrenden Roͤhren in Verbindung, wie dieß spaͤter beschrieben
werden wird.
Fig. 13 und
14 geben
einen Grundriß und einen Durchschnitt einer Methode die Kolbenstangen in den Dekeln
der Cylinder dampfdicht zu liedern, wobei die Spannkraft des Dampfes mit zur
Verhuͤtung des Entweichens des Dampfes benuzt ist. D ist die Kolbenstange und F der Dekel. Die
metallene Liederung besteht aus zwei Theilen 15,15, die rund um die Kolbenstange
herum gelegt werden, und deren Gefuͤge oben mit den Stuͤken 16,16
bedekt werden. Das Ganze wird durch das Dekelstuͤk 17, welches mit
Schraubenbolzen an dem Dekel F befestigt ist,
festgehalten. Der Dampf dringt durch eine Oeffnung in den Ausschnitt oder in die Einziehung der metallenen
Liederung, und draͤngt durch seine Expansivkraft die Liederung dicht an die
Kolbenstange, so daß das Entweichen des Dampfes dadurch verhindert ist.
Fig. 15 und
16 zeigen
eine andere Liederungsmethode der Kolbenstangen im Grundrisse und im Durchschnitte.
D ist die Kolbenstange; F der Dekel; 18,18 sind halbkreisfoͤrmige Stuͤke aus
gehaͤrtetem Stahle, welche die Kolbenstangen umfassen, und hinter welche in
die Ausschnitte 19,19 eine gewoͤhnliche hanfene Liederung gebracht ist. Das
Ganze wird durch das Dekelstuͤk 20 festgehalten.
Fig. 17 und
18 zeigen
einen Grundriß und einen Durchschnitt einer anderen Art von Kolben, an welchem die
Expansivkraft des Dampfes die einzelnen Theile der metallenen Liederung so nach
Außen draͤngt, daß diese in innige Beruͤhrung mit dem Cylinder
geraͤth. B ist der Kolben; D die Kolbenstange und 21 sind die Liederungssegmente, welche dampfdicht
zwischen den beiden Kolbenhaͤlften festgehalten werden. Zwischen der
Seitenwand der massiven Theile des Kolbens und der Liederung ist jedoch ein kleiner
Raum gelassen, durch den der Dampf eintritt, um die Liederung nach Außen zu
treiben.
Im Falle man es fuͤr zwekdienlich hielte, die Kraft beider Kolben nur an dem
einen Ende des Cylinders weiter fortzupflanzen, so koͤnnte dieß dadurch
geschehen, daß man die eine Kolbenstange hohl macht, und die andere sich in dieser
bewegen laͤßt. Erstere muͤßte jedoch an ihrem Ende mit einer
entsprechenden Stopfbuͤchse versehen seyn. Eine Einrichtung dieser Art sieht
man in Fig.
19 und 20 dargestellt. B und C sind Theile von Kolben, die an den Enden ihrer Kolbenstangen D, E befestigt sind. Die Stange D besteht aus einer hohlen Roͤhre, an deren Ende sich das Querhaupt
U, U befindet; mit diesem Querhaupte sind Stangen
verbunden, die an die Kniehebelwelle fuͤhren. Die Kolbenstange E bewegt sich durch die in dem Querhaupte angebrachte
Stopfbuͤchse, und steht an ihrem Ende gleichfalls mittelst einer Stange mit
einem an derselben Welle befindlichen Kniehebel in Verbindung.
Es erhellt offenbar, daß die beiden ersten der hier beschriebenen Erfindungen nicht
nur auf Locomotivmaschinen anwendbar sind, wie dieß bei der vorausgeschikten
Beschreibung angenommen ist; sondern daß sie eben so gut auch an den
stationaͤren und den fuͤr Dampfschiffe bestimmten Dampfmaschinen
Anwendung finden. Ich bemerke in dieser Hinsicht in Kuͤrze nur Folgendes.
Gesezt die Kniehebelwelle meiner Locomotivmaschine bilde einen Theil der
Haupttreibwelle einer Baumwollspinnerei, und diese Treibwelle mache 200 bis 250 Umgaͤnge in der
Minute, wie dieß gewoͤhnlich durch Vervielfaͤltigung der Nader und
Getriebe hervorgebracht wird; so ist bei Anwendung meiner Erfindung kein solches
Raͤderwerk erforderlich. Man braucht naͤmlich hier nur ein Flugrad von
beilaͤufig 4 Fuß im Durchmesser an die Haupttreibwelle, d.h. an die
Kniehebelwelle, zu bringen, je nach der Kraft, welche man noͤthig hat, einen
oder zwei Cylinder an der Wand des Gebaͤudes oder sonst irgendwo zu
befestigen, und die Kolben dieser Cylinder entweder mittelst einer hohlen
Kolbenstange oder mittelst der beschriebenen Communicationswelle mit der
Haupttreibwelle in Verbindung zu bringen. Alle Zahnraͤder sind hier
uͤberfluͤssig, indem die Maschine mit einer Geschwindigkeit von 250
Kolbenhuben und daruͤber arbeiten kann, ohne daß der Dampf in der
Ausuͤbung seiner vollen Kraft auf die Kolben ein Hinderniß
erfaͤhrt.
Von großer Wichtigkeit ist die Leichtigkeit, womit sich, wenn es noͤthig ist,
die Kraft dadurch erhoͤhen laͤßt, daß man einen anderen Cylinder an
der Treibwelle anbringt. In solchen Faͤllen, in denen ein kleiner Verlust an
Dampf durch Verdichtung nicht in Betracht kommt, kann ein aͤhnlicher Cylinder
selbst in irgend einer Entfernung mit einer eigenen Maschinerie in Verbindung gesezt
und durch eine Dampfroͤhre von einem Dampfkessel aus mit Dampf versehen
werden. Der Werth und Nuzen dieser verbesserten Dampfmaschine wird auch noch dadurch
bedeutend gesteigert, daß sie nur sehr einfache und leichte Grundlagen oder Gestelle
erfordert, indem die Maschine keine Gewalt darauf ausuͤbt.
Meine Verbesserungen an den Dampfkesseln fuͤr stationaͤre sowohl als
Locomotivdampfmaschinen bestehen 1) in einer neuen und verbesserten Einrichtung der
Sicherheitsklappen; 2) in dem allgemeinen Baue der Kessel fuͤr
Locomotivmaschinen mit den dazu gehoͤrigen Theilen, so wie auch in dem
Apparate zur Regulirung des Zuges mittelst des austretenden Dampfes; 3) endlich in
dem Baue der Kessel fuͤr stationaͤre Dampfmaschinen oder
Dampfboote.
Die erste dieser Verbesserungen ersieht man aus Fig. 21, in welcher ein
senkrechter Durchschnitt durch einen Theil des Kessels und des Sicherheitsventils
gegeben ist. A, A ist ein Theil des Kessels; B die von dem Kessel in den Cylinder C fuͤhrende Dampfroͤhre; D das Ventil. Dieser Cylinder steht auf der Platte E, welche von zwei anderen Cylindern F, G getragen wird; leztere sind an Scheiden oder
Randstuͤken, die an dem Kessel befestigt sind, fixirt. In jedem dieser
Cylinder befinden sich Ventile H, I; auch sind sie an
ihren unteren Enden zum Behufe des Eintrittes des Dampfes aus dem Kessel offen. Das
Kolbensicherheitsventil D paßt genau in den oberen Theil des
Cylinders C, und steht durch die Stange a mit einem zweiten Kolben K
in Verbindung, der unter der Oeffnung der Dampfroͤhre B angebracht ist, sich dampfdicht in dem unteren Theile des Cylinders
bewegt, und einen etwas groͤßeren Flaͤchenraum darbietet als der
Kolben D. Der in dem Cylinder C zwischen dem Ventile D und dem Kolben K enthaltene Dampf uͤbt seine Spannkraft auf
beide aus; da jedoch der Kolben K einen groͤßeren
Flaͤchenraum darbietet, so wird dieser herabgedruͤkt, woraus denn
folgt, daß das Ventil D mittelst der Verbindungsstange
a auf die Schultern b, b
so herabgezogen wird, daß der Cylinder dampfdicht geschlossen ist. Der Kolben I ist mit der Stange c,
welche durch die Platte E laͤuft, verbunden; und
das Ende dieser Stange dient als Zeiger an dem Dampfeichmaaße d. Der Kolben selbst wird durch eine Spiralfeder e, welche einen Druk von 5 bis zu 50 Pfd. auf den Quadratzoll auszuhalten
vermag, ohne zu brechen, niedergehalten. Das Kugelventil H wird durch eine Stange f, die durch die
Platte E geht, und an deren Ende sich eine Stellschraube
g befindet, auf ihren Siz niedergehalten, und zwar
mittelst der Spiralfeder h, h, die so berechnet ist, daß
sie einem Druke von weniger dann 51 Pfd. auf den Quadratzoll, welches der
hoͤchste in dem Kessel erforderliche Druk ist, nicht nachgibt. Gesezt daher,
der Druk des Dampfes in dem Kessel betrage nur 5 Pfd. auf den Quadratzoll, so wird
dieß auf den Kolben I keinen Einfluß haben; so wie
hingegen der Druk des Dampfes zunimmt, wird der Kolben I
in demselben Verhaͤltnisse emporsteigen, in welchem die Feder e nachgibt. Und wenn der Druk uͤber 50 Pfd. per Zoll, z.B. 51 Pfd. betraͤgt, so wird der
Kolben I in dem Cylinder G
so weit emporgestiegen seyn, daß die Oeffnung i an dem
Dampfwege k, k angelangt ist, der von dem Cylinder an
die untere Flaͤche des Kolbens K fuͤhrt.
Der Dampf wird daher unmittelbar darauf durch den Canal oder Dampfweg k, k aus dem Cylinder G
entweichen, den unter dem Kolben K befindlichen Theil
des Cylinders C erfuͤllen, den Kolben K empordruͤken, und das Ventil D uͤberwaͤltigen; wo dann der
uͤberschuͤssige Dampf durch die Oeffnung l,
l und die Ausfuͤhrungsroͤhre m in
die atmosphaͤrische Luft entweichen kann. Sobald jedoch der Druk des Dampfes
wieder unter 50 Pfd. per Quadratzoll herabsinkt,
druͤkt die Feder e den Kolben l wieder herab, so daß die Oeffnung k verschlossen wird. Die Folge hievon ist dann, daß der
Dampf neuerdings wieder auf die obere Flaͤche des Kolbens K wirkt, das Ventil D
herabzieht, und folglich das weitere Entweichen des Dampfes verhuͤtet. Die
kleine Quantitaͤt Dampf, die unter dem Kolben K
in dem Cylinder enthalten ist, kann man entweder verdichten oder durch eine sehr kleine Oeffnung
in die atmosphaͤrische Luft entweichen lassen. Wenn das Ventil I irgend ein Mal in Unordnung geraͤth oder nicht
gehoͤrig arbeitet, so wird das andere Ventil H
als eine zweite Sicherheitsklappe wirken. Denn es wird, indem dessen Feder h, unter einem Druke, der uͤber 51 Pfd. per Quadratzoll betraͤgt, nachgibt, emporsteigen
und den Dampf durch den Canal n gegen die untere Seite
des Kolbens K emporsteigen lassen, so daß dieser auf die
oben beschriebene Weise gehoben wird. Wenn der Maschinist das Sicherheitsventil
oͤffnen will, so braucht er nur die Schraube g zu
drehen; denn diese laͤßt das Ventil H nach, und
gestattet dem Dampfe angegebener Maßen auf den Kolben K
zu wirken.
Fig. 22 ist
ein senkrechter Laͤngendurchschnitt durch meinen verbesserten Dampfkessel
fuͤr Locomotivmaschinen mit dem Speisungscanale, der Feuerstelle, den
roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤgen, dem Aschenloche, dem Rauchfange,
dem Drosselventile und der Roͤhre, welche den austretenden Dampf in den
Rauchfang leitet. Fig. 23 gibt einen Grundriß dieses ganzen Apparates, und Fig. 24 einen Aufriß
seines vorderen Endes. A ist der zur Speisung dienende
Canal, an dessen oberem Ende ein Thuͤrchen angebracht werden kann. B die Feuerstelle oder der Ofen. C, C die Roststangen. D, D Wasserkammern, die
den Speisungscanal und den Ofen umgeben. E eine andere
Kammer oder ein Theil des Kessels, welcher fuͤr sich abgeschlossen und
uͤber dem Ofen angebracht ist, und dessen Boden das Bogengewoͤlbe der
Feuerstelle bildet. Diese Kammer ist mit Bolzen an dem Hauptkessel F, F befestigt; die Roͤhren a und b bilden seine
Wasser- und Dampf-Communicationen. Die Kammern D, D, welche sich an den Seiten der Feuerstelle befinden, stehen, wie man
besonders aus Fig.
25 ersieht, durch Roͤhren G, G mit
einander in Verbindung, und sind mit Stangen, Schraubenplatten und Schraubenmuttern
c, c, c befestigt. Die Roͤhre a* dient den Kammern zur Communication des Wassers,
waͤhrend die Roͤhren b* b* zur
Communication des Dampfes bestimmt sind. H, H, H sind
roͤhrenfoͤrmige Feuerzuͤge, welche wie gewoͤhnlich durch
den Kessel in das Aschenloch I gehen, uͤber
welchem der Rauchfang K befestigt ist. Die
Seitenwaͤnde dieses Aschenloches sind gleichfalls mit Wasserkammern d, e versehen, und diese stehen, wie Fig. 26 zeigt, durch die
querlaufenden Wasserroͤhren f mit einander in
Verbindung. Das von einer Pumpe der Maschine gelieferte Wasser tritt durch die
Roͤhre h in die untere Kammer d ein, um dann, nachdem es in den Roͤhren g quer durch das Aschenloch gelaufen, in die
entgegengesezte Kammer und aus dieser durch die Roͤhre i in den Kessel zu gelangen. Das von einer anderen Pumpe gelieferte Wasser
tritt durch die Roͤhre k
in die Kammer e, und gelangt, nachdem es durch die Roͤhren f gelaufen, von dem entgegengesetzen Ende durch die
Roͤhre l in den Kessel. Auf diese Weise wird also
das Wasser, bevor es in den Kessel gelangt, in den Roͤhren erwaͤrmt.
L ist ein Drosselventil von gewoͤhnlichem
Baue. M, M sind die Dampfroͤhren, die sich nach
zwei Richtungen theilen, den Kessel umfassen und an die Dampfbuͤchsen der
Schiebventile fuͤhren, wie dieß oben schon beschrieben worden ist. N ist die von der Maschine herfuͤhrende
Austrittsroͤhre fuͤr den Dampf, die den Kessel gleichfalls umgibt, und
dann in den Rauchfang fuͤhrt. Zum Behufe der Regulirung des Zuges, der durch
den Uebergang des austretenden Dampfes in den Rauchfang erzeugt wird, ist das Ende
der Roͤhre N so geformt, wie man es in Fig. 27 im
Durchschnitte dargestellt sieht. K ist naͤmlich
der gegen das obere Ende eingezogene oder verengerte Rauchfang. N die Austrittsroͤhre, an deren Ende eine andere
eigenthuͤmlich geformte Roͤhre O
angebracht ist. Diese Roͤhre ist naͤmlich an der einen Seite mit einer
Zahnstange m ausgestattet, deren Zaͤhne in das
Getrieb n eingreifen, welches in dem Rauchfange in
Zapfenlagern laͤuft. Das Ende der Welle oder Achse dieses Getriebes ragt
solcher Maßen hervor, daß man einen Schluͤssel mit einer Kurbel daran steken
kann, um auf diese Weise das Getrieb drehen, und dadurch die Roͤhre O emportreiben oder herabsenken zu koͤnnen. Der
Zug wird naͤmlich regulirt, je nachdem sich das Ende dieser Roͤhre
naͤher an dem eingezogenen Theile des Rauchfanges oder weiter davon entfernt
befindet; er kann sogar, wenn es noͤthig ist, ganz unterbrochen werden, ohne
daß dadurch der Austritt des Dampfes verhindert waͤre. Will man einen Zug in
dem Rauchfange erzeugen, bevor noch die Maschine arbeitet, und bevor noch Dampf
austritt, so wird die Klappe P, die durch den Hebel o und das Federgehaͤuse p auf ihren Siz niedergehalten wird, dadurch geoͤffnet, daß man die
Stange q anzieht. Dadurch steigt naͤmlich die
Klappe P empor, und der Dampf kann mithin direct aus dem
Kessel in den Rauchfang uͤbergehen. Die Klappe P
befindet sich in einem Gehaͤuse oder in einer Buͤchse, die mit der
Austrittsroͤhre N verbunden ist, und kann auch
als Sicherheitsventil benuzt werden.
Meine Verbesserungen an den Kesseln fuͤr stationaͤre Dampfmaschinen
oder Dampfboote beziehen sich auf jene Kessel mit beweglichen Feuerrosten, auf
welche ich am 24. Mai 1834 bereits ein Patent erhielt. Fig. 28 gibt einen
senkrechten Laͤngendurchschnitt durch einen meiner abermals verbesserten
Kessel. Fig.
29 ist ein Querdurchschnitt desselben. A, A
ist der Kessel; B, B die Feuerstelle; C, C der Plaz fuͤr die Roststangen und den
entzuͤndeten Brennstoff;
D ein Theil des Kessels, welcher an dem vorderen Ende
nach Abwaͤrts verlaͤngert ist, und unter welchem die beweglichen Roste
oder Roststangen, Nahmen, die ich in meinem fruͤheren Patente beschrieben
habe, in die Feuerstelle eintreten. E, E sind Stege oder
Theile des Kessels, die in die Feuerstelle herabragen. Die Seitenwaͤnde des
Kessels stehen durch mehrere, gehoͤrig in dem Kessel befestigte
Wasserroͤhren F, F mit einander in Verbindung.
G ist das Hauptloch; H
die Eintrittsmuͤndung des Feuerzuges.
Fig. 30 zeigt
einen anderen verbesserten Kessel dieser Art im Laͤngendurchschnitte; Fig. 31 gibt
hingegen einen Querdurchschnitt davon. A ist der Kessel;
B die Feuerstelle; C die
Stelle fuͤr die Roststangen; D der vordere Theil
des Kessels; E, E sind die Stege; F, F die roͤhrenfoͤrmigen, in dem Kessel angebrachten
Feuerzuͤge; G das Hauptloch; H die Eintrittsmuͤndung fuͤr den
Feuerzug.
In Fig. 32
ersieht man einen Laͤngen- und in Fig. 33 noch einest
Querdurchschnitt eines Kessels, der aus drei cylindrischen Roͤhren A, B, C zusammengesezt ist. Die beiden unteren dieser
Roͤhren B, C stehen durch die
Wasserroͤhren D, D, die quer durch die
Feuerstelle laufen, mit einander in Verbindung; und jede der beiden unteren steht
mit der oberen Roͤhre A durch die Oeffnungen E, E und die Roͤhren F in Communication. Die Enden dieser Kessel bestehen aus den gußeisernen
Stuͤken G, in denen sich die Hauptloͤcher
befinden. H sind die Dekel, an welche vier Ohren I, I, I, I gegossen sind, und die an Ort und Stelle
gebracht werden, indem man sie mit der Kante durch zwei in dem Hauptloche
befindliche Auskerbungen bringt; zwei der Ohren I, I
bedeken dann, wie in Fig. 33 durch Punkte
angedeutet ist, die Auskerbungen in dem Hauptloche, waͤhrend die anderen dazu
dienen, den Dekel an seiner Stelle zu erhalten. Die Dekel werden anfangs nur durch
einen Stab, welcher durch die Henkel gestekt wird, festgehalten; ist der Kessel aber
ein Mal mit Wasser gefuͤllt, so werden sie durch den Druk des Wassers und des
Dampfes fest und vollkommen schließend angedruͤkt. K ist die Stelle fuͤr die Roststangen und den entzuͤndeten
Brennstoff; L die Eintrittsmuͤndung des
Feuerzuges.
Tafeln