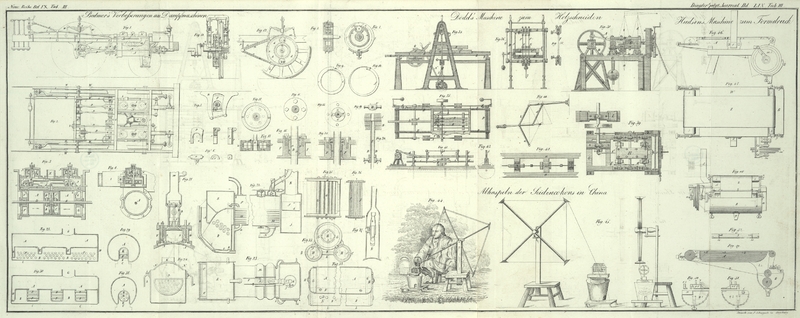| Titel: | Verbesserte Maschinen und Apparate zum Formendruke auf Seiden-, Wollen-, Baumwollen- und andere Zeuge, so wie auch auf Papier, worauf sich James Hudson, Calicodruker von Gale bei Rochdale in der Grafschaft Lancaster, am 4. December 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. XXVIII., S. 182 |
| Download: | XML |
XXVIII.
Verbesserte Maschinen und Apparate zum
Formendruke auf Seiden-, Wollen-, Baumwollen- und andere Zeuge, so
wie auch auf Papier, worauf sich James
Hudson, Calicodruker von Gale bei Rochdale in der
Grafschaft Lancaster, am 4. December 1834 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. December
1835, S. 321.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Hudson's Maschinen und Apparate zum Formendruke auf Seiden-,
Wollen-, Baumwollen- und andere Zeuge.
Bei dem Formendruke, so wie er gegenwaͤrtig gewoͤhnlich von den
Calicodrukern prakticirt wird, bedient man sich eines kreisrunden Siebes mit einem
hoͤlzernen Reifen, welches auf einem uͤberfirnißten Zeuge ruht, der uͤber
einen hoͤlzernen Reifen gespannt und daran genagelt ist. Lezterer schwimmt in
einem Bottiche oder in einem Kasten auf einer klebrigen, ziemlich diken
Fluͤssigkeit, die von den Englaͤndern das Geschwimm (swimming) genannt zu werden pflegt. Durch den Widerstand
des Geschwimmes gegen den uͤberfirnißten Zeug wird lezterer gegen den Boden
des auf ihm ruhenden Siebes angedruͤkt, so daß dieser Siebboden eine
elastische Tafel bildet, auf der die Farbe oder die Beize von Zeit zu Zeit
ausgebreitet wird. Dieß ist das Geschaͤft des sogenannten Streichknaben, der
sich hiezu einer Buͤrste bedient, und der so arbeitet, daß der Form, so oft
sie auf das Sieb gesezt wird, immer wieder eine neue und gleichmaͤßige
Farben- oder Beizoberflaͤche dargeboten wird. Der Zwek meiner
Erfindung ist nun den Farbknaben oder Streicher entbehrlich zu machen, und zugleich
den Formen eine regelmaͤßigere und gleichmaͤßigere Farben- oder
Beizoberflaͤche darzubieten, als dieß nach der gewoͤhnlichen Methode
moͤglich ist. Die Art und Weise, auf welche ich dieß bewerkstellige, und die
Einrichtung der Apparate, deren ich mich hiezu bediene, erhellt aus folgender
Beschreibung der auf Tafel III gegebenen Abbildung.
Fig. 46 gibt
einen seitlichen Aufriß meiner Maschine oder meines Apparates; Fig. 47 zeigt denselben
in Vogelperspektive oder im Grundrisse; waͤhrend man ihn in Fig. 49 von der Fronte,
und in Fig.
49 im Laͤngendurchschnitte ersieht. Fig. 50 und 51 sind die
einzelnen Theile, aus denen die beiden Enden des spaͤter zu beschreibenden
Farbtroges bestehen; und Fig. 52 gibt einen
Grundriß des sogenannten Doctors oder der Streichschiene.
An allen diesen Figuren sind gleiche Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet. A ist ein gußeiserner, oben offener Trog oder
Behaͤlter, der, wenn man sich seiner bedient, mit einem Wachstuche oder einem
lakirten Zeuge, wie ihn die Calicodruker gewoͤhnlich zum Auftragen und
Ausbreiten der Farben und Beizen benuzen, uͤberzogen ist. Die oberen
Raͤnder dieses Troges sind mit einem Vorsprunge a
versehen, uͤber den die Raͤnder des Wachstuchuͤberzuges
gespannt werden, um dann fest an die schmalen hoͤlzernen Leisten t genagelt zu werden, welche mit Schrauben, die von der
inneren Seite des Troges durch die kleinen in den Seitenwaͤnden befindlichen
Loͤcher b gehen, unter dem hervorstehenden Rande
des Troges befestigt werden. Die obere Flaͤche des Wachstuchuͤberzuges
ist in Fig.
47 mit W bezeichnet; und die Stellung der
hoͤlzernen Leiste unter dem vorspringenden Rande des Troges ersieht man in
Fig. 46,
48 und
49. In
der Seitenwand des Troges ist, wie man in Fig. 46 durch die
punktirten Linien C angedeutet sieht, eine Oeffnung
angebracht, die mit
einer aufrechten, oben offenen, eisernen Roͤhre in Verbindung steht. Diese
Roͤhre, welche von der aͤußeren Wand des Troges A in einer nach Aufwaͤrts gerichteten Curve emporsteigt und dann
eine senkrechte Stellung annimmt, ist mit dem Troge A
nicht aus einem Stuͤke gegossen, sondern mit Schrauben und Schraubenmuttern
daran befestigt. Das dem Troge zunaͤchst liegende Ende der Roͤhre ist
zu diesem Behufe auch mit einem hervorstehenden Randstuͤke versehen, damit es
die Schrauben aufnehmen kann. Zwischen dieses Randstuͤk und die Seiten des
Troges, die man in Fig. 46 und 47 ersteht, ist eine
Liederung gelegt, welche das Ganze festschließen macht. e sind zwei Arme oder Stege, welche ich die hinteren Rollenarme nenne, und
die von dem unteren Theile des einen Endes des Troges A
ausgehen. An jedem dieser Arme befindet sich an dem von dem Troge am weitesten
entfernten Ende ein aufrecht stehender Vorsprung f, und
in diesen ist zur Aufnahme einer langen Schraube g ein
Loch gebohrt. Diese Schraube g ist an beiden Enden in
einer Streke von ungefaͤhr 1/3 Zoll glatt abgedreht; und das dem Troge
zunaͤchst gelegene glatte Ende einer jeden der Schrauben g bewegt sich in einer in den Ruͤken des Troges
eingelassenen Scheide. Der Ruͤken des Troges ist an dieser Stelle zur
Aufnahme dieser Scheide verdikt. An jedem der hinteren Arme oder Stege e befindet sich eine lose Schraubenmutter h, die an die Schrauben g
paßt, und in deren obere Flaͤche zum Behufe der Aufnahme von Oehl eine kleine
Oeffnung oder ein Zapfen angebracht ist, damit die Theile gehoͤrig
schluͤpfrig erhalten werden koͤnnen. Diese Schraubenmuttern h dienen als Zapfenlager fuͤr die Enden der Achse
einer Walze, die sogleich ausfuͤhrlicher beschrieben werden wird.
An dem vorderen Ende des gußeisernen Troges befinden sich zwei absteigende, aus Fig. 48 und
49
ersichtliche Arme i¹ und i², die den Farbtrog B tragen, und an
denen sich zwei kleine Vorspruͤnge x befinden,
von denen der eine in der Mitte mit einem Loche, der andere hingegen mit einem
Laͤngenspalte versehen ist, und in denen die Enden der Achse der Walze Q laufen. k ist eine aus dem
vorderen Ende der Seitenwand des Troges A hervorragende
Unterlage; an diese sind die beiden, schief herabsteigenden Arme b¹, b²
geschraubt, und an den unteren Enden lezterer befinden sich die beiden Zapfenlager
fuͤr die Welle m der ausgekehlten Rolle m³. Die Welle m ragt
uͤber den Arm b² gegen den spaͤter
zu beschreibenden Farbtrog B hinaus; und an diesem
vorspringenden Theile ist eine Laͤngenrippe oder ein Schluͤssel
angebracht, der in ein fuͤr ihn bestimmtes, in dem Centralloche der
verschiebbaren Klauenbuͤchse o¹
befindliches Lager einpaßt. Die Arme dieser Klauenbuͤchse o¹ greifen, wenn dieselbe nach Einwaͤrts gegen den
Farbtrog getrieben wird, in die hervorstehenden Arme oder Schenkel der
Klauenbuͤchse o², welche sich an dem
benachbarten Ende der Welle der Walze 1 befindet.
In Fig. 47 und
48 ist
B ein Farbtrog, dessen vorderen und hinteren Theil
ich gewoͤhnlich aus einem Stuͤke Kupferblech oder aus einem anderen
entsprechenden Metalle oder auch aus einem trogfoͤrmig gebogenen Holze
verfertige, und in welchem ich am Grunde ein Loch y
anbringe, durch welches, wenn es noͤthig ist, die Farbfluͤssigkeit
abgelassen werden kann. Das Material, aus welchem der Farbtrog besteht, muß je nach
der Natur und Beschaffenheit der Farbe und der Beize, womit man arbeitet,
verschieden seyn, wie dieß jeder sachverstaͤndige Druker, der mit den
chemischen Wirkungen bekannt ist, ohnedieß wissen wird. Den Enden des Farbtroges
gibt man am besten die aus Fig. 50 und 51
ersichtliche Form; Fig. 50 zeigt die Theile an dem der Treibrolle m² zunaͤchst gelegenen Ende, waͤhrend man in Fig. 51 die an
dem entgegengesezten Ende befindlichen Theile ersieht. Jedes dieser beiden Enden
besteht aus einem oberen und einem unteren Stuͤke: q¹ und q² sind die unteren, und
r¹, r² die
oberen Stuͤke der entsprechenden Enden. Ein Theil des unteren Stuͤkes
q¹ ist nach Innen und ein Theil des
Stuͤkes q² nach Außen eingezogen, und zwar
zum Behufe der Aufnahme der Enden der Arme i¹,
i², welche von dem vorderen Ende des Troges
A herabsteigen. Das untere Stuͤk eines jeden
dieser Enden hat rings herum einen vorspringenden Rand, und an diesen sind die
entsprechenden Arme des Troges genietet. In dem Stuͤke q¹ befindet sich ein Loch 5, womit es an einem Zapfen
aufgehaͤngt ist, der aus der inneren Seite des herabsteigenden Armes i¹ der Treibrolle m² zunaͤchst hervorragt; das untere Stuͤk q² hingegen ist mittelst einer Schraube n an dem anderen absteigenden Arme i² befestigt. Diese Schraube geht naͤmlich
durch das Loch 6 und schraubt sich in das benachbarte Ende des absteigenden Armes
i², der zu deren Aufnahme zugerichtet ist.
Auf diese Weise werden die beiden Stuͤke, aus denen die Enden des Farbtroges
bestehen, zusammengehalten. Das an der oberen Kante der beiden unteren
Endstuͤke q¹ und q² befindliche Randstuͤk ist an dem vorderen Ende in einen
halbkreisfoͤrmigen Vorsprung ausgebreitet; und eine gleiche Ausbreitung
findet an dem an der unteren Kante der oberen Endstuͤke r¹ und r²
befindlichen Randstuͤke Statt. Je zwei dieser einander entsprechenden
Ausbreitungen, d.h. eine obere und eine untere, sind durch eine Schraube m³, die durch Loͤcher, welche zu deren
Aufnahme in die Ausbreitungen gebohrt sind, geschraubt wird, mit einander vereinigt.
An dem hinteren Theile des oberen Stuͤkes r¹ befindet sich eine Gabel oder eine Auskerbung, die den absteigenden Arm i¹ erfaßt. Diese Gabel, welche man in Fig. 50 bei
r³ im Aufrisse ersieht, dient dazu den
Farbtrog und die dazu gehoͤrigen Theile an Ort und Stelle zu erhalten. Auf
dem oberen Rande eines jeden der oberen Stuͤke r¹, r² befinden sich zwei
Vorspruͤnge 9 und 10, und in diesen sind Loͤcher angebracht, in denen
die glatt gedrehten Enden der Schrauben 11 laufen. An jeder dieser Schrauben 11 ist
eine bewegliche Schraubenmutter 12 aufgezogen, welche, wenn man die Schraube 11 mit
der an ihr befindlichen Daumenplatte umdreht, so weit nach Ruͤk- und
Vorwaͤrts bewegt werden kann, als es die Entfernung zwischen den beiden
Vorspruͤngen 9 und 10 gestattet. Jede dieser Schraubenmuttern oder dieser
verschiebbaren Stuͤke 12 endigt sich oben in eine Gabel, und beide Gabeln
erstreken sich horizontal nach Innen gegen einander, so daß sie die Unterlagen
fuͤr die Enden des Doctors oder der Streichschiene S bilden, wie man dieß am besten aus Fig. 48 und 52 ersieht.
Der Ruͤken des Doctors ist, um demselben mehr Staͤrke zu geben, nach
Aufwaͤrts gebogen; seine beiden Enden sind jedoch so zugeschnitten, daß sie
in die Gabeln passen, in denen sie dadurch festgehalten werden, daß Zapfen durch die
Loͤcher gehen, welche in die obere und untere Zinke einer jeden Gabel und in
die Enden des Doctors gebohrt sind.
1, 2, 3, welche man am besten aus Fig. 49 ersieht, sind
mehrere hoͤlzerne Walzen, von denen 1 die untere vordere, 2 die obere vordere
und 3 die hintere ist. 4 ist gleichfalls eine hoͤlzerne Walze, die mit
Flanell oder mit einem anderen aͤhnlichen Stoffe uͤberzogen seyn kann
oder auch nicht, je nach dem Grade der Klebrigkeit des Farbstoffes oder der Beize.
Diese leztere Walze, die zur Aufnahme des Farbstoffes oder der Beize aus dem Troge
bestimmt ist, nenne ich die Speisungswalze. Jede der vier Walzen laͤuft an
Achsen, die in Zapfenlagern, welche sogleich beschrieben werden sollen, ruhen. Die
Achse der Speisungswalze 4 laͤuft in Lagern, die sich frei in senkrechten
Falzen oder Fuͤhrern bewegen, welche an der inneren Seite des Endes des
Farbtroges angebracht sind, wie in Fig. 50 und 51 durch
punktirte Linien angedeutet ist. Diese Lager werden mittelst der Schrauben z in senkrechter Richtung bewegt, und lassen sich also,
da die Schrauben durch die untere Seite des Farbtroges gehen, so stellen, daß der
Druk zwischen den beiden Walzen 1 und 4 mit groͤßter Genauigkeit regulirt
werden kann. Die Zapfen der unteren vorderen Walze 1 ruhen auf den oberen Kanten der
unteren Stuͤke q¹ und q² der Enden des Farbtroges, und werden durch
Ausschnitte, welche in die oberen entsprechenden Stuͤke r¹, r²
gegossen sind, an Ort und Stelle erhalten. Die Zapfen der oberen vorderen Walze 2
laufen in einem Centralloche und in einem Lager, welche beide in den Vorspruͤngen x des Troges A angebracht
sind; die Zapfen der hinteren Walze 3 endlich laufen, wie bereits oben angedeutet
worden, in den Lagern h.
An jenem Ende der Walze 1, welches von der Treibrolle m² am weitesten entfernt ist, ist ein kleines Stirnrad 13 befestigt,
und dieses greift in ein zweites Stirnrad, welches unmittelbar unterhalb an dem
entsprechenden Ende der Speisungswalze 4 aufgezogen ist. Das
Groͤßenverhaͤltniß zwischen diesen beiden Raͤdern ist ein
solches, daß sich die Walze 4 mit einer geringen Reibung uͤber einem sogleich
naͤher zu beschreibenden endlosen Tuche dreht. Die Walzen 1,2,3
fuͤhren naͤmlich ein endloses Tuch Z,
welches aus solchem Zeuge, wie ihn die Druker gewoͤhnlich zur Verfertigung
des Bodens der Siebe verwenden, oder aus irgend einem anderen zur Aufnahme der
Farbstoffe und der Beizen geeigneten Fabrikate besteht. Dieses Tuch wird, wenn die
Walze 1 umgetrieben wird, in der Richtung des in Fig. 46, 47, 48 und 49 ersichtlichen Pfeiles
uͤber den Ueberzug W des Troges A hingefuͤhrt, so daß es mit demselben in
Beruͤhrung steht. Es geht auf seinem Laufe zwischen zwei kleinen Leisten 14
durch, die, wie man am besten aus Fig. 52 ersieht, in einer
der Breite des Tuches entsprechenden Entfernung von einander an dem Doctor oder der
Streichschiene S angebracht, und durch einen Draht 15
mit einander verbunden sind; d.h. der Zeug laͤuft, um die Maschinerie in
Bewegung zu sezen, durch den zwischen dem Drahte und dem Doctor befindlichen Raum.
Der Trog A ist an einem hoͤlzernen Gestelle
befestigt, dessen Fuͤße, welche in Fig. 46 und 48 als
gebrochen dargestellt sind, von einer dem Arbeiter bequemen Hoͤhe seyn
muͤssen. Ueber ihn wird, wenn er mit dem oben erwaͤhnten Geschwimm
gefuͤllt worden ist, der Ueberzug gespannt, den man auf die beschriebene
Weise fest an die hoͤlzerne Unterlage unter den Randstuͤken nagelt, so
daß nichts von dem Geschwimme entweichen kann. Dann wird durch die Rohre d noch etwas mehr von dem Geschwimme eingetragen, bis
dasselbe etwas hoͤher steht, als die Raͤnder des Troges, so daß auf
diese Weise ein der Hoͤhe der Fluͤssigkeit in der aufrechten
Roͤhre entsprechender Druk des Geschwimmes nach Aufwaͤrts gegen den
Wachstuchuͤberzug entsteht. Der Wachstuchuͤberzug bildet demnach eine
elastische Tafel, und uͤber diese wird dann das endlose Tuch gefuͤhrt,
indem man es uͤber die Walzen 2 und 3 und unter der Walze 1 durch laufen
laͤßt, wie man dieß am besten aus Fig. 49 ersieht. Die
Spannung des endlosen Tuches laͤßt sich reguliren, je nachdem man die hintere
Walze 3 stellt; und diese Walze laͤßt sich mittelst der auf die beweglichen
Lager h wirkenden Stellschrauben q je nach Umstaͤnden dem Ruͤken des Troges annaͤhern
oder davon entfernen.
Eben so laͤßt sich der Grad des Drukes, womit der Doctor S auf das endlose Tuch druͤkt, mit Huͤlfe
der Stellschrauben 11 reguliren. Nachdem diese Anordnungen getroffen, wird der
Ablaufcanal y des Farbtroges geschlossen, und der
Farbstoff oder die Beize in lezteren gebracht: und zwar bis auf eine solche
Hoͤhe, daß die Walze 4 bei ihren Umgangen eine hinreichende Quantitaͤt
davon aufzunehmen im Stande ist. Wenn nun die ausgekehlte Rolle m durch ein von einer Dampfmaschine oder einer anderen
Triebkraft herfuͤhrendes Laufband, oder auch mit der Hand umgetrieben wird,
so wird die Verkuppelungsbuͤchse o¹ an das Ende der Welle m getrieben, so daß sie, wie Fig. 48 zeigt, mit der
Klauenbuͤchse o² in Verbindung kommt. Dadurch geraͤth dann die
Walze 1, an deren Welle leztere Klauenbuͤchse aufgezogen ist, in Bewegung;
und durch das an dieser Welle befindliche Stirnrad 13 wird hierauf auch die
Speisungswalze umgetrieben, die, waͤhrend sie sich umdreht, den Farbstoff
oder die Beize aus dem Farbtroge aufnimmt, und ihn waͤhrend des Durchganges
des endlosen Siebes oder Gewebes Z unter der Walze 1 an
dieses Gewebe abgibt. Auf dem Wege von der Walze 1 an die Walze 2 wird das endlose
Gewebe an den Doctor oder an die Streichschiene S
gedruͤckt, wodurch die uͤberschuͤssige Farbe abgestreift wird,
und in den Farbtrog zuruͤkfaͤllt. Damit dieß noch leichter geschehen
koͤnne, sind die Achsen der Walzen 1 und 2 nicht in einer und derselben
senkrechten Linie, sondern in etwas schiefer Richtung: d.h. die Walze 2 etwas vor
der Walze 1, angebracht. Die kleinen Leisten 14, welche sich an der Streichschiene
befinden, streichen auch von den Raͤndern des endlosen Gewebes den
uͤberschuͤssigen Farbstoff ab. Bei der weiteren Bewegung des endlosen
Tuches uͤber die elastische Tafel sezt der Druker die Form auf dasselbe,
gleichwie er sie sonst auf das Sieb sezt, um dann mit dieser Form das Muster in
Farbe oder Beize auf den zu bedrukenden Zeug aufzutragen.
Die Große und die uͤbrigen Verhaͤltnisse meines Apparates und der
verschiedenen Theile, aus denen er besteht, so wie das Material, dessen man sich zu
ihrer Verfertigung bedient, muͤssen je nach der Groͤße der Form, und
je nach dem Farbstoffe oder der Beize, womit gedrukt werden soll, verschieden
modificirt werden. Alle diese Modificationen wird jedoch jeder
sachverstaͤndige Druker anzubringen wissen, ohne daß dadurch eine Abweichung
von dem Principe meiner Erfindung bedingt waͤre. Obschon ich endlich die oben
beschriebene Methode ein endloses Tuch uͤber mehrere Walzen zu fuͤhren
und dadurch in Bewegung zu erhalten, fuͤr die beste und einfachste
Vorrichtung halte, so kann doch derselbe Zwek auch durch verschiedene andere
Mechanismen erreicht werden; ich gruͤnde daher meine Patentanspruͤche
lediglich darauf,
daß ich den Drukformen mittelst einer geeigneten Zeugoberflaͤche, die sich
uͤber eine elastische oder irgend eine andere entsprechende Unterlage bewegt,
bestaͤndig eine neue und gleichmaͤßig ausgebreitete Lage Farbstoff
oder Beize darbiete.
Tafeln