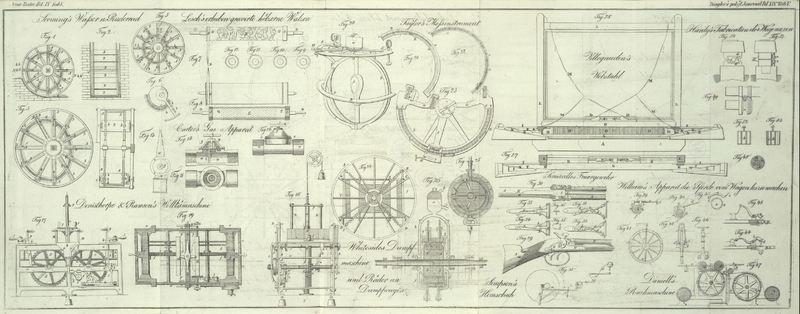| Titel: | Verbesserungen an den Rädern der Dampfwagen und an den Maschinen zum Treiben derselben, worauf sich Robert Whitaside, Weinhändler von Air in der Grafschaft Air, am 20. Nov. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. L., S. 324 |
| Download: | XML |
L.
Verbesserungen an den Raͤdern der
Dampfwagen und an den Maschinen zum Treiben derselben, worauf sich Robert Whitaside,
Weinhaͤndler von Air in der Grafschaft Air, am 20. Nov. 1834 ein Patent ertheilen ließ.
(Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Januar
1836, S. 10.)
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Whitaside's verbesserte Raͤder zum Treiben der
Dampfwagen.
Meine Erfindung betrifft 1) gewisse Verbesserungen an den Raͤdern der
Dampfwagen; und 2) gewisse Verbesserungen an den rotirenden Dampfmaschinen, welche
nicht nur zum Fortschaffen der Dampfwagen, sondern auch zum Betriebe anderer Arten
von Maschinerien geeignet sind.
Was den ersten dieser beiden Gegenstaͤnde betrifft, so bezweke ich durch meine
Erfindung eine feste Verbindung zwischen den bewegenden und den bewegten Theilen,
oder zwischen der Dampfmaschine und der Achse der Raͤder, die den Wagen
treiben. Und um diesen Zwek zu erreichen, bringe ich die Federn, die sich
gewoͤhnlich uͤber diesen Raͤdern befinden, innerhalb derselben
an, wobei ich an den Raͤdern zwei vierekige Rahmen befestige, damit die
Federn nicht durch die drehende Kraft der Maschine zerrissen werden. Die in Fig. 24
gegebene Zeichnung wird das Ganze deutlich und anschaulich machen.
A, B, C, D ist der aus Eisen bestehende aͤußere
Umfang des Rades. Die Speichen sind mit dem einen Ende an den Reifen genietet oder
auf andere Weise daran befestigt; waͤhrend sie mit dem anderen Ende an einen
flachen Ring genietet, oder auch an einen solchen, zur Aufnahme von Schrauben
stellenweise verdikten Ring geschraubt sind. Der mittlere Raum in diesem Ringe ist
je nach dem Spielraume, den man den Federn gestatten will, verschieden; hier in
diesem Falle hat er einen Durchmesser von 8 Zoll. Die Punkte A, B, C, D sind gleichweit von einander entfernt. Zwischen A und C und B und D sind zwei Stangen
angebracht, welche parallel mit einander an beiden Enden in dem Reifen des Rades
festgemacht seyn muͤssen. An diesen Stangen bewegt sich ein vierekiger
eiserner Rahmen, E, F, G, H, und zwar mittelst Oehren
oder Ringen, welche die beiden Stangen umfassen. Diese Ringe koͤnnen mit
Reibungsrollen ausgestattet werden, damit sie sich um so freier an den parallelen
Stangen bewegen koͤnnen; uͤbrigens ist dieß nicht durchaus nothwendig.
An diesem Rahmen E, F, G, H schiebt sich ein anderer
kleinerer Rahmen von gleicher Beschaffenheit: jedoch unter rechten Winkeln mit der
Bewegung des ersteren. Anstatt daß die Ringe des lezteren gleichwie an dem ersten Rahmen an Stangen und
an den Querstangen I und J
festgemacht sind, sind sie hier an einer Eisenplatte befestigt, in deren Mitte sich
fuͤr den Durchgang einer Achsenbuͤchse ein Loch befindet. Die
Buͤchse ist mittelst eines an sie gegossenen vorspringenden Randes an die
erwaͤhnte Platte gebolzt, und geht durch das Loch oder durch die Oeffnung,
welche sich in der Mitte des Rades befindet, so daß das eine Ende der Federn auf
irgend eine geeignete Weise an ihr, das andere Ende hingegen an dem Umfange des
Rades befestigt werden kann. Das ganze Rad kann hierauf, um die Rahmen etc. gegen
Naͤsse und Staub zu schuͤzen, zu beiden Seiten mit einer
duͤnnen Eisenplatte verkleidet werden. Daß hiebei in die innere Platte zum
Behufe des Durchganges eine Oeffnung von gehoͤriger Groͤße, d.h. von 8
Zoll im Durchmesser, geschnitten seyn muß, versteht sich von selbst; doch kann diese
Oeffnung mit einem wasserdichten Zeuge bedekt seyn, indem man denselben einerseits
wasserdicht an einem Theile der Achse, und andererseits an der inneren Dekplatte
befestigt.
Da ich wohl weiß, daß bereits schon fruͤher mehrmals Federn in oder an den
Raͤdern angebracht worden sind, so gruͤnde ich hierauf keine
Anspruͤche; meine Erfindung an den Raͤdern der Dampfwagen
beschraͤnkt sich demnach auf die Anwendung der beiden beschriebenen
vierekigen Rahmen, wodurch verhuͤtet wird, daß die zum Treiben der Wagen
dienende Kraft auch auf die Federn wirkt.
Der zweite Theil meiner Erfindung bezieht sich, wie gesagt, auf die sogenannten
rotirenden Dampfmaschinen, und bezwekt nicht nur eine dampfdichte Verschließung,
sondern auch eine Verminderung der Reibung. Ich bediene mich zu diesem Behufe eines
oder mehrerer Behaͤlter, in denen irgend eine geeignete Fluͤssigkeit,
am besten geschmolzener Talg oder Oehl, enthalten ist. Diese Fluͤssigkeit
wird einem Druke ausgesezt, der etwas groͤßer ist als die Kraft jenes
Dampfes, welcher auf den Kolben druͤkt; und wird hiedurch so in alle Spalten
und zwischen saͤmmtliche sich bewegende Theile der Maschine eingetrieben, daß
nicht nur kein Dampf verloren gehen kann, sondern daß solcher Maßen die Reibung auch
beinahe gaͤnzlich beseitigt wird. Die Theile, zwischen welche das Eintreiben
der Fluͤssigkeit hauptsaͤchlich erforderlich ist, sind: 1) der Raum
zwischen dem aͤußeren Rande des Kolbens, der sich gewoͤhnlich in
Beruͤhrung mit dem aͤußeren Cylinder bewegt, und dem aͤußeren
Cylinder; 2) jene stelle, an der sich der innere Cylinder und die Enden des
aͤußeren mit einander in Beruͤhrung umdrehen; und 3) endlich jene
Stelle an der die Kante der Schieber mit dem inneren Cylinder in Beruͤhrung
kommt. Um diesen Zwek zu erreichen, muß der erwaͤhnte Behaͤlter von
hinlaͤnglichem Rauminhalte und entweder in einer solchen Hoͤhe
angebracht seyn, daß die Kraft der Fluͤssigkeit, wenn sie in entsprechenden
Roͤhren an die drei oben erwaͤhnten Stellen geleitet worden,
groͤßer als der Druk des Dampfes auf den Kolben ist. Oder auch von dem oberen
Theile des Behaͤlters kann eine Roͤhre an den Kessel fuͤhren,
so daß sich die in ihm enthaltene Fluͤssigkeit unter demselben Druke
befindet, wie der Kolben. Zugleich muß aber auch der Behaͤlter so hoch
uͤber dem hoͤchsten Punkte, den der Kolben bei seinen Umdrehungen
erreicht, angebracht seyn, daß die Fluͤssigkeit mit Leichtigkeit durch die
von dem Behaͤlter ausgehenden Roͤhren fließen kann, und in einen Canal
gelangt, welcher laͤngs der Mitte des aͤußeren Randes der
Kolbenliederung, oder wenn keine solche vorhanden ist, des Kolbens selbst
geschnitten ist. Zu diesem Behufe muß der Kolben sehr genau eingepaßt seyn, damit
der Dampf nicht durch die hoͤhere Saͤule der Fluͤssigkeit von
der einen Seite des Kolbens auf die andere gedruͤkt werden kann. Auf dieselbe
Weise wird die Fluͤssigkeit auch zwischen den sich bewegenden inneren
Cylinder und jene Stellen geleitet, die sich zwischen ihm und den Enden des
aͤußeren Cylinders befinden. Eben so wird die Fluͤssigkeit ferner in
Roͤhren aus dem Behaͤlter an den Rand der Schieber geleitet und durch
hohle Spindeln gefuͤhrt, mit denen die Schieber auf und nieder bewegt werden,
und die so eingerichtet sind, daß wenn die Fluͤssigkeit nicht
beizustroͤmen braucht, die Bewegung der Spindeln selbst die
Eintrittsoͤffnung verschließt. Diesen lezteren Theil des Apparates, d.h.
jenen, durch welchen die Fluͤssigkeit den Schiebern zugefuͤhrt wird,
halte ich zwar nicht fuͤr ebenso wesentlich, als die beiden vors hergehenden;
doch traͤgt auch er zu dem besseren Gange der Maschine und zu vollkommnerer
Verhuͤtung des Auslassens von Dampf bei. Nachdem die Fluͤssigkeit ihre
Dienste geleistet, fließt sie in die an dem untersten Theile der Maschine
befindliche Schieberbuͤchse herab, von wo aus sie dann in Roͤhren in
eine Pumpe geleitet wird, die sie wieder in den Behaͤlter emporschafft, damit
sie daselbst neuerdings wieder verwendet werden koͤnne.
Da ich weiß, daß ein auf demselben Principe beruhender Apparat bereits an den
Maschinen mit Wechselwirkung angewendet wurde, und daß die gewoͤhnliche, oben
offene (open-topped) Maschine durch Benuzung
ebendieses Principes dampfdicht geschlossen erhalten wird, so gruͤnde ich
meine Patentanspruͤche lediglich auf die Anwendung des oben beschriebenen
Apparates (naͤmlich des Behaͤlters mit der Fluͤssigkeit, die
unter gehoͤrigem Druke erhalten wird, der Roͤhren, die die
Fluͤssigkeit an die entsprechenden Stellen leiten, und der Pumpe, womit sie
in den Behaͤlter zuruͤk geschafft wird an den rotirenden Maschinen. Es gibt
zwar eine große Menge rotirender Dampfmaschinen, denen sich meine Erfindung anpassen
ließe; allein nach meinem Dafuͤrhalten duͤrfte die hier abgebildete,
welche jener sehr aͤhnlich ist, auf welche Bramah
und Dickenson im Jahre 1790 ein Patent nahmen, die meiste
Wahrscheinlichkeit des Gelingens darbieten und auch die allgemeinste Benuzung
zulassen.
Man sieht diesen Apparat in Fig. 25 und 26 abgebildet,
a ist der Behaͤlter, der die
Fluͤssigkeit faßt, und von welchem aus die Roͤhren b, b an die Maschine fuͤhren, c ist ein Canal, welcher unter dem Kolben durch den
inneren Cylinder d fuͤhrt. e, e, e sind drei Canaͤle, die von c
aus in eine Rinne oder Furche fuͤhren, die in den Rand des Kolbens oder der
Kolbenliederung geschnitten ist. f, f sind
Roͤhren, die an die hohlen Spindeln des unteren Schiebers fuͤhren, und
die mit einer Furche oder Rinne communiciren, welche laͤngs der Liederung der
unteren Kante des Schiebers geschnitten ist, und durch die Fluͤssigkeit an
diese Theile gelangen kann. g, g sind aͤhnliche
Roͤhren, welche jedoch an die hohlen Spindeln des oberen Schiebers
fuͤhren. h ist die an die Pumpe fuͤhrende
Roͤhre; leztere ist jedoch hier nicht abgebildet, i ist eine Roͤhre, die von der Pumpe in den Behaͤlter
zuruͤkfuͤhrt. k endlich ist eine
Dampfroͤhre, die von einem Dampfkessel an den Behaͤlter fuͤhrt.
Da jene Theile, womit die Schieber und uͤbrigen Theile der Maschine in
Bewegung gesezt werden, nicht mit zu meiner Erfindung gehoͤren, so hielt ich
es nicht fuͤr noͤthig auch sie hier naͤher zu beschreiben und
abzubilden.
Tafeln