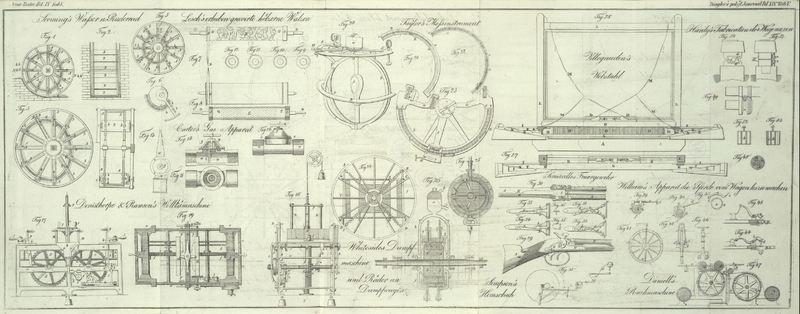| Titel: | Verbesserungen im Kämmen der Wolle und anderer Faserstoffe, worauf sich George Edmund Donisthorpe, Wollenspinner von Leicester, und Henry Rawson, Strumpffabrikant ebendaher, am 3. April 1835 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 59, Jahrgang 1836, Nr. LIX., S. 346 |
| Download: | XML |
LIX.
Verbesserungen im Kaͤmmen der Wolle und
anderer Faserstoffe, worauf sich George
Edmund Donisthorpe, Wollenspinner von Leicester, und Henry Rawson, Strumpffabrikant
ebendaher, am 3. April 1835 ein Patent
ertheilen ließen.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Januar
1836, S. 1.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Ueber Verbesserungen im Kaͤmmen der Wolle.
Unsere Erfindung, sagen die Patenttraͤger, besteht in der Verbindung
verschiedener Mechanismen zu einer Maschine, welche auf die sogleich zu
beschreibende Art und Weise zum Kaͤmmen von Wolle und anderen Faserstoffen
dient.
Fig. 17 gibt
einen Aufriß einer nach unserer Erfindung erbauten Maschine. Fig. 18 zeigt dieselbe
vom Ende her gesehen, waͤhrend Fig. 19 einen Grundriß
vorstellt. An saͤmmtlichen Figuren sind gleiche Theile mit gleichen
Buchstaben bezeichnet.
aa ist das Gestell der Maschine, dessen
Einrichtung aus einem Blike auf die Zeichnung erhellen wird. b ist die Haupt- oder Treibwelle, die sich zu beiden Seiten der
Maschine in entsprechenden Zapfenlagern dreht, und welche durch ein von irgend einer
Triebkraft herfuͤhrendes Laufband in Bewegung gesezt wird. An dieser Welle
befindet sich ein Getrieb, welches in das an der Welle c
angebrachte Rad c eingreift; und lezteres greift
seinerseits wieder in das an der Welle e aufgezogene
Zahnrad d. Die Wellen c und
e drehen sich zu beiden Seiten der Maschine in
geeigneten Zapfenlagern. An jedem der beiden Raͤder c und d befinden sich zwei Vorspruͤnge
oder Zapfen f, welche auf die sogleich weiter zu
beschreibende Weise die Kaͤmme g, g veranlassen,
daß sie die Wolle auskaͤmmen.
h, h sind die Tafeln oder Wagen der Kaͤmme; sie
koͤnnen sich laͤngs der oberen Riegel oder Balken des Gestelles a, a hin und her schieben, und diese bilden gleichsam
parallele Fuͤhrer fuͤr erstere, wie aus der Zeichnung deutlich
erhellt. Durch diese Tafeln oder Fuͤhrer sind Spalten oder Fenster
geschnitten, welche man mit punktirten Linien angedeutet sieht, und welche den
Kammhaͤltern i, i als Fuͤhrer dienen. Die
Kammhaͤlter koͤnnen sich demgemaͤß unter rechten Winkeln mit
jener Bahn bewegen, die die Tafeln oder Wagen h, h
durchlaufen. Die Kamme g, g werden mittelst der
Hebelgriffe j, j in ihren Haͤltern festgehalten,
indem sich diese Griffe auf schiefen Flaͤchen bewegen, und folglich mit
solcher Gewalt auf die Haͤupter der Kaͤmme g,
g druͤken, daß diese mit gehoͤriger Festigkeit an Ort und Stelle gehalten werden.
Zu noch groͤßerer Sicherheit sind aber an den Kammhaͤltern auch noch
Zapfen angebracht, die in die Haͤupter der Kaͤmme eindringen. Unter
den Tafeln oder Wagen und an denselben befestigt befinden sich die
gabelfoͤrmigen Vorspruͤnge i, i, welche
durch die in diesen Wagen h, h angebrachten Spalten oder
Fenster gehen, und mittelst des Rahmens k, k von einer
Seite zur anderen bewegt werden. Dieser Rahmen selbst dreht sich an der Welle l, l, und wird durch den Daͤumling m, welcher durch das an der Welle e befestigte Excentricum n, n in
Thaͤtigkeit gebracht wird, hin und her bewegt. Die Wagen h, h werden durch die an den Schnuͤren oder
Riemen o, o aufgehaͤngten Gegengewichte nach
Einwaͤrts gezogen, und diese Riemen laufen uͤber die Reibungsrollen
p, p. Auf diese Weise werden demnach diese Gewichte
die Kaͤmme bestaͤndig in den Mittelpunkt der Maschine zu ziehen
trachten, sobald sie dadurch, daß die Zapfen f
uͤber die an den Wagen h befindlichen
Daͤumlinge q, q hinaus gelangen, frei werden. Es
wird dieß aus der weiter unten folgenden Beschreibung der Art und Weise, auf welche
die Maschine arbeitet, noch deutlicher werden.
An der Welle c ist ein Sperrkegel r angebracht, der bei jeder Umdrehung dieser Welle das Sperrad s um einen Zahn vorwaͤrts treibt. An diesem
Sperrrade, welches sich um die Welle t dreht, ist eine
Rolle v befestigt, und an dieser ist der Riemen w festgemacht, der andererseits auch an der Rolle x befestigt ist. Leztere Rolle ist an der Welle y aufgezogen, und diese dreht sich zu beiden Seiten der
Maschine in entsprechenden Zapfenlagern. An ihr befinden sich aber auch noch zwei
andere Rollen zz
, an denen die Riemen AA befestigt sind, obschon diese andererseits auch an dem Ende der
graduirten Platten B festgemacht sind. Diese Platten
haben gradweis eingetheilte Stufen, gegen welche die Wagen der Maschine jedes Mal
angezogen werden. Je hoͤher die Platten emporgehoben werden, um so mehr
koͤnnen sich die Wagen h dem Mittelpunkte der
Maschine naͤhern, und um so mehr werden die Kaͤmme folglich von dem
Faserstoffe aufnehmen und kaͤmmen. Die graduirten Platten B werden von den Balken C,
welche wie die Zeichnung zeigt, durch Fuͤhrer oder Oeffnungen gehen, die in
dem Gestelle a angebracht sind, emporgefuͤhrt. An
dem Sperrrade s ist ein schief abgedachter Vorsprung E angebracht, der im Laufe der Umdrehung des Sperrrades
unter den Hebel F gelangt, welcher an der in den
Zapfenlagern H laufenden Welle G befestigt ist. An ebendieser Welle befinden sich zugleich aber auch die
Hebel I und J, von denen
ersterer dazu dient den Sperrkegel K aus dem Sperrrade
zu ziehen, damit die Theile der Maschine wieder in jene Stellung zuruͤkkehren
koͤnnen, in der sie sich beim Beginne der Operation befanden. Der Hebel J hingegen dient dazu die Trommel der Treibwelle b mittelst des gabelfoͤrmigen Griffes L außer Thaͤtigkeit zu bringen, sobald die
Maschine nach vollendeter Kaͤmmung einer bestimmten Quantitaͤt Wolle
oder Faserstoff in ihrer Bewegung unterbrochen werden soll. Die Kaͤmme,
welche die Wolle, die gekaͤmmt werden soll, halten, haben eine Bewegung nach
Aufwaͤrts, damit die Wolle außer den Bereich der Kaͤmme g, g gebracht wird, wenn diese Kaͤmme in die
Mitte der Maschine gezogen werden, worauf dann die Haltkaͤmme wieder
herabtreten, um die Wolle unter die Spizen der Kaͤmme g, g zu bringen. Um nun diese Bewegung nach Auf- und
Abwaͤrts zu erzielen, sind die Kaͤmme M, M
in dem Rahmen N angebracht, in welchem sie auf
aͤhnliche Weise festgehalten werden, wie die Kaͤmme g, g in den Haͤltern i,
i. Dieser Rahmen, dessen Einrichtung man in den verschiedenen Figuren
deutlich ersieht, ist an der Spindel oder Stange O, die
sich senkrecht durch Oeffnungen in dem Querhaupte P und
in dem Querbalken Q der Maschine bewegt, befestigt. Von
dem oberen Ende dieser Spindel aus laͤuft ein Riemen, an welchem ein Gewicht
aufgehaͤngt ist, uͤber eine Rolle. Das Querhaupt wird von den beiden
an dem Querbalken Q befestigten Leitstangen R getragen; und mittelst dieser Leitstangen R, R und der Spindel O wird
der Rahmen N gezwungen senkrecht emporzusteigen oder
herabzusinken, waͤhrend die Spindel O selbst
wieder dadurch zum Emporsteigen gebracht wird, daß die an den Raͤdern c und d befindlichen Zapfen
f allmaͤhlich unter die an der Spindel O angebrachten Vorspruͤnge S gelangen.
Nach Vorausschikung dieser Beschreibung wollen wir nun auch das Spiel der Maschine
deutlich zu machen suchen. Man bringt eine solche Quantitaͤt Wolle, wie sie
die Maschine zu kaͤmmen im Stande ist, auf jeden der Kaͤmme g, g und M, M,
waͤhrend sich die Maschine in der aus Fig. 17 ersichtlichen
Stellung befindet. Wenn hierauf die Hauptwelle in Bewegung gesezt wird, so wird
diese die Bewegung mittelst des an ihr befindlichen Getriebes an das Rad c und hiedurch auf die beschriebene Weise an die
uͤbrigen Theile der Maschine fortpflanzen. Der erste Theil der Bewegung wird
bewirken, daß die Kaͤmme M, M so hoch gehoben
werden, daß die Wolle außer den Bereich der Kaͤmme g,
g kommt; leztere werden naͤmlich alsogleich gegen die Mitte der
Maschine gezogen, sobald sie dadurch frei werden, daß die Zapfen f uͤber die aus den Wagen h hervor, ragenden Arme oder Daͤumlinge q gehen. Die Entfernung zwischen den Kaͤmmen g, g und den Kaͤmmen M, M wird jedoch
von der Hoͤhe, auf welche die graduirten Platten B emporgehoben worden, abhaͤngen, und da diese Platten bei jedem Umgange
der Welle c um eine Stufe emporgehoben werden, so werden
sich folglich die Kaͤmme g, g fortwaͤhrend
immer mehr und mehr den Kaͤmmen M, M
naͤhern, bis die Platten B endlich so weit
emporgestiegen sind, daß sich die Wagen oder Tafeln h, h
unter der untersten Stufe den Platten B naͤhern
koͤnnen. Wenn dann die Maschine in ihrer Bewegung fortfaͤhrt, so
werden die Wagen bloß gegen parallele Oberflaͤchen treffen, und die
Kaͤmme allmaͤhlich in dieselbe Stellung gerathen, bis der schief
abgedachte Vorsprung E an dem Sperrrade s unter den Hebel F gelangt,
wodurch die Maschine zum Stillstand kommt. Die gekaͤmmte Wolle wird dann aus
der Maschine genommen und eine frische Quantitaͤt dafuͤr eingesezt. Zu
bemerken ist, daß sich die Kaͤmme g, g
waͤhrend des Kaͤmmprocesses fortwaͤhrend von einer Seite der
Maschine zur anderen bewegen.
Aus dieser Beschreibung erhellt offenbar, daß der Zwek der Erfindung auf der
Erzielung der eigenthuͤmlichen Bewegungen der Kaͤmme g, g und M, M beruht. Jeder
Sachverstaͤndige wird aber auch einsehen, daß die hiezu noͤthigen
Details modificirt werden koͤnnen, ohne die Resultate zu
beeintraͤchtigen. Wir beschraͤnken demnach unsere Erfindung nicht ganz
genau auf die hier beschriebenen Details, obschon uns diese die
zwekmaͤßigsten zu seyn scheinen. Wir verwenden zwar unsere Maschine
hauptsaͤchlich nur zum Kaͤmmen der Wolle; es versteht sich aber
uͤbrigens, daß sie sich auch zum Kaͤmmen von Ziegenhaar und anderen
Faserstoffen eignet.
Tafeln