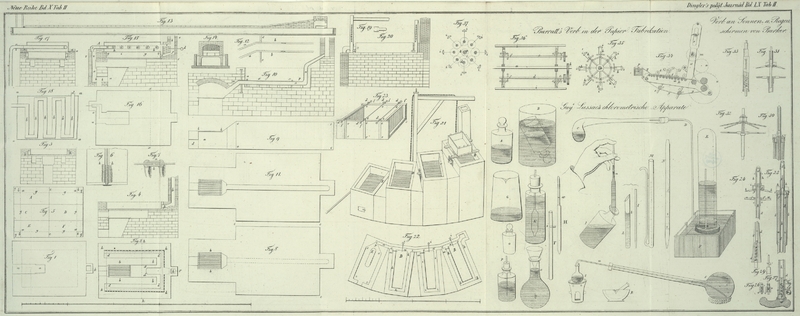| Titel: | Verbesserungen an den Regen- und Sonnenschirmen, worauf sich Joseph Barker, Gentleman von Southampton-Street, Camberwell, Grafschaft Surrey, am 25. März 1825 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXII., S. 95 |
| Download: | XML |
XXII.
Verbesserungen an den Regen- und
Sonnenschirmen, worauf sich Joseph
Barker, Gentleman von Southampton-Street, Camberwell, Grafschaft
Surrey, am 25. Maͤrz 1825 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Januar 1836, S.
271.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Barker's verbesserte Regen- und Sonnenschirme.
Der erste Zwek gegenwaͤrtiger Verbesserungen an den Regen- und
Sonnenschirmen besteht darin, daß ich innen die zum Ausspannen dienenden kleinen
Stangen beseitige, damit diese Vorrichtungen mehr Schuz gegen Regen und Sonne
gewaͤhren, als es gewoͤhnlich der Fall ist. Die zweite Aufgabe, die
ich mir sezte, war: das Oeffnen und Schließen der Schirme so zu bewerkstelligen, daß
es leichter und schneller geschehen kann, als gewoͤhnlich. Durch Beseitigung
der Spannstangen ist man im Stande die Schirme dichter an den Kopf zu bringen, ohne
daß man befuͤrchten muß, mit dem Hute oder der sonstigen Kopfbedekung
bestaͤndig gegen diese Stangen zu stoßen. Das Oeffnen oder Schließen meiner
Regen- und Sonnenschirme geschieht entweder mittelst einer Schraube, oder
durch eine Verbindung einer Schraube mit einem Schieber, oder durch eine Zahnstange
und ein Getrieb, welches in oder zunaͤchst an dem Griffe des Schirmes
angebracht ist, indem diese Apparate auf eine Stange oder eine Roͤhre wirken,
die sich von diesen Vorrichtungen aus innerhalb des Rohres oder der Roͤhre,
die den Stiel des Schirmes bildet, bis an das obere Ende empor erstrekt, und
daselbst mit einer Art von Hut, an welchem die Ausspanner befestigt sind, in
Verbindung steht. Die Schirme lassen sich auf diese Weise mit groͤßter
Leichtigkeit und Geschwindigkeit oͤffnen und schließen; und wenn sie
geschlossen sind, so werden die Staͤbchen gehindert wieder aus einander zu
treten, indem der Hut, an welchem die Ausspanner befestigt sind, uͤber die
Schultern, die an den metallenen Enden angebracht sind, schließt. Sollte man es
fuͤr noͤthig halten, so koͤnnten die Staͤbchen
uͤberdieß auch noch durch einen Ring, der sich uͤber den Hut und die Enden der Ausspanner
herab erstrekt, dicht an den Stiel des Regenschirmes gehalten werden.
Fig. 24 ist
ein Durchschnitt durch den Stiel und den Griff eines Schirmes, woraus man die
meisten zur Erlaͤuterung meiner Verbesserungen noͤthigen Theile
ersieht. Die Staͤbchen sind ausgespannt, oder in jener Stellung, die sie
haben, wenn der Schirm geoͤffnet worden ist. Fig. 25 zeigt einen
anderen aͤhnlichen Schirm, an welchem man die Staͤbchen
zusammengelegt, und zur Verhuͤtung ihres Auseinanderfallens durch den Hut und
einen Ring zuruͤkgehalten sieht, indem an dieser Art von Schirmen der
gewoͤhnliche Federhaken nicht anwendbar ist.
a, a sind die Fischbeinstaͤbchen; b, b die Ausspanner; c ist
der Haken des Griffes, und d, d der hohle Stiel. Die
Fischbeinstaͤbchen sind an dem Rade oder an dem ausgekerbten Kranze e, welcher sich an dem oberen Ende befindet, mittelst
eines Drahtes befestigt, der durch Loͤcher gezogen ist, welche an den Enden
der Staͤbchen in den metallenen Spizen oder Stiefeln f, f angebracht sind, gleichwie dieß an den gewoͤhnlichen Schirmen
der Fall ist. Der Kranz e ist auf solche Weise schief an
den Stiel d genietet, daß die Nieten, wenn man sich
solcher zur Befestigung bedient, dem Durchgange des Stabes durch den hohlen Stiel
durchaus nicht hinderlich sind.
Die Ausspanner b stehen an dem einen Ende mit den
Fischbeinstaͤbchen a in Verbindung,
waͤhrend sie an dem anderen Ende, welches gabelfoͤrmig oder anders
gebildet seyn kann, an dem Hute g, g festgemacht sind,
und zwar mittelst Draͤhten, welche durch Loͤcher in den
gabelfoͤrmigen oder oberen Enden der Ausspanner gezogen werden. Der Hut g ist an die Roͤhre h
geloͤthet, und diese schiebt sich frei an dem oberen Theile des Stieles; sie
fuͤhrt auch den Ring i, der spaͤter
beschrieben werden soll, und der sich eine kurze Streke entlang an der Roͤhre
h schieben laͤßt.
Der Ring i steht durch, einen starken Stift oder eine
Niete j mit dem inneren Stiele k in Verbindung. In dem oberen Theile des Stieles sind zwei lange Spalten
l, in der Roͤhre h hingegen zwei kurze Spalten oder Fenster angebracht, in denen sich der
Zapfen j auf und nieder bewegen kann, je nachdem der
Regenschirm geoͤffnet oder geschlossen wird. Das untere Ende des Stieles k ist fest mit Nieten oder auf andere Weise an der
Roͤhre m befestigt, in der sowohl die
Mutterschraube n, n, als auch die beiden Fuͤhrer
0,0, die man in Fig. 26 und 27 einzeln fuͤr
sich abgebildet sieht, festgemacht sind. Diese Fuͤhrer o, o bewegen sich in Falzen oder Rinnen, welche zu diesem Behufe in dem
unteren oder Griffstuͤke des Schirmstieles angebracht sind. q ist ein Halsring oder ein Aufhaͤlter, den man
in Fig. 28
abgebildet sieht, und der mit Nieten oder auf andere Weise an dem Ende des
Schirmstieles festgemacht ist. r ist die Spindel und s das Gewinde der maͤnnlichen Schraube, und diese
Spindel ist auf eine sichere Weise mit Nieten oder sonst anders an dem Haken c befestigt. An der Spindel r befindet sich auch der zweite Aufhaͤlter t, der in Fig. 29 einzeln abgebildet ist, mit Nieten festgemacht.
Der Zwek dieser Aufhaͤlter ist, zu verhuͤten, daß die Schraube beim
Oeffnen des Schirmes nicht eher zuruͤkwirken kann, als bis der Schirm
vollkommen ausgespannt ist. In lezterem Falle wird der Schirm dadurch offen
erhalten, daß die Schulter einer in dem Gewinde der Mutterschraube befindlichen
Auskerbung u in eine entsprechende, in dem Gewinde der
maͤnnlichen Schraube s befindliche Auskerbung v einfaͤllt, wie in Fig. 24 angedeutet ist.
Das Stuͤk q haͤlt, indem es an dem Stiele
befestigt ist, den Druk, den der Schirm, wenn er ausgespannt ist, nach Abwarts
ausuͤbt, auf; und die Schulter w der
Schraubenspindel r verhindert, indem sie sich gegen den
Bodentheil bewegt, daß die maͤnnliche Schraube nicht weiter in den Stiel
gezogen wird, als noͤthig ist, damit die beiden Stuͤke q und t beim Umdrehen der
maͤnnlichen Schraube an einander voruͤbergehen koͤnnen.
Nach Vorausschikung der Beschreibung der einzelnen Theile will ich nunmehr versuchen
zu zeigen, wie dieselben beim Oeffnen und Schließen der Schirme arbeiten. Wenn der
Schirm geschlossen ist, so haben sich die inneren schief abgedachten Seiten des
Hutes g uͤber den schiefen Enden der Stiefel oder
Spizen f, wie Fig. 25 zeigt,
geschlossen, und dadurch sind die Fischbeinstaͤbchen gehindert aus einander
zu fallen. Zu noch groͤßerer Sicherheit ist auch noch der Ring i angebracht, der uͤber den Hut g und uͤber die Enden der Ausspanner b herabgezogen ist und das Ganze in dieser Stellung
erhaͤlt. Will man den Schirm ausspannen, so dreht man den Griff c nach Rechts herum, wo sich dann die Spindel r, die maͤnnliche Schraube s und der Aufhaͤlter t gleichfalls
umdrehen werden, so daß die maͤnnliche Schraube auf die Mutterschraube n wirkt, und dieselbe zwingt zugleich mit dem inneren
Stiele k emporzusteigen, indem die Mutterschraube n durch die Fuͤhrer o
und die Falzen oder Furchen p verhindert ist sich
umzudrehen. Der Stiel k fuͤhrt hiebei, indem er
emporsteigt, zuerst den Ring i mit sich; und sobald
dieser uͤber die Enden der Ausspanner bis in jene Stellung emporgelangt ist,
welche man in Fig.
25 durch Punkte angedeutet sieht, wird sich der Zapfen oder die Niete in
der furzen Spalte der Roͤhre h so weit empor
bewegt haben, daß die
Fischbeinstaͤbchen ausgespannt werden koͤnnen. Dieß Leztere geschieht,
indem man den Stiel k noch weiter emporhebt, und damit
auch den Ring i, die Roͤhre h und den Hut g empor
bewegt, so daß lezterer die Ausspanner aufzieht, und dadurch die
Fischbeinstaͤbchen in die aus Fig. 24 ersichtliche
Stellung bringt. Sobald die Auskerbung u der Schraube
n mit der Auskerbung v
der Schraube s in Beruͤhrung kommt, wird der
Schirm hinreichend ausgespannt seyn, wo dann die Auskerbung die Ruͤkkehr der
Mutterschraube verhindert, so daß der Schirm folglich ausgespannt bleibt.
Will man hingegen den Schirm schließen, so dreht man den Griff nach entgegengesezter
Richtung, wo dann die beiden Auskerbungen u und v aus einander treten werden, und die Mutterschraube
leicht der Bewegung der maͤnnlichen Schraube folgen wird, indem sie durch die
Kraft des Schirmes und seines Ueberzuges niedergedruͤkt wird. Die an den
beiden Aufhaͤltern q und t befindlichen Auskerbungen werden an einander voruͤbergehen,
waͤhrend die maͤnnliche Schraube umgedreht wird. Durch weitere
Bewegung der maͤnnlichen Schraube wird endlich der Hut g und der Ring i in die aus Fig. 25 ersichtliche
Stellung herab gebracht.
Fig. 30 und
31 sind
Durchschnitte des oberen Theiles eines Schirmes, woran der Hut g und der Ring i etwas
modificirt sind. Fig. 30 zeigt die Theile in der Stellung, die sie haben, wenn der Schirm
geschlossen ist, waͤhrend man sie in Fig. 31 in ausgespanntem
Zustande ersieht. Hier endet sich der Stiel des Schirmes an der oberen Seite des
oberen Kranzes e, und sowohl der Hut g als die Roͤhre h
sind so aufgezogen, daß sie sich an dem inneren Stiele k
anstatt an dem Schirmstoke schieben, wie dieß bei der ersten Art von Regenschirmen
der Fall war. Der Hut i ist an einem Stuͤke Rohr
oder an einer Roͤhre befestigt, welche dem Stoke gleich ist, und welche
mittelst einer Niete eine kurze Streke ober dem Hute g
an dem inneren Stiele k befestigt ist.
Ist ein Regenschirm dieser Art geschlossen, so befinden sich die einzelnen Theile in
der aus Fig.
30 ersichtlichen Stellung; dreht man hingegen die maͤnnliche
Schraube um, so daß der innere Stiel k emporsteigt, so
wird zuerst der Ring i mit dem oberen Theile des Stieles
emporgehoben werden; und sobald der Ring i von den
Fischbeinstaͤbchen und Ausspannern frei geworden ist, wird der Grund der
kurzen in dem Stiele k befindlichen Spalte mit der Niete
j in Beruͤhrung kommen, wo dann der Hut g emporgehoben und damit das Ausspannen der
Staͤbchen bewirkt werden wird. Dreht man den Griff nach entgegengesezter
Richtung, so wird der Schirm dagegen auf dieselbe Weise, auf welche dieß fruͤher
angedeutet wurde, geschlossen werden.
Fig. 32 zeigt
den oberen Theil eines Schirmes, woran eine andere Modification der
Patentvorrichtung angebracht ist, von Außen. Hier sind naͤmlich die
Ausspanner nicht an dem Hute g, wie dieß bei den
fruͤheren Vorrichtungen der Fall war, sondern an einem verschiebbaren Ringe
x befestigt, der sich außer dem Ringe i befindet. Der Ring i ist,
wenn der Schirm geschlossen ist, uͤber die Enden der
Fischbeinstaͤbchen herabgezogen; so wie hingegen der Stiel k emporgehoben wird, steigt auch der Ring i empor, so daß die Staͤbchen frei werden, und
bei weiterem Emporsteigen des Ringes, wobei die an dem hohlen Theile des Ringes
befindliche Randleiste den Ring x aufnimmt, ausgespannt
werden koͤnnen, wie man sie in Fig. 9 ersieht. Zieht man
den Stiel hingegen herab, so tritt die entgegengesezte Bewegung ein.
Fig. 33 zeigt
eine Vorrichtung, an der die zum Heben und Senken des Stieles k dienende Bewegung durch Verbindung der Schieber- mit der
Schraubenbewegung hervorgebracht wird. Hier In diesem Falle fuͤhrt der innere
Stiel k die eine der Schrauben n, waͤhrend die andere s mit dem oberen
Ende der Spindel r, die in dem Griffe festgemacht ist,
in Verbindung steht. Fig. 33 zeigt die Theile
in der Stellung, die sie haben, wenn der Schirm geoͤffnet ist. d ist der Stiel des Schirmes, an dessen unterem Ende
eine Roͤhre befestigt ist. y ist eine
Roͤhre, die einen Theil des Griffes ausmacht, und die je nach dem Geschmake
des Fabrikanten auf irgend eine beliebige Art und Weise uͤberzogen werden
kann. q ist der Aufhaͤlter fuͤr die
Schrauben, welche hier in diesem Falle keiner Auskerbungen beduͤrfen. z ist eine Art von Bajonnetbefestigung, die dadurch
gebildet wird, daß sich ein Zapfen, welcher an dem Ende des Stieles d aus der Roͤhre hervorragt, in einer in der
Roͤhre y angebrachten Spalte bewegt. Will man
diesen Schirm ausspannen, so haͤlt man dessen Stiel mit der einen Hand, und
dreht die Roͤhre y etwas weniges nach Links, so
daß der Zapfen aus der an dem oberen Ende der Spalte befindlichen Auskerbung frei
gemacht wird; dann erst bewegt man die Roͤhre oder den Griff y nach Aufwaͤrts, wodurch der Ring i entfernt und der Schirm zum Theil geoͤffnet
wird. Ist der Zapfen am Grunde der Spalte z angelangt,
so wird der Haken des Griffes nach Rechts umgedreht, wo dann die Schrauben in
Thaͤtigkeit kommen werden, und wo dann der Schirm vollkommen ausgespannt ist,
sobald die Auskerbungen u und v mit einander in Beruͤhrung kommen, wie dieß in der Zeichnung
angedeutet ist. Um diese Zeit befindet sich der Zapfen in der Auskerbung am unteren
Ende der Spalte z. Die Schraube n wird durch
Fuͤhrer, die in Fugen, welche sich in der Roͤhre y befinden, auf- und niedersteigen, sich
umzudrehen verhindert.Wir muͤssen hier bemerken, daß in den Originalabbildungen sowohl an
dieser Fig.
33, als an einigen der vorhergehenden Figuren mehrere der
einzelnen Theile nicht mit den entsprechenden Buchstaben bezeichnet
sind.A. d. R.
Fuͤr den Arbeiter bemerke ich, daß ich die Ausspanner an dem in den Hut
eingesezten Ende gabelfoͤrmig bilde, um den Fischbeinstaͤbchen mehr
Staͤtigkeit zu geben. Die Ausspanner koͤnnen fuͤr Sonnenschirme
2 bis 6 und fuͤr Regenschirme 6 bis 11 Zoll Laͤnge haben; sind sie
sehr kurz, so muß man die Fischbeinstaͤbchen an der einen Seite des unteren
Dritthelles etwas verduͤnnen. Bringt man einen Ring in Anwendung, so ist es
besser, wenn man den Schirmen gleich den gewoͤhnlichen Sonnenschirmen eine
Woͤlbung gibt; bedient man sich hingegen keines Ringes, so kann der Ueberzug
wie an den gewoͤhnlichen Regenschirmen angebracht und am Scheitel mit einer
ausgebauchten oder glokenfoͤrmigen Zwinge, welche mit schiefen Nieten oder
einer Schraube in der Roͤhre h befestigt wird,
bedekt werden.
Beim Zusammensezen der Schirme hat man zu beruͤksichtigen, daß, indem sich der
Aufhaͤlter q zwischen dem Aufhaͤlter t und der Schulter w frei an
der Spindel r zu bewegen hat, die Nieten, womit der
Aufhaͤlter q in dem Stiele befestigt wird,
fruͤher eingetrieben werden muͤssen, als der Haken c eingesezt wird. Wenn der Aufhaͤlter q zu wenig Substanz darbietet, als daß Loͤcher in
denselben gebohrt werden koͤnnten, genuͤgt es an beiden Seiten
Auskerbungen von solcher Tiefe anzubringen, daß die Nieten darin liegen
koͤnnen. Die Schraube kann aus Messing, Eisen, Stahl oder irgend einem
anderen dauerhaften Materiale verfertigt werden. Die Aufhaͤlter bestehen am
besten aus Eisen oder Stahl, in dem sie sich sonst zu leicht ausnuͤzen.
Verfertigt man die Griffe aus Elfenbein, so ist es gut, wenn man das dem Haken c zunaͤchst gelegene Ende mit einem Hute zum
Anschrauben versieht, damit dieser Hut die Enden der Furchen oder Falzen
schuͤzt, in welchen sich die Fuͤhrer zu bewegen haben. Dieser Hut wird
vor dem Haken c angesezt. Der innere Stiel kann entweder
aus einem duͤnnen Roͤhre oder aus Holz oder auch aus einer
duͤnnen Roͤhre verfertigt werden.
Ich habe hier der groͤßeren Deutlichkeit wegen mancherlei Modificationen
beschrieben, muß aber dennoch bemerken, daß ich mich auf leine bestimmte Form der
einzelnen Theile beschranke, in dem diese mannigfach abgeaͤndert werden kann.
Auch erklaͤre ich, daß ich weder das Anbringen der Ausspanner an der
Außenseite oder uͤber den Staͤbchen, noch irgend eine andere bereits
schon fruͤher bekannt gewesene Vorrichtung als meine Erfindung in Anspruch
nehme.
Tafeln