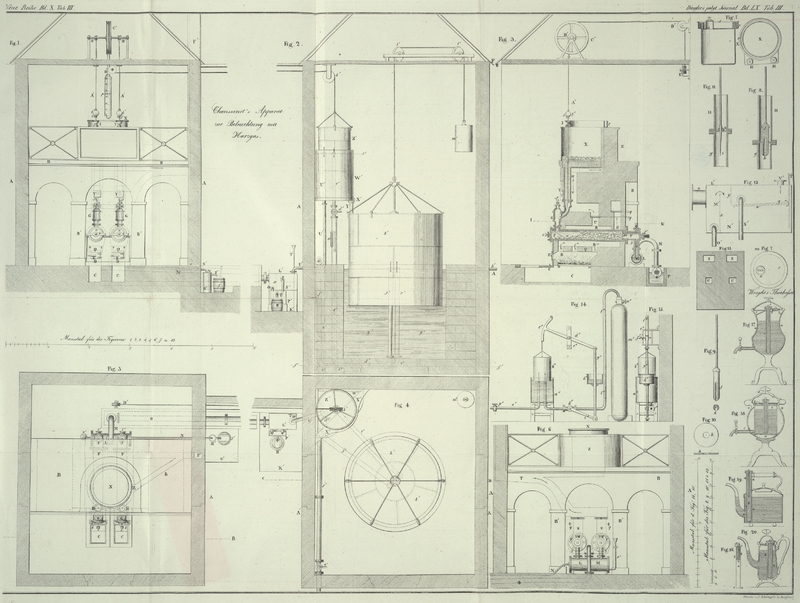| Titel: | Beschreibung eines Apparates zur Beleuchtung mit Harzgas, welchen Hr. H. B. Chaussenot in der Baumwollspinnerei der HH. Titot, Chastellux und Comp. in Haguenau errichtete. |
| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXIV., S. 102 |
| Download: | XML |
XXIV.
Beschreibung eines Apparates zur Beleuchtung mit
Harzgas, welchen Hr. H. B.
Chaussenot in der Baumwollspinnerei der HH. Titot, Chastellux und Comp. in Haguenau
errichtete.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement, September 1835, S. 438.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Chaussenot's Apparat zur Beleuchtung mit Harzgas.
Die Gewinnung von Leuchtgas aus dem Harze war jederzeit mit großen Schwierigkeiten
verbunden; die schlagendsten Beweise hiefuͤr liegen in den vielen
unfruchtbaren Versuchen, welche zu deren endlicher Beseitigung angestellt
wurden.
Die Hindernisse, welche hauptsaͤchlich im Wege standen, und welche
uͤberwunden werden mußten, lagen 1) darin, daß das Harz durch eine
vorlaͤufige Operation und vor dessen Einfuͤhrung in die Apparate
verfluͤssigt werden sollte, und daß man dachte, diese Verfluͤssigung
muͤsse durch Vermengung des Harzes mit Fluͤssigkeiten, die dasselbe
aufzuloͤsen im Stande sind, wie z.B. mit Terpenthingeist oder Alkohol,Wir verweisen in dieser Hinsicht auf den Apparat des Hrn. Daniell, der das Harz mit Terpenthinoͤhl
in fluͤssigen Zustand verwandeln wollte; man findet eine Beschreibung
dieses Apparates im Polytechnischen Journal Bd. XXXIII. S. 41. Eben so erinnern
wir an die im LIII. Bd. S. 200 unseres Journales beschriebene Methode
Harzgas zu erzeugen, wofuͤr die Société d'Encouragement dem Hrn. Danré im Jahre 1834 ihre silberne Medaille
ertheilte.A. d. R. oder auch dadurch geschehen, daß man das Harz durch Destillation in ein Oehl
verwandelt. 2) darin, daß das Harz, wenn man es in festem Zustande anwendete, d.h.
wenn es nur durch die Wirkung der Waͤrme allein in fluͤssigen Zustand
verwandelt worden ist, nur mit großer Schwierigkeit auf eine ununterbrochene und
regelmaͤßige Weise in die zur Zersezung dienenden Gefaͤße eingetragen
werden koͤnnte. 3) in der großen Feuergefaͤhrlichkeit, welche alle
diese Manipulationen darboten, wenn sie nicht mit gehoͤriger Vorsicht oder
von ungeuͤbten Individuen unternommen wurden. 4) endlich in dem bedeutenden
Preise der verschiedenen, sehr complicirten, schwer zu leitenden und schwer zu unterhaltenden Apparate,
welche zu dem fraglichen Zweke in Vorschlag gebracht worden sind.
Allen diesen Schwierigkeiten hat Hr. H. B. Chaussenot
durch den Apparat abgeholfen, auf den er im Jahre 1829 ein Patent erhielt. Das Harz
erfordert hier keine vorlaͤufige Behandlung, sondern wird in rohem Zustande
in ein zur Schmelzung dienendes Gefaͤß eingetragen, in welchem es sich in
solchem Grade verfluͤssigt, daß es in die Retorten abfließen kann. Dieses
Abfließen findet ununterbrochen waͤhrend der ganzen Dauer der Operation und
so lange Gas erzeugt werden soll, auf regelmaͤßige Weise Statt. Auch
laͤßt sich an diesem Apparate mittelst eines graduirten und eigens zu diesem
Behufe eingerichteten Regulirhahnes die Quantitaͤt des innerhalb einer
bestimmten Zeit erzeugten Gases nach Belieben abaͤndern.
Die ersten Versuche des Hrn. Chaussenot erstreken sich bis
zu dem Jahre 1825 zuruͤk. Im Jahre 1826 ließ er einen Apparat erbauen, in
welchem aus Harz, welches in festem Zustande angewendet war, Gas erzeugt wurde. Das
naͤchste Jahr darauf stellte er oͤffentlich in Paris mehrere Versuche
an, die die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogen, und denen mehrere
ausgezeichnete Gelehrte der Hauptstadt beiwohnten. Am 20. Maͤrz 1828 wurden
die Fronte und einige Saͤle des Stadthauses von Dijon mit Harzgas beleuchtet,
welches ein sehr reines und sehr lebhaftes Licht gab. Am 7. Mai hoͤrte die
Akademie in Dijon einen sehr guͤnstigen Bericht uͤber diese
Beleuchtungsmethode an, indem sich deren Vortheile sowohl in Hinsicht auf den
Verbrauch an Brennmaterial, als in Hinsicht auf die Menge Gas, die eine bestimmte
Quantitaͤt Harz lieferte, als endlich in Hinsicht auf die Intensitaͤt
des Lichtes bewahrten. Der in Dijon angewendete Apparat war nicht mehr vollkommen
derselbe, dessen man sich bei den in Paris angestellten Versuchen bedient
haͤtte; der Erfinder haͤtte vielmehr in der Absicht dessen Anwendung
zu erleichtern und um zu besseren Resultaten dabei zu gelangen, mannigfache, mehr
oder minder wichtige Modificationen daran angebracht. Ohne Unterlaß seinen Zwek
verfolgend, unternahm Hr. Chaussenot endlich den Bau
eines von dem fruͤheren gaͤnzlich verschiedenen Apparates, der allen
Erfordernissen auf sehr genuͤgende Weise entsprach.
Dieser leztere im Jahre 1830 erbaute Apparat befindet sich in der Spinnerei der HH.
Titot und Chastellux in
Haguenau, und aus einem von den Eigenthuͤmern ausgestellten Zeugnisse geht
hervor: 1) daß der Apparat ununterbrochen und gut arbeitet, und sowohl in Hinsicht
auf die Schoͤnheit des Lichtes, als auf die Abwesenheit von Geruch und Rauch
bei der Verbrennung, und auf die Leichtigkeit, womit sich saͤmmtliche
Operationen verrichten lassen, vollkommen Genuͤge leistet. 2) daß durch Entzuͤndung
des zur Gaserzeugung dienenden Brennstoffes keine Feuersgefahr entstehen
koͤnne. 3) daß das Harz in demselben in trokenem Zustande und ohne eine
vorlaͤufige Destillation oder irgend eine andere vorlaͤufige
Behandlung erlitten zu haben, in Anwendung gebracht, und direct in Retorten
eingetragen wird, und zwar mittelst eines etwas kegelartig geformten Stabes, der je
nachdem er mehr oder minder hoch emporgehoben wird, den Eintritt des geschmolzenen
Harzes in die Retorte regulirt. 4) daß sich der Apparat von selbst regulirt, und
zwar mittelst eines Regulators, der die Bewegung des Stabes in einer Scheidewand, in
welcher ein Loch von gehoͤriger Groͤße angebracht ist, bestimmt. 5)
daß der Apparat einfach und mit Leichtigkeit arbeitet. 6) daß man aus einem
Kilogramm Schiffspech (brai sec) bis an 14 1/4 Kubikfuß
Gas gewann, wobei der Druk des Gasometers 16 Linien Wasser betrug. 7) daß die
Gasleitungsroͤhren niemals verlegt wurden, und daß sich an den
Austrittsmuͤndungen der Gasschnabel nie fremdartige Substanzen zeigten. 8)
daß die unter der Erde gelegten, blechernen Gasleitungsroͤhren selbst nach
vierjaͤhrigem Dienste keine Veraͤnderungen erlitten. 9) endlich, daß
das Harzgas, wenn es unverbrannt entweicht, zwar einen schwachen Terpenthingeruch
verbreitet, waͤhrend des Verbrennens aber sich als vollkommen geruchlos
bewaͤhrt, und weder auf die Metalle, noch auf irgend andere Substanzen eine
nachtheilige Wirkung aͤußert.
Fig. 1 zeigt
einen Fronteaufriß des zur Beleuchtung mit Harzgas dienenden Apparates, und einen
Durchschnitt nach der Linie A, B des Grundrisses, Fig. 3, des
Pavillons, in welchem er angebracht ist.
Fig. 2 ist ein
Hauptaufriß des Gasometers und der dazu gehoͤrigen Theile, und ein
Durchschnitt des Behaͤlters nach der Linie CD des Grundrisses Fig. 4.
Fig. 3 gibt
einen Hauptgrundriß des Apparates nach dem Niveau der Linie E, F, Fig.
1 und 2.
Fig. 4 ist ein
Grundriß des Gasometers nach derselben Linie E, F.
Fig. 5 zeigt
einen senkrechten Laͤngendurchschnitt des Apparates und des Ofens nach der
Linie G, H,
Fig. 3.
Fig. 6 ist ein
Aufriß des Apparates vom Ruͤken her gesehen.
Fig. 7 zeigt
das Schmelzungsgefaͤß im Grundrisse und im Durchschnitte.
Fig. 8 ist ein
senkrechter Durchschnitt des Cylinders und des cylindrischen Stabes.
Fig. 9 gibt
einen Aufriß und Durchschnitt dieses Stabes.
Fig. 10 ist
ein Grundriß und ein Durchschnitt der im Inneren des Cylinders angebrachten
Scheibe.
Fig. 11 ist
ein senkrechter Durchschnitt eines Cylinders, durch den ein kegelfoͤrmiger
Stab laͤuft.
Fig. 12 zeigt
einen Aufriß des Reinigungsgefaͤßes in groͤßerem Maßstaͤbe
gezeichnet.
Fig. 13 gibt
einen Grundriß der Canaͤle, in denen der Rauch und die erhizte Luft in den
Ofen gelangen, nach der Linie I, K
Fig. 5.
Fig. 14 ist
ein Durchschnitt eines kleinen Apparates, der zur Regulirung des Abflusses des
comprimirten Gases dient. Denselben Apparat ersieht man in Fig. 15 in einem
seitlichen Aufrisse.
An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auf gleiche
Gegenstaͤnde.
AA ist der Pavillon, in welchem der Apparat
untergebracht ist. B eine Platform, welche von den
Pfeilern B'B', die drei Bogen bilden, getragen
wird. In dem mittleren dieser Bogen befindet sich das Gemaͤuer des Ofens, in
welchem die zur Zersezung dienenden Retorten enthalten sind; die beiden benachbarten
Bogen sind frei gelassen. Der vordere Theil dieser Platform ist mit einer
Brustlehne, die sich nach deren ganzer Laͤnge erstrekt, versehen.
C, C sind die in den Boden gegrabenen
Aschenloͤcher. Die an der vorderen Seite des Ofens befindlichen
Eingaͤnge zu denselben sind mit Rahmen aus Gußeisen versehen, in welchen sich
die Verschließer oder Sperrer C'', womit man den Zutritt
der Luft unter den Heerd reguliren, oder je nach Umstaͤnden auch
gaͤnzlich unterdruͤken kann, schieben. D,
D sind die Feuerheerde mit ihren Thuͤrchen E.
F, F sind die zur Zersezung dienenden Retorten, von
denen man in Fig.
5 die eine im Langendurchschnitte ersteht. Deren vorderer Theil ist mit
einem beweglichen Pfropfe a verschlossen, und dieser
wird mittelst eines Buͤgels b, dessen abgebogene
Arme sich gegen den kreisrunden Halsring der Retorten stemmen, festgehalten. In der
Mitte dieses Buͤgels befindet sich eine Drukschraube o, womit der Pfropf a niedergedruͤkt
und auf eine unabaͤnderliche Weise festgehalten werden kann. An dem oberen
Theile der Retorte unmittelbar hinter dem Halsringe befindet sich eine Tubulatur d, auf welche ein Cylinder G
gebolzt ist. Lezterer hat oben einen halbkugelfoͤrmigen Dekel, in dessen
Mittelpunkt sich eine Oeffnung befindet, die mittelst des Stuͤkes e verschlossen ist. Auf diesen Sperrer e druͤkt eine Schraube f, welche in einem nach Ruͤkwaͤrts gebogenen Zapfenbande
angebracht ist. Durch diese Oeffnung wird eine Eisenstange gefuͤhrt, und mit
dieser kann man die Tubulirung c offen erhalten, im
Falle sich in derselben kohlige Substanzen, die dem Durchgange des fluͤssig
gewordenen Harzes hinderlich wuͤrden, anhaͤufen sollten.
In die hintere Wand des Cylinders G muͤndet eine
gebogene Roͤhre g, welche durch ein
Randstuͤk mit einem senkrechten, in das zur Schmelzung dienende Gefaͤß
ausmuͤndenden Cylinder H in Verbindung steht.
Zwischen die beiden Randstuͤke ist eine kreisrunde Platte h, deren Durchmesser jenem dieser Stuͤke
gleichkommt, gelegt; diese Platte ist gegen die Mitte hin verdikt und mit einer
kleinen Oeffnung versehen, durch welche der aus Fig. 11 ersichtliche
kegelfoͤrmige Stab i geht. Das
kegelfoͤrmige Ende des Stabes i ist nach Unten 5
bis 6 Zoll weit verlaͤngert, und laͤßt in dem Maaße als es
emporsteigt, einen groͤßeren Raum um sich herum, so daß das Harz im directen
Verhaͤltnisse mit diesem Emporsteigen mehr oder minder schnell abfließt. Es
ist dabei zu bemerken, daß das in der Platte h
angebrachte Loch gleichfalls, jedoch in umgekehrter Richtung, kegelfoͤrmig
gebildet ist, wodurch nicht nur der Durchgang des Harzes erleichtert, sondern
zugleich auch verhuͤtet wird, daß sich keine festen Substanzen um die
Oeffnung herum ansammeln koͤnnen. Wenn sich der kegelfoͤrmige Stab i gegen die Raͤnder der Oeffnung stemmt, so ist
diese vollkommen geschlossen, und es kann daher kein Harz mehr abfließen: dieser
Fall tritt ein, wenn die Operation unterbrochen wird.
Es ist ferner auch ein aus Fig. 8 und 9 ersichtlicher,
cylindrischer Stab j in Anwendung gebracht, und dieser
fuͤhrt eine Stange, die durch das zur Schmelzung bestimmte Gefaͤß und
durch das kleine Naͤpfchen I, welches ihr als
Fuͤhrer dient, laͤuft. An der einen Seite des cylindrischen Stabes ist
ein der Laͤnge nach laufender Falz oder eine Rinne k angebracht, die sich nach Oben in Form eines hohlen Kegels verengert,
wie man dieß aus Fig. 8 und 9 ersieht. Der obere Theil
dieses cylindrischen Stabes endigt sich in einen halbkugelfoͤrmigen Scheitel
und dieser ist mit einem kegelfoͤrmigen Halsstuͤke ausgestattet,
welches, indem es sich gegen die Raͤnder der Oeffnung in der Platte stemmt,
diese Oeffnung genau verschließt, sobald der Stab hinlaͤnglich weit
herabgesenkt worden ist.
Der hintere Theil der Retorte endigt sich in einem Vorstoß mit zwei Tubulirungen l, l', von denen die eine senkrecht und die andere
horizontal angebracht ist, und welche beide auf aͤhnliche Weise wie die
Tubulirung a mit einem Pfropfe verschlossen sind. Durch
diese beiden Tubulirungen erhaͤlt man zum Behufe der Reinigung Zutritt zu dem
Boden der Retorte. Unter der senkrechten Tubulirung l
und ihr gegenuͤber befindet sich eine nach Abwarts steigende Roͤhre
J, und diese steht durch hervorragende
Randstuͤke mit der Roͤhre K, die in den
horizontalen cylinderfoͤrmigen Recipienten L
untertaucht, in Verbindung. Die mit dem Inneren dieses Cylinders communicirende Roͤhre M ist nicht wie die Roͤhre K verlaͤngert, sondern sie ist abgebogen, und an der oberen Wand
des Cylinders angesezt. Die beiden Enden des Cylinders sind mit kreisrunden, mit
Bolzen befestigten Platten verschlossen.
N ist eine Roͤhre, welche etwas uͤber der
Muͤndung der Roͤhre K in den einen der
Boden des Cylinders L eintritt, und welche sich bis
außerhalb des Gebaͤudes erstrekt. Das untere Ende der Roͤhre M paßt mit einem hervorstehenden Randstuͤke an
die Verdichtungsroͤhre O, die gleichfalls aus dem
Gebaͤude hinaus bis zu dem Reinigungsgefaͤße laͤuft. P ist ein langer, mit Wasser gefuͤllter Trog, und
in diesen taucht die Roͤhre O, welche nach
Abwaͤrts geneigt an das Reinigungsgefaͤß laͤuft, unter. Diese
Roͤhre ist an dem einen gegen den Reinigungsapparat hin gelegenen Ende in den
Verdichter gekittet; waͤhrend ihr anderes Ende frei gelassen ist; sie wird in
ihrer ganzen Laͤnge von eisernen Brazen getragen. Den Trog P ersieht man in Fig. 3 in seiner ganzen
Ausdehnung.
Das Innere der Retorte ist mit Ziegel- oder Kohksstuͤken
ausgefuͤllt; diese werden mittelst eines Rostes m
an der dem Heerde gegenuͤber liegenden Seite zuruͤkgehalten, damit die
Tubulirung J nicht verlegt werde, und das Gas frei
ausstroͤmen kann. Vorne an der Retorte und unmittelbar unter der Tubulirung
d ist ein Eisenblech n
mit aufgebogenen Raͤndern, welches mittelst einiger untergelegter Baksteine
in schief geneigter Stellung erhalten wird, angebracht.
o, o sind Oeffnungen, welche zum Behufs des Durchganges
der Flammen in dem Gewoͤlbe Q angebracht sind.
R ist ein kreisrunder, die Retorte F umgebender hohler Raum, mittelst welchem die
Waͤrme auf saͤmmtliche Punkte der Retorte gleichmaͤßig
vertheilt wird. S eine Oeffnung, durch die die Luft und
der Rauch entweichen kann, und welche mit dem Schieber p, der auch zur Regulirung des Zuges und der Hize des Heerdes dient, nach
Belieben abgesperrt werden kann. In Fig. 6 sieht man die
Schieber einer jeden der beiden Retorten, und unmittelbar oberhalb ist der Canal
fuͤr den Rauch der beiden Feuerstellen durch punktirte Linien angedeutet.
U ist ein Canal, der zur Leitung jener heißen Luft,
womit der zur Schmelzung dienende Behaͤlter erhizt werden soll, bestimmt ist.
Er ist mit einem Sperrer q versehen, womit er nach
Belieben in solchem Maaße abgesperrt werden kann, als es zum Behufs der Schmelzung
des Harzes erforderlich ist. In Fig. 6 sieht man die
beiden Ringe der Stangen dieser Sperrer q. Die Form der
Oeffnungen, welche fuͤr den Durchgang der Waͤrme und des Rauches bestimmt sind, ersieht
man aus dem Grundrisse Fig. 13, welcher nach der
Linie IK des Aufrisses Fig. 5 genommen ist.
V ist der unter das Schmelzgefaͤß X fuͤhrende Canal fuͤr warme Luft. Die
Luft wird gleichmaͤßig unter dem Boden dieses Gefaͤßes vertheilt,
indem eine Scheidewand aus Baksteinen, welche auf die Kante gelegt sind, so
angebracht ist, daß die heiße Luft bestaͤndig in die Mitte geleitet und dann
gezwungen wird, sich nach allen Seiten zu verbreiten, bevor sie in den Rauchfang
uͤbergeht. Der Zug und die Circulation sind um so lebhafter, je nachdem die
Sperrer q, q mehr oder weniger verschlossen sind. Der in
dem Canale V angebrachte Vertheilungscylinder H wird von allen Seiten erhizt, indem er von der Mauer
des Ofens getrennt ist. Der Canal hat keine Communication mit der zweiten Retorte,
die durch ein Gemaͤuer aus Baksteinen davon getrennt ist. In Fig. 1 ist die Einrichtung
und Anordnung dieser Canale durch punktirte Linien angedeutet.
Y sind Thuͤrchen mit Falzen, durch welche man, im
Falle die Temperatur den verlangten Grad uͤberstiege, kalte Luft eintreten
lassen kann. Je nachdem man diese Thuͤrchen mehr oder weniger weit
oͤffnet, lassen sich die Wirkungen der Waͤrme nach Belieben
abaͤndern.
Das Schmelzungsgefaͤß X ist mit einem
Ziegelgemaͤuer umgeben, durch welches dasselbe nicht nur fixirt wird, sondern
welches auch die an den Boden des Gefaͤßes gelangende Waͤrme
zusammenhaͤlt. Der obere und kreisrunde Rand dieses Gefaͤßes ist mit
einer Rinne r umgeben, in welcher Wasser enthalten ist,
und die zur Aufnahme der Raͤnder des Dekels s,
dessen hohler Boden mir Wasser angefuͤllt ist, dient. Diese hydraulische
Schließung ist in Fig. 7 ersichtlich. In der Nahe des einen der Raͤnder des Dekels
ist eine kreisrunde Oeffnung t angebracht, auf der sich
ein Kreis von gleichem Durchmesser befindet; lezterer ist seinerseits mit einem
Dekel u versehen, der mit einem Griffe oder Henkel
ausgestattet ist. Die Raͤnder dieses Dekels, welche bis zum Boden
herabsteigen, tauchen in das Wasser des großen Dekels unter, und verhindern allen
Austritt von Dampf. Die Daͤmpfe verdichten sich, so wie sie an diese Art von
Kuͤhlapparat anschlagen; und auf diese Weise wird die Entzuͤndung des
Harzes verhuͤtet, indem dieses, wenn es ein Mal durch die erwaͤhnte
Oeffnung in das Gefaͤß eingetragen worden ist, vollkommen gegen die
Beruͤhrung mit der aͤußeren atmosphaͤrischen Luft
geschuͤzt ist.
A'A' sind Metallstaͤbe, an denen eine
uͤber die Rolle B' laufende Kette befestigt ist.
An der Achse dieser Rolle ist eine zweite groͤßere Rolle C' aufgezogen, und um diese ist ein Riemen oder eine
Kette gespannt, die, nachdem sie uͤber die Rollen D' und E' gelaufen, an einem Eisendrahte festgemacht
ist, der die Bewegung bis zum Pavillon Fig. 2 fortpflanzt.
In Fig. 1 sieht
man bei F' den in der Dike der Mauer emporsteigenden
Rauchfang, uͤber welchem zur Bewerkstelligung eines guten Zuges eine
Roͤhre von gehoͤriger Laͤnge angebracht ist. Am Fuße dieser
Mauer und außen an dem Pavillon ist in den Boden eine ausgemauerte Grube gegraben,
in der ein Gefaͤß oder ein cylinderfoͤrmiger Recipient H' untergebracht ist. In diesen Recipienten, welcher bis
an die Ueberlaufroͤhre I' mit Wasser
gefuͤllt ist, taucht die Roͤhre N unter.
Die Roͤhre I' leitet die
uͤberschuͤssige Fluͤssigkeit in dem Maaße als sie durch die
Roͤhre N zustroͤmt, in das Faß J', welches nach Belieben entfernt werden kann.
Am Fuße jener Mauer des Pavillons Fig. 2, die der Mauer Fig. 1
gegenuͤber liegt, ist eine andere Grube K'
gegraben, die zur Aufnahme des Reinigungsgefaͤßes L' dient. Dieses Gefaͤß besteht aus einem laͤnglich
vierekigen Gehaͤuse, welches linker Hand mit einer Tubulirung v, die mit der Verdichtungsroͤhre O in Verbindung steht, ausgestattet ist. Das Innere
dieses Gehaͤuses ist durch zwei Scheidewaͤnde abgetheilt; die eine
derselben X, die in Fig. 12 durch punktirte
Linien angedeutet ist, ist mit ihrem unteren Rande solcher Maßen auf den Boden und
an die Waͤnde des Gehaͤuses geloͤthet, daß zwischen M' und N' kein anderer Raum
bleibt als jener, der sich zwischen dem oberen Rande der Scheidewand und dem Dekel
des Gehaͤuses befindet. Die zweite im rechten Winkel abgebogene Scheidewand
y ist an dem Dekel und an den Waͤnden
angeloͤthet; sie steigt zuerst senkrecht herab, biegt sich dann ab, und nimmt
eine schwach geneigte Richtung an. Der Raum, welcher sich zwischen dem horizontalen
Rande dieser Scheidewand und der seitlichen Wand des Gehaͤuses befindet,
dient zum Durchgange fuͤr die gasfoͤrmige Fluͤssigkeit. Der
Raum M' dient zur Aufnahme der in der Roͤhre O herbei gelangenden verdichteten Produkte; und diese
fließen in dem Maaße, als sie herbeistroͤmen, durch die Roͤhre O' ab, welche in das Gefaͤß P' untertaucht. Lezteres ist bis zur Hoͤhe der
Umlaufroͤhre Q' mit Wasser gefuͤllt, und
diese fuͤhrt ihrerseits das uͤberschuͤssige Wasser in das Faß
R'. Der Raum N ist bis
zur Hoͤhe der Linie z mit Wasser gefuͤllt;
eine Ueberlaufroͤhre S' taucht in das
Gefaͤß P' unter, welches die verdichteten und auf
der Oberflaͤche des Wassers gesammelten Producte aufnimmt. Unter der schief
geneigten Oberflaͤche der Scheidewand y sind in
kleinen Entfernungen von einander ekige Leisten a'
angebracht, die zur Bewirkung einer vollkommeneren Abwaschung des Gases bestimmt
sind. T' ist eine Roͤhre, welche bis in die
Naͤhe des Bodens des Gefaͤßes untertaucht, und die mit einem Trichter, durch welchen
das Wasser eingetragen wird, ausgestattet ist. Fig. 12 zeigt das zur
Reinigung dienende Gefaͤß, welches zur vollkommeneren Erlaͤuterung
seiner Einrichtung in groͤßerem Maaßstabe gezeichnet ist.
U' ist eine gekniete, auf der Tubulirung V' des Gefaͤßes L'
befestigte Roͤhre, die in das Innere des Pavillons Fig. 2 laͤuft, sich
abbiegt, und senkrecht in dem cylindrischen Behaͤlter W' emporsteigt, der von einem Tragsteine X'
getragen wird, welcher in die Mauer eingelassen ist, und auf einer kleinen
gußeisernen Saͤule Y' ruht. Z' ist ein Regulator oder ein kleiner Gasometer, der
nach Unten offen ist, und ohne dessen Raͤnder zu beruͤhren, in den
Behaͤlter W' untertaucht. Lezterer ist bis zur
Linie s' empor mit Wasser gefuͤllt. Der Gasometer
ist an einem vom Pavillon, Fig. 1,
herfuͤhrenden und uͤber die Rolle b'
laufenden Riemen oder an einer Kette aufgehaͤngt. Im Inneren des
Behaͤlters sind mit Punkten zwei Roͤhren angedeutet, von denen die
eine eine Verlaͤngerung der Roͤhre U' ist,
waͤhrend die andere mit der Roͤhre c' in
Verbindung steht. Zwischen den beiden Gefuͤgen dieser lezteren ist ein Hahn
d' angebracht, dessen Schluͤssel an seinem
oberen Theile mit einem Zeiger versehen ist, der auf einem Zifferblatts die Grade
der Oeffnung des Hahnes anzeigt.
Die Roͤhre c', die das Gas in den Gasometer
leitet, steigt bis zur Linie f' in ein Senkloch hinab,
und biegt sich dann ab, um in dem großen Behaͤlter g' bis uͤber das Wasser, womit lezterer gefuͤllt ist,
emporzusteigen. Der Stand des Wassers in lezterem Behaͤlter ist durch die
Ueberlaufroͤhre h' so regulirt, daß er sich immer
gleich bleibt. Durch einen unter dem Knie der Roͤhre c' angebrachten Hahn koͤnnen die fluͤssigen Theilchen, die
sich allenfalls daselbst ansammeln, und den Weg fuͤr das Gas versperren
koͤnnten, abfließen.
j' ist die Austrittsroͤhre fuͤr das Gas,
womit die Lampenschnaͤbel gespeist werden; sie ist gleich der vorhergehenden
eingerichtet und an ihrem unteren Theile mit einem Hahne versehen. k' ist ein Gasometer, der an einem uͤber die
Rollen l', l' laufenden Riemen aufgehaͤngt ist.
m' ist das Gegengewicht des Gasometers; n' der Manometer, der den Druk des Gases in dem
Gasometer andeutet. o' in Fig. 1 zeigt den Hahn, der
das Gas in die Lampenschnaͤbel vertheilt. p',
Fig. 1,
ist ein an der Mauer des Pavillons befestigter Maaßstab; dessen Zeiger befindet sich
an einer seidenen Schnur, die uͤber eine Rolle q'
laͤuft und sich um die große Rolle C' rollt.
Jedes Mal, so oft der Gasometer Z' emporsteigt oder
herabsinkt, folgt der Zeiger seiner Bewegung und deutet an dem Maaßstabe dessen Hoͤhe so wie jene
der kegelfoͤrmigen Staͤbe i an. Der Heizer
kann sich durch Beobachtung des Maaßstabes von dem Stande des Gasometers
uͤberzeugen.
Der Apparat arbeitet nun folgender Maßen. Man fuͤllt die Gefaͤße, die
zur Aufnahme von Wasser bestimmt sind, so wie die Behaͤlter W' und g' mit solchem,
bringt in die Retorten die Ziegel- und Kohkstruͤmmer, und schließt sie
genau. Dann stekt man auf dem Heerde, nachdem man vorlaͤufig die
Canaͤle S und U
geoͤffnet hat, ein Feuer an, welches man so lange mit Steinkohlen speist, bis
die Retorte auf die erforderliche Temperatur erhizt worden ist. Daß dieß der Fall
ist, erkennt man mittelst der kleinen Oeffnungen, die sich zu beiden Seiten der
Retorten befinden, und welche mit beweglichen Pfroͤpfen verschlossen werden.
Wenn die Retorten solcher Maßen erhizt worden sind, nimmt man von dem grob
gestoßenen Harze und traͤgt es in das Schmelzgefaͤß X ein, welches hierauf verschlossen wird; dafuͤr
oͤffnet man aber den Schieber q, so daß die heiße
Luft an die Oberflaͤche der Roͤhre H, so
wie an den Boden des Gefaͤßes X gelangen, und
diese so erhizen kann, daß das darin enthaltene Harz schnell in Fluß
geraͤth.
Der Cylinder H, durch welchen der Vertheilungs-
oder Speisungsstab geht und den man in Fig. 5 im Durchschnitte
sieht, fuͤllt sich in Kuͤrze mit fluͤssigem Harze, welches den
Austritt der im Inneren der Retorte erzeugten Daͤmpfe und Gase verhindert.
Dieser Stand der Dinge wird waͤhrend der ganzen Dauer der Destillation
unterhalten, und waͤhlt so lange fort, als in dem Gefaͤße Harz
enthalten ist.
Will man nun unter diesen Umstaͤnden den Apparat arbeiten lassen, so hebt man
mit der Hand die Stange A' des Speisers empor, wo dann
alsogleich ein Theil fluͤssigen Harzes durch den Cylinder G und die Tubulirung d
hindurch auf das schief geneigte Blech u faͤllt,
und sich daselbst unmittelbar in Dampf verwandelt, der dann durch die
gluͤhenden Ziegel- und Kohksstuͤke zieht, und sich dadurch in
Gas verwandelt. Das Blech n dient zur Verhuͤtung
der Abkuͤhlung der Retorte und der Inkrustationen, welche sonst
gewoͤhnlich Statt finden. Das Gas steigt, nachdem es durch die Retorte
gezogen ist, in der Roͤhre J in den Cylinder L herab, den man mittelst der kleinen und mit einem
Trichter versehenen Roͤhre r' mit Wasser
fuͤllt. Die Roͤhre K, welche einige Linien
tief in dieses Wasser untertaucht, verhuͤtet die Ruͤkkehr des Gases in
die Retorte, wenn diese zum Behufe der Erneuerung der Kohks geoͤffnet werden
muß. Die schwersten Theile des Dampfes verdichten sich, und fließen, wenn sie bis uͤber das
Niveau der Roͤhre N gestiegen sind, durch diese
Roͤhre in das Gefaͤß H' und dann in das
Faß J' ab, welches man wegnimmt, wenn es sich
gefuͤllt hat.
Das auf diese Weise gereinigte Gas, welches den uͤber dem Wasser befindlichen
Raum einnimmt, gelangt in die Roͤhre M, die in
den mit kaltem Wasser gefuͤllten Trog P
untergetaucht ist, und tritt, nachdem es an deren Ende angelangt ist, in das zur
Reinigung bestimmte Gefaͤß L'. Der
fluͤssige Theil, der sich auf diesem Wege aus dem Gase abschied,
faͤllt in den Raum M', und fließt durch die
Roͤhre O' in den Behaͤlter P', und aus diesem in das Faß R'. Zu gleicher Zeit stroͤmt das Gas uͤber die Scheidewand
x weg und unter der Scheidewand y durch, wo es sich von den lezten Dampftheilchen, die
allenfalls der Verdichtung im kalten Wasser entgangen sind, entledigt. Ueber dem
Niveau der Linie z angelangt, tritt es endlich durch die
Roͤhre U' und durch den Recipienten W' stroͤmend in das Innere des zur Regulirung
dienenden Gasometers Z'. Wenn der Hahn d' geschlossen ist, so bringt der Druk des Gases den
Gasometer Z' zum Emporsteigen; und ist dieser am dritten
Theile seiner Hoͤhe angelangt, so befestigt man die Stange des Stabes oder
Speisers i an der Stange A',
was mittelst einer Dille geschieht, die mit einer Drukschraube s' und mir einer Kugel t'
versehen ist. Die Laͤnge der Stangen und der Ketten muß so berechnet seyn,
daß der Speiser in dieser Stellung so weit emporgehoben ist, daß eine geringe
Quantitaͤt Harz in die Retorte fließen kann. Oeffnet man hierauf den
Regulirhahn d', so stroͤmt das Gas aus dem
Gasometer Z' unmittelbar in den Gasometer k', und zwar mit einer der Oeffnung dieses Hahnes
entsprechenden Geschwindigkeit. Diese Oeffnung richtet sich je nach der
Quantitaͤt Gas, die man innerhalb einer bestimmten Zeit erzeugen will. Der
Uebergang des Gases aus dem Gasometer Z' in den
Gasometer k' wird durch die Verschiedenheit des Drukes,
der in ersterem groͤßer ist, bewerkstelligt. Waͤhrend der Regulator
Z' herabsinkt, zieht er den um die Rolle C' gewundenen Riemen oder die Kette mit sich, und durch
diese Bewegung steigt die Stange A' so wie der Speiser
i empor, so daß das Harz abfließen kann. Dieser
Abfluß sieht mit der Erhebung der Stange im Verhaͤltnisse, und diese ist
durch die Geschwindigkeit, mit der das Gas aus dem Gasometer Z' in den Gasometer k' uͤbergeht,
bedingt. Ist hingegen ein Ueberschuß von Gas vorhanden, so tritt das Entgegengesezte
ein; d.h. der Gasometer Z' steigt noch hoͤher
empor, und die mit Gegengewichten versehenen Speiser i
sinken so weit herab, daß der Abfluß des Harzes dadurch beeintraͤchtigt wird,
und daß demnach eine geringere Menge Harz in die Retorte fließt. Bei dem gewoͤhnlichen Gange
des Apparates sieht die Gaserzeugung immer mit der verbrauchten Quantitaͤt
Gas im Verhaͤltnisse.
Will man die Operation beendigen, so schraubt man die an der Dille des Gegengewichtes
t' befindliche Drukschraube s' los, wo dann der seiner eigenen Schwere uͤberlassene Speiser i auf die Platte h
herabsinkt, und die zum Abfluͤsse des Harzes bestimmte Oeffnung verschließt.
Man kann auf dieselbe Weise auch nur einen der Speiser arbeiten lassen, wenn man nur
die eine der beiden Retorten speisen will.
Der hier beschriebene Apparat kann zur Speisung einer beliebigen Anzahl von
Gasschnaͤbeln eingerichtet werden; man braucht naͤmlich zu diesem
Behufe nur die Zahl der Retorten zu vermehren. Er bietet uͤbrigens sowohl in
Hinsicht auf Anschaffungskosten, als in Hinsicht auf Leichtigkeit des Dienstes, in
Hinsicht auf den kleinen Raum, den er einnimmt, und die Beseitigung von aller
Feuersgefahr im Vergleiche mit allen anderen Apparaten große Vortheile dar. Ist er
ein Mal in Thaͤtigkeit gesezt, so speist er sich selbst mit jener
Quantitaͤt Harz, welche zur Erzeugung eines einer gewissen Anzahl von
Gasschnaͤbeln entsprechenden Volumens Gas erforderlich ist.
Der Apparat des Hrn. Chaussenot dient uͤbrigens
nicht bloß zur Erzeugung von Gas aus Harz, welches in festem Zustande angewendet
wird; sondern man kann mit demselben auch aus allen anderen wasserstoffhaltigen und
in fluͤssigen Zustand verwandelbaren Substanzen, wie z. V. aus den
vegetabilischen Fetten und Oehlen, Leuchtgas gewinnen. Alle die hier beschriebenen
Vorrichtungen finden saͤmmtlich auch auf die Gasgewinnung aus diesen Stoffen
Anwendung.
Fig. 14 zeigt
einen Durchschnitt und Fig. 15 einen Endaufriß
eines kleinen Apparates, der zur Regulirung des Austrittes von tragbarem
comprimirtem Gase dient. Er wurde im Jahre 1828 der Akademie in Dijon vorgelegt, die
seine Vorzuͤge anerkannte. An den gewoͤhnlichen Compressionsapparaten
nimmt die Spannung des Gases in dem Maaße seines Verbrauches ab. Die Geschwindigkeit
seines Ausstroͤmens wuͤrde in demselben Maaße abnehmen, und das licht
eben so schwacher werden, wenn die Oeffnung des Speisungshahnes nicht von Zeit zu
Zeit vergroͤßert wuͤrde. Dieses nothwendig unvollkommene
Huͤlfsmittel zieht den Verlust des einen der Hauptvorzuͤge der
Gasbeleuchtung: naͤmlich der gleichen Intensitaͤt des Lichtes nach
sich.
Der kleine Apparat des Hrn. Chaussenot hilft allen diesen
Mangeln ab, und ist um so schaͤzenswerther, als er sich, wenn er ein Mal in
Thaͤtigkeit gesezt ist, selbst regulirt und keiner Beaufsichtung bedarf. Er besteht aus einem
cylindrischen Behaͤlter a'' von 33 Centim. im
Durchmesser, welcher oben offen und mit Wasser gefuͤllt ist. In ihn taucht
eine Metallgloke b'' von kleinerem Durchmesser unter,
deren Raͤnder die Waͤnde des Behaͤlters a'' nicht beruͤhren. Diese Gloke ist mit einer Kette an einem
Kreissegmente c'' aufgehaͤngt, welches mit einem Balancier oder Schwengel d'', der sich frei an einem in dem Zapfenbande e'' befestigten Zapfen bewegt, aus einem Stuͤke
besteht. Die kleine Drukschraube f'' erhaͤlt den
Zapfen in diesem Zapfenbande. Mit diesem Balancier steht eine Kurbelstange g'' in Verbindung, und an dieser befindet sich ein
Naͤpfchen h'', welches als Gegengewicht dient,
und welches zu diesem Behufe mit Sand oder irgend einem anderen derlei Stoffe
beschwere wird. Die Kurbelstange steht mit einem Hebel. i'' in Zusammenhang; und dieser ist an der Achse eines Hahnes k'' aufgezogen, in welchem sich ein
kegelfoͤrmiges Loch befindet, welches nur 2 Linien im Durchmesser hat. Dieser
Hahn k'' geht durch die im Knie gebogene Roͤhre
I'', die mit dem einen Ende in den Boden des
Cylinders a'' eintritt, und bis uͤber das Niveau
des Wassers emporsteigt; waͤhrend das andere Ende mit dem Behaͤlter
m'', in welchem das comprimirte Gas enthalten ist,
in Verbindung steht, und mit einem Hahne n''
ausgestattet ist. Die Speisungsroͤhre o'' tritt
gleichfalls in den Behaͤlter a''; auch ist sie
mit einem Hahne p'' versehen.
Wenn der Apparat nicht in Thaͤtigkeit ist, so ist die Gloke b'' bis auf den Boden des Behaͤlters a'' herabgesunken, in welcher Stellung der Hahn k'' geoͤffnet und der Hahn p'' geschlossen ist. Das aus dem Compressionsbehaͤlter austretende
Gas kann dann frei durch die Roͤhre I'' unter die
Gloke eintreten, wenn man so vorsichtig war, den Hahn n'' zu oͤffnen. Hierauf steigt die Gloke alsogleich empor, wobei
das Gegengewicht h'' mithilft; und wenn sie auf dem
hoͤchsten Punkte angelangt ist, macht sie den Balancier d'', das Kurbelstuͤk und den Hebel i'' herabsinken, wodurch der Hahn k'' geschlossen wird, wie man in Fig. 14 ersieht. Oeffnet
man nunmehr den Hahn p'', so sinkt die Gloke herab, und
oͤffnet den Hahn k'' im Verhaͤltnisse der
Spannung des Gases in dem Behaͤlter m'' und im
Verhaͤltnisse der Quantitaͤt, die durch die Roͤhre o'' entweicht. Auf diese Weise bewirkt daher der
Apparat, so lange noch Gas in dem Behaͤlter m''
enthalten ist, ein gleichmaͤßiges Ausstroͤmen desselben, so daß den
Lampenschnaͤbeln immer eine und dieselbe Quantitaͤt Gas zufließt, und
waͤhrend der ganzen Dauer der Verbrennung immer eine gleiche
Intensitaͤt des Lichtes erhalten wird.
Tafeln