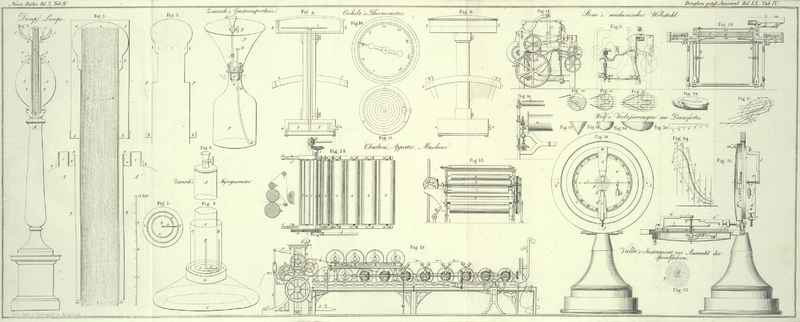| Titel: | Die Dampflampe; von Dr. F. Luedersdorff. |
| Autor: | F. Luedersdorff |
| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXXI., S. 166 |
| Download: | XML |
XXXI.
Die Dampflampe; von Dr. F. Luedersdorff.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Luedersdorff's Dampflampe.
Nachdem ein Zeitraum von zwei Jahren als Kriterium diese Erfindung bewahrt hat, und
die Dampflampe bereits zu den nothwendigen Requisiten unserer eleganten Salons
gehoͤrt, kann ich mit der allgemeinen Veroͤffentlichung derselben ihre
Empfehlung verbinden. Ich waͤhle hiezu das vorliegende Journal, ein Mal, weil
es das gelesenste ist, und zweitens, weil es durch seine zahlreichen Kupfertafeln
erlaubt der Beschreibung eine genaue Zeichnung beizufuͤgen, was fuͤr
alle mechanischen Vorrichtungen die unerlaͤßlichste Bedingung ist. Ich benuze
diese Gelegenheit außerdem noch um so lieber, als ich die Beschreibung meiner Lampe
als Correctur fuͤr alle diejenigen aufstellen kann, welche, ungeachtet ich
die Einrichtung derselben oͤffentlich erklaͤrt habe, mangelhaft
angefertigt worden sind, und woran hauptsaͤchlich der Umstand schuld ist,
daß, obschon die Principien der Dampflampe von den Principien der Oehllampen ganz
verschieden sind, die bezuͤglichen Fabrikanten dennoch glaubten, weil der
Apparat „Lampe“ heißt, ihrem eigenen
Ermessen folgen zu koͤnnen.
Die Erfahrung also, daß die Flamme eines Gemisches von Weingeist und
Terpenthinoͤhl, oder irgend eines anderen kohlenstoffreichen und moͤglichst fluͤchtigen
aͤtherischen Oehles, leuchtend ist, veranlaßte
mich zunaͤchst zur Construction einer hierauf basirten Lampe. Da sich nun
aber das Verbrennen eines solchen Gemisches gerade zu sehr schwierig zeigte, und es
schwer zu einem ruhigen Brennen zu bringen war, so kam ich auf die Idee, den
entzuͤndeten Daͤmpfen dieses Gemisches das
Leuchten zu uͤbertragen, und so entstand die Dampflampe. Die Aufgabe derselben war demnach nicht allein jene
Daͤmpfe zu verbrennen, sondern auch zu entwikeln,
und dabei kam es darauf an, daß dieß in einem bequemen, jeder Handhabung
faͤhigen Apparat geschehe.
Die erste Lampe dieser Art haͤtte ich so eingerichtet, daß die Erzeugung der
Daͤmpfe durch eine besondere, erhizende Spirituslampe bewirkt wurde:
natuͤrlich war diese Lampe In der Lampe unbequem; ich war daher darauf
bedacht die eine entbehrlich zu machen und die leuchtende Flamme gleichzeitig auch
als erhizende zu benuzen. Bei der leichten Verdampfbarkeit des Spiritus hielt dieß
nicht schwer, und so kam ich bald auf eine Construction, durch welche sich diese
Lampe zu der zierlichsten und dabei einfachsten Leuchte umbilden ließ.
Ich uͤbergehe die Beschreibung der ersteren Art dieser Lampen, denn ungeachtet
auch sie ihre Vorzuͤge haben, so werden diese doch durch viele
Unbequemlichkeiten zu sehr belastet, als daß ich dieselben empfehlen sollte. Ich
wende mich daher gleich zu den lezteren, und kann hier in Eroͤrterung der
Principien um so kuͤrzer seyn, als ich bereits in den Nr. 298 und 299 (1834)
und Nr. 38 (1835) der Haude- und Spener'schen Zeitung die Sache besprochen habe.
Es kam also bei Construction einer Lampe, welche sich durch eigene Waͤrme die
benoͤthigten Daͤmpfe schafft, darauf an, diejenige Waͤrme,
welche von der leuchtenden Flamme ausstrahlt, zu absorbiren, und durch ein leitendes
Medium einer abgesonderten und proportionalen Menge des Leuchtspiritus
zuzufuͤhren. Natuͤrlich durfte die leuchtende Flamme hiedurch nicht im
Geringsten incommodirt werden, und daher war vor allen Dingen eine unmittelbare
Beruͤhrung der Flamme mit dem zu erhizenden Gegenstand zu vermeiden. Es stand
mir also einzig und allein die von der Flamme ausstrahlende Waͤrme zu Gebote, nach deren Intensitaͤt
diejenige Menge des Leuchtspiritus zu berechnen war, welche durch jene Waͤrme
verdampft werden koͤnnte. Wie sich dieß bewerkstelligen ließ, wird durch die
nachfolgende Beschreibung der Lampe selbst am leichtesten erklaͤrlich
seyn.
A, AFig. 1 ist der
Spiritusbehaͤlter. (Die Figuren sind
saͤmmtlich Durchschnitte.) Er hat die Gestalt eines Sphaͤroids, welche
fuͤr diesen Zwek am geeignetsten ist.
B ist ein mit obigem Behaͤlter verbundener
Zapfen, durch welchen die Lampe auf dem Gestell jedweder Astrallampe befestigt
werden kann.
a, a ist der Hals einer Oeffnung in dem
Spiritusbehaͤlter, durch welchen der Brenner in
denselben hineingestekt wird. Der Brenner selbst stuͤzt sich hiebei nicht
allein durch einen kleinen Rand n, n
Fig. 2 auf
diesen Hals, sondern er klemmt sich auch darin fest, derselbe muß also so gearbeitet
seyn, daß er straff hineingeht.
b, b ist ein zweiter Hals, welcher den ersten in einem
gewissen Abstand concentrisch umgibt. Er dient hauptsaͤchlich dazu, um die an
einem Ring, der genau uͤber diesen Hals paßt, befestigten
Glokentraͤger mit der Lampe so zu verbinden, daß man diese Traͤger
nach Belieben aufsezen und abnehmen kann.
c, c sind die Eingußdillen, von denen der Symmetrie
wegen zwei vorhanden sind. Sie befinden sich innerhalb des Abstandes der oben
erwaͤhnten beiden Haͤlse oder Zargen, und werden durch kleine
uͤbergreifende Stuͤrzen verschlossen.
Der Brenner als der wesentlichste Theil der Lampe besteht
nun erstlich aus einem unten offenen, oben aber in dem Kopf d sich endigenden Rohr. Dicht unter dem Kopfe erweitert sich das Rohr in
einem Absaͤze k, k, und in diesem Absaͤze
sind ringsum, in gleichen Abstanden von einander, kleine, naͤhnadelfeine
Loͤcher gebohrt, und zwar, je nach der Capacitaͤt der Lampe, zehn,
sechzehn, zwanzig etc.
In jenem Kopfrohre stekt ferner ein an beiden Enden
offenes, uͤberall gleichweites Rohr e, e. Dasselbe muß straff in den ersteren passen, damit
es nicht zuruͤkfallen kann: es wird von Unten eingeschoben. In diesem
Roͤhre befindet sich ein Docht, der dasselbe ganz ausfuͤllt; es kann
ein gewoͤhnlicher, mehrfach zusammengenommener Baumwollendocht seyn.
Wird nun der Brenner, mir dem Dochtrohre ausgeruͤstet, in den
Spiritusbehaͤlter hineingestekt, so saugt der Docht den Leuchtspiritus ein
und fuͤhrt ihn bis in den Kopf des Brenners. Bringt man jezt hier oben eine
Erwaͤrmung an, die den Spiritus verdampfen macht, so muͤssen die
Daͤmpfe zu den vorerwaͤhnten kleinen Loͤchern
ausstroͤmen, wo sie nun angezuͤndet nicht allein als leuchtende Flammen erscheinen, sondern auch als erhizende, indem ihre Waͤrme gegen den Kopf
ausstrahlt, und so die Verdampfung des in dem Docht sich stets erneuernden
Leuchtspiritus fortsezt. Der Docht bildet hier also ein abgesondertes Reservoir fuͤr den Brennstoff, in welches derselbe
durch seine Capillaritaͤt eben so viel Leuchtspiritus wieder hinein schaffe,
als daraus verdampft. Es versteht sich hiebei von selbst, daß die Weile des
Dochtrohres oder die Aufsaugungsfaͤhigkeit des Dochtes mit der Anzahl der
Flammen, also mit der Verdampfung in einem richtigen Verhaͤltnisse stehen
muß, und wenigstens die Verdampfung nicht groͤßer seyn darf, als die
Aufsaugung.
Da den Daͤmpfen nur durch die kleinen Loͤcher ein Ausweg
geoͤffnet ist, so sind sie innerhalb des Kopfes immer etwas gespannt, sie stroͤmen daher mit einer gewissen
Kraft aus, und ihre Flammen streben, nach Maaßgabe ihrer Spannung, wie f, f zeigt, von dem Kopfe ab, den sie in Form eines
stammenden Kranzes umgeben. Natuͤrlich hat dieß Abstreben ein aus einem
moͤglichen Maximum und Minimum sich selbst regulirendes Medium. Denn
waͤre die Kraft, mit welcher die Daͤmpfe ausstroͤmen, zu groß,
so wuͤrden die Flammen zu weit abstreben und jezt dem Kopfe nicht Hize genug
zur Fortsezung der Verdampfung mittheilen, die Spannung muͤßte also
nachlassen, und mit ihr das uͤbermaͤßige Abstreben. Auf der anderen
Seite wuͤrde eine zu geringe Spannung wieder eine zu große Annaͤherung
der Flammen veranlassen, wodurch natuͤrlich denn die Erhizung und dadurch die
Spannung groͤßer werden muß; so daß also, so lange Brennstoff in der Lampe
vorhanden ist, der Flammenkreis sich stets unbemerkbar selbst regulirt.
Was nun die erste Erwaͤrmung zum Hervorloken der Flamme, also das Anzuͤnden der Lampe anbelangt, so dient hiezu das
Schaͤlchen h, h, welches den Brenner wie eine
ringfoͤrmige Rinne umgibt, und mit ihm durch Loͤthung verbunden ist.
Soll also die Lampe entstammt werden, so gießt man in diese Rinne eine Kleinigkeit
gewoͤhnlichen Spiritus, nicht Leuchtspiritus, weil dieser, da er hier ohne
Luftzug verbrennt, den Brenner schwarz machen wuͤrde, und zuͤndet ihn
an. Der brennende Spiritus umflammt alsbald den Brenner und erhizt ihn in wenigen
Secunden so weit, daß aus den kleinen Loͤchern die Flammen hervorbrechen,
welche nun, nachdem der Spiritus ausgebrannt ist, die fernere Erwaͤrmung
selbst uͤbernehmen.
Da aber waͤhrend des Brennens der Lampe Erhizung zunaͤchst dem Brenner mitgetheilt wird, und dieser die empfangene
Waͤrme nicht einzig und allein an das Dochtrohr abgibt, sondern auch seiner
Laͤnge nach fortleitet, so wuͤrde, da derselbe in der
Leuchtfluͤssigkeit steht, auch diese nicht unbedeutend erwaͤrmt
werden. Es wuͤrden sich dadurch aber, wenn auch die Fluͤssigkeit nicht
zum Kochen kaͤme, doch Daͤmpfe erzeugen, welche, indem sie sich
außerhalb des Brenners befaͤnden, theils durch den Hals des
Behaͤlters, der durch den Brenner keineswegs luftdicht geschlossen ist,
theils durch die Eingußdillen entweichen, und mindestens einen Terpenthingeruch
verbreiten muͤßten. Damit nun alles dieß verhindere wird, so stekt der
Brenner mit seinem unteren Ende in einem Roͤhre q,
q, Fig.
2, welches einen guten Viertelzoll weiter ist, als er selbst, so daß
zwischen dem Brenner und diesem Roͤhre ein Zwischenraum von 1/8 Zoll gebildet
wird. Beide Theile sind unten durch einen kranzfoͤrmigen Boden, wie m, m zeigt, luftdicht durch Loͤthung verbunden,
so daß die in A, A befindliche Fluͤssigkeit den
Brenner außerhalb nirgends beruͤhren kann, und fortwaͤhrend durch eine
Luftschicht von ihm getrennt ist. Dieses aͤußere, den Brenner umgebende Rohr
hat die innere Weite des Halses a, a, und dieses ist es,
welches sich in demselben festklemmt und gleichzeitig mit seinem Randchen n, n,
Fig. 2, auf
dem Halse ruht.
Ich mache besonders auf dieses Schuzrohr aufmerksam, denn ohne dasselbe sind diese
Lampen, wie dergleichen bereits unkundiger Weise gefertigt worden, ganz unpraktisch,
weil sie fast siedend heiß werden und deßhalb hermetisch verschlossen seyn
muͤssen, so daß man dieselben waͤhrend des Brennens nicht
nachfuͤllen kann, wenn der Leuchtspiritus consumirt seyn sollte.
Die Dochte zu den Lampen koͤnnen, wie ich bereits erwaͤhnt habe,
gewoͤhnliche Baumwollendochte seyn, nur muͤssen sie das Dochtrohr ganz
ausfuͤllen, ohne gerade darin gepreßt zu seyn. Sie wuͤrden, da sie
nicht selbst brennen, sondern nur den Spiritus bis zu dem Orte, wo dieser verdampft
werden soll, hintreiben, immerwaͤhrend benuzt werden koͤnnen, wenn sie
nicht mit der Zeit an ihrem oberen Ende, erstens durch allmaͤhliche
Verkohlung etwas litten, und zweitens, wenn ihre Capillaritaͤt durch
Verstopfung nicht geschwaͤcht wuͤrde; besonders wenn man die Lampen
bis auf die lezten Tropfen der Leuchtfluͤssigkeit ausbrennen laͤßt,
was also zu vermeiden ist, tritt der erste Fall ein. Der Docht kann alsdann nicht so
viel Spiritus in die Hoͤhe schaffen als verdampft, die Spannung der
Daͤmpfe hoͤrt folglich auf, die Flammen naͤhern sich und
erhizen den Kopf des Brenners zu sehr, und die Folge ist eine beginnende Verkohlung
des Dochtes. Auch wenn der Docht zu lang ist, findet dieß, wenn selbst der Spiritus
noch nicht fehlt. Statt, weil die Hoͤhe der Capillaranziehung eine
Graͤnze hat. Die Lampe muß also so eingerichtet seyn, daß der Docht nicht
laͤnger als hoͤchstens 9 Zoll zu seyn braucht, und dann muß man nicht
versaͤumen zu gehoͤriger Zeit den fehlenden Spiritus zu ersezen, oder,
was besser ist, die Lampe vor dem Anzuͤnden ganz voll zu fuͤllen, wenn
man zu befuͤrchten hat, daß die noch vorhandene Fuͤllung nicht
ausreicht.
Das vorgedachte Verstopfen des Dochtes stellt sich nach laͤngerem Gebrauche
unter allen Umstaͤnden ein. Das Terpenthinoͤhl naͤmlich, so wie
es in den Handel kommt, enthaͤlt immer eine nicht unbedeutende
Quantitaͤt Harz, welches, in der Fluͤssigkeit aufgeloͤst, von
dem Dochte gleichfalls mit aufgesogen wird, und sich im oberen Theile desselben
sammelt und hier, als unverdampfbare Substanz, die Capillarzwischenraͤume des
Dochtes verstopfend, verbleibt. Wenn sich also auch das Verkohlen des Dochtes leicht verhindern
ließe, und zwar dadurch, daß man denselben aus Amianth macht, so ist doch das
Verstopfen nicht zu vermeiden. Man muß daher einen Ausweg waͤhlen, und dieser
besteht darin, daß man den Docht zusammensezt. Um dieß zu bewerkstelligen, bringt
man zuerst in das Dochtrohr einen Docht, welcher das untere Ende bis o, o ausfuͤllt, und dann stekt man von Oben einen
kuͤrzeren hinein und druͤkt diesen gegen den unteren gelinde an, damit
sich beide genau beruͤhren. Der laͤngere Docht bleibt nun fuͤr
immer derselbe, dahingegen ersezt man den oberen etwa alle acht Tage durch einen
neuen. Diesen lezteren nun kann man aus Amianth verfertigen, indem man die Fasern
zusammenfaßt, mit einer Scheere unten und oben glatt schneidet, mit einem
duͤnnen Clavierdraht weitlaͤuftig umwikelt und so hineinstekt. Mit
zweien solcher Dochte reicht man recht gut ein Jahr hindurch aus, in dem man den
gebrauchten bei gewoͤhnlichem Kuͤchenfeuer wiederum
ausgluͤht.
Ich habe weiter oben erwaͤhnt, daß die Dike des Dochtes mit der Verdampfung,
also mit der Anzahl der Flammen in Verhaͤltnis stehen muͤsse. Das ist
nur bei Lampen von groͤßerer Capacitaͤt leicht zu bewerkstelligen.
Verlangt man indeß nur eine geringe Erleuchtung, soll also die Lampe nur etwa 8
– 10 Flammen haben, so muß der Brenner nach Fig. 3 eingerichtet seyn.
Derselbe hat alsdann nicht von Oben bis Unten eine
gleiche Weite, sondern bildet bei p, p einen Absaz,
weil, wenn er durchweg nur die obere Weite haͤtte, der duͤnne Docht
nicht Fluͤssigkeit genug hinaufschaffen koͤnnte, und wenn er durchweg
die untere Weite haͤtte, die Flammen zu einzeln stehen, und dem Ganzen ein
todtes Ansehen geben wuͤrden. Das Dochtrohr geht bei dieser Einrichtung
natuͤrlich nur bis p, p, gleichwohl ist die
Erhizung stark genug, um auch von hier die Daͤmpfe zu entwikeln. Soll
uͤbrigens die Lampe mit einem neuen Dochte versehen werden, so nimmt man den
Brenner, der, wie Fig. 2 zeigt, nur in dem Halse a, a
eingeklemmt ist, mit sammt der ganzen Einrichtung heraus, zieht das Dochtrohr
hervor, und bringt, nachdem ein neuer Docht hineingestekt ist, jedes wieder an seine
Stelle, was mit der groͤßten Leichtigkeit zu jeder Zeit geschehen kann.
Das Material, aus welchem die Brenner gefertigt werden, ist natuͤrlich Messing, und zwar muͤssen dieselben aus Blech im
Feuer geloͤthet und nicht gegossen seyn, weil diese lezteren, ihrer
groͤßeren Metallstaͤrke wegen, dem Dochte zu viel Waͤrme
vorenthalten wuͤrden. Der Spiritusbehaͤlter und der Staͤnder
der Lampe koͤnnen aus jedem hiezu geeigneten Stoffe seyn, doch ist es nicht
rathsam den ersteren zu lakiren, weil der Leuchtspiritus, wenn von demselben auf die
Lampe etwas
verschuͤttet wird, den Lak angreift. Sehr geeignet fuͤr beide ist ein
Geschirrgut. So werden hier in Berlin diese Lampen in der Baron v. Eckardtstein'schen Steingutfabrik, deren Besizer, der
Baron E. v. Eckardtstein, sich vielfach um diesen
Gegenstand verdient gemacht hat, durchaus zwekmaͤßig und elegant
gefertigt.
Die Bereitung des Leuchtspiritus als Brennstoff
fuͤr diese Lampe ist sehr einfach, wie ich bereits in Nr. 38 (1835) der Haude- und Spener'schen
Zeitung eroͤrtert habe, nur gehoͤrt dazu ein sehr starker Spiritus.
Derselbe muß mindestens 93 Proc. nach dem Tralles'schen
Alkoholometer haben (0,823), ein Mal um die noͤthige Menge
Terpenthinoͤhl aufloͤsen zu koͤnnen, und zweitens um
moͤglichst wenig Wasser verbrennen zu muͤssen, dessen Vorhandenseyn in
groͤßerer Menge der Leuchtkraft bedeutenden Abbruch thut. Einen Spiritus von
dieser Staͤrke darzustellen ist nicht ganz leicht, und es gelingt durch
Destillation nur auf gut eingerichteten Pistorius'schen
Apparaten. Ich empfehle daher, da wo man eine gleichmaͤßige Waͤrme von
40° R. zu Gebote hat, wie in Brau- und Brennereien, Geschirrfabriken
etc., die Soͤmmering'sche Methode, die sich mir
unter obigen Bedingungen sehr bewaͤhrt gezeigt hat, und die ich selbst in
Destilliranstalten mit Vortheil eingerichtet habe. Sie besteht, wie bekannt, darin,
daß man den zu verstaͤrkenden Spiritus in eine Thierblase fuͤllt,
durch deren Leimgehalt das Wasser ausgezogen, nach Außen geschafft, und hier bei
gehoͤriger Waͤrme fort und fort verdampft wird. Man bediene sich hiezu
indeß nicht zu großer Blasen; man nehme also Schweinsblasen, weil diese, wegen der
zum kleineren Inhalt verhaͤltnißmaͤßig groͤßeren
Oberflaͤche, dem Spiritus in kuͤrzerer Zeit und unter geringerem
Verluste die gewuͤnschte Staͤrke geben.
Das Verhaͤltniß des Spiritus zum Terpenthinoͤhl ist alsdann dem Maaße nach 4 Theile Spiritus und 1 Theil
Terpenthinoͤhl. Koͤnnte man das leztere zu einem billigen Preise
rectificirt, d.h. durch Destillation mit Wasser, oder durch andere Mittel von seinem
Harze befreit erhalten, so wuͤrde man mit noch groͤßerem Vortheile in
den Lampen Amianthdochte anwenden koͤnnen, welche dann sehr lange, ohne daß
man sie zu erneuern braucht, aushalten. Leider aber steht das rectificirte
Terpenthinoͤhl noch zu hoch im Preise, denn schon mit dem rohen kostet die
Unterhaltung dieser Lampen etwas mehr als die Unterhaltung der gewoͤhnlichen
Oehllampen, wozu die sehr hohe Besteuerung des Spiritus, ungeachtet er in dieser
Gestalt kein Getraͤnk mehr ist, bedeutend beitraͤgt.
Was die Intensitaͤt des Lichtes der Dampflampe
anbelangt, so duͤrfte derselben wohl keine andere Leuchte gleichkommen. Denn
indem die
entzuͤndeten Daͤmpfe des Leuchtspiritus, die in dem Kohlenstoffe des
Terpenthinoͤhls einen hinreichenden Fonds zum Leuchten besizen, mit einer
gewissen Kraft in die Luft Hinausgetrieben werden, und diese aus der Stelle
draͤngen, eignen sie sich den Sauerstoff derselben, gleichsam wie ein
umgekehrtes Geblaͤse, mit Leichtigkeit an, und gelangen zum
vollstaͤndigen Verbrennen mit dem weißesten lichte; dabei hat das Ganze mit
seinem Flammenkreise ein hoͤchst zierliches Ansehen, so daß wohl nichts zu
einer eleganten Beleuchtung geeigneter ist als diese Lampen, die natuͤrlich
jedweder Handhabung faͤhig sind. Wie ich schon erwaͤhnt habe, kann man
auch eine Gloke daruͤber stellen, und dieß
geschieht ohne die Flamme in einen Cylinder einzuschließen. Die Gloke muß nur unten
weit geoͤffnet seyn und einen etwas hohen Hals haben; ein Springen derselben
ist keineswegs zu befuͤrchten. Auch kann die Lampe mit Armen versehen seyn,
aus denen die Flammenkreise brennen: die Construction ist zu einfach, als daß ich
sie zu beschreiben noͤthig haͤtte, doch erinnere ich, daß die Arme,
als Zuleiter des Spiritus, an ihrer Muͤndung im Spiritusbehaͤlter nur
eine sehr kleine Oeffnung haben duͤrfen, weil sonst beim Tragen der Lampe die
Flammen des einen Armes leicht erloͤschen.
Ich habe jezt noch einen Punkt zu eroͤrtern, und dieser ist die Feuergefaͤhrlichkeit. Allerdings ist der
Leuchtspiritus eine sehr entzuͤndliche Fluͤssigkeit, allein in der
Lampe hoͤrt er es auf zu seyn. Denn die schlimmste aller
Gefaͤhrdungen, welche die Lampe erleiden kann, ist, daß sie umgeworfen und
dadurch Spiritus verschuͤttet wird, der sich neu entzuͤnden kann. Das
Verschuͤtten ist allerdings moͤglich, nicht aber das
Entzuͤnden, weil in demselben Augenblike, wo die Lampe umfallt, die Flamme
sogleich erloͤscht, was jedes Mal erfolgte, so oft ich die Lampe absichtlich
umwarf. So wenig man also hiebei irgend etwas zu fuͤrchten hat, so mache ich
doch darauf aufmerksam, daß man beim Nachfuͤllen der Lampe, waͤhrend
sie brennt, vorsichtig seyn, und den Leuchtspiritus aus einer Kanne mit einer etwas
langen Dille nachgießen muß.
Zur besseren Uebersicht habe ich in Fig. 2 einen Brenner in
Verbindung mit den wesentlichsten Theilen der Lampe in natuͤrlicher
Groͤße abgebildet; da indeß der Raum der Tafeln beschraͤnkt ist, so
ist der Brenner sammt dem Roͤhre q, q in der
Zeichnung kuͤrzer als er es in der Wirklichkeit ist, so daß also die
Verbindung m, m tiefer unten liegt, indem derselbe von
d, d gemessen bis m, m 9
Zoll betraͤgt. Die Groͤße dieses Brenners ist uͤbrigens auf 16
Flammen berechnet, wohingegen der in seinen oberen Verhaͤltnissen gleichfalls
in natuͤrlicher Groͤße gezeichnete Brenner Fig. 3 nur 10 Flammen traͤgt. Die
Stuͤrze r, r,
Fig. 2, dient
zum Verloͤschen der Lampe. Nachdem man sie naͤmlich ausgeblasen hat,
stellt man diese Stuͤrze, die bis in die Rinne h,
h hinunterreicht, daruͤber, damit die noch ausstroͤmenden
Daͤmpfe condensirt werden, und der Kopf des Brenners sich schnell
abkuͤhlt.
Tafeln