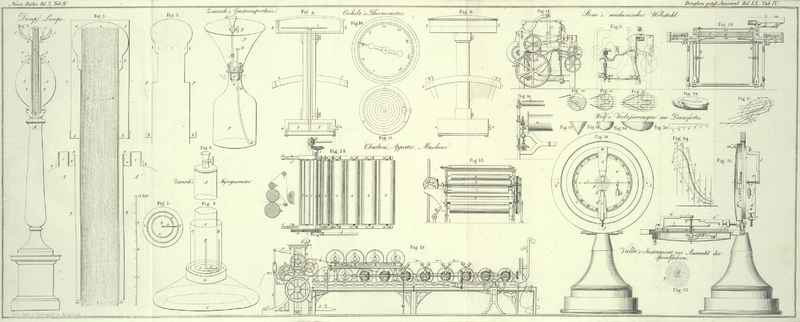| Titel: | Verbesserungen an den Pianofortes, welche in einem neuen auf acustische Principien begründeten, und auf alle Arten von Pianofortes anwendbaren Resonanzboden bestehen, und worauf sich Robert Wolf, Fabrikant von Musikinstrumenten in Cornhill, City of London, am 2. März 1835 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XXXV., S. 186 |
| Download: | XML |
XXXV.
Verbesserungen an den Pianofortes, welche in
einem neuen auf acustische Principien begruͤndeten, und auf alle Arten von
Pianofortes anwendbaren Resonanzboden bestehen, und worauf sich Robert Wolf, Fabrikant von
Musikinstrumenten in Cornhill, City of London, am 2.
Maͤrz 1835 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Februar 1836, S.
345.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Wolf's verbesserte Pianofortes.
Der Patenttraͤger beabsichtigt durch diese seine Erfindung den
gewoͤhnlichen Resonanzboden der Pianofortes durch einen hohlen
Behaͤlter oder durch ein Gehaͤuse von krummliniger Form, welches er
den Resonanz- oder Schallkoͤrper (sounding-body) nennen will, zu ersezen. Die Form dieses
Resonanzkoͤrpers ist nicht von Wesenheit, wenn dessen Seiten nur krummlinig
sind; man kann demselben daher verschiedene, zum Theil auch in den beigegebenen
Zeichnungen angegebene Gestalten geben. Doch bemerkt der Patenttraͤger, daß
er die Form in Fig.
28 und 29 fuͤr besser haͤlt, als die trichterfoͤrmige, die
halbkugelfoͤrmige und die elliptische, wie man sie in Fig. 21, 23, 25 im Durchschnitte und
in Fig. 22,
24, 26 im Profile
angedeutet sieht.
Der obere Theil dieser verschiedenen Resonanzkoͤrper ist der eigentliche
Resonanzboden und in diesem muß ein Schallloch angebracht seyn; bei der Form, Fig. 28 und
29 ist es
besser, wenn wenigstens drei solche Schallloͤcher, welche in der Zeichnung
durch Ovale angedeutet sind, vorhanden sind. Uebrigens ist zu bemerken, daß diese Schallloͤcher
nicht bloß in dem Resonanzboden, sondern auch in dem Boden des Koͤrpers
angebracht werden koͤnnen.
Die trichter- oder kegelfoͤrmigen, hemisphaͤrischen oder
elliptischen Koͤrper sollen aus Furnirstuͤken, welche aus
Ahorn- oder Maulbeerfeigen- (Sycamor) Holz
oder aus irgend einem anderen zur Verfertigung der Guitarren, Violinen u. dergl.
gebraͤuchlichen Holze geschnitten sind, zusammengesezt werden. Diese
Furnirstuͤke sollen nicht uͤber 1/10 Zoll Dike haben, und fuͤr
die Kegelform in dreiekige, fuͤr die beiden anderen Formen hingegen in solche
Zwikel geschnitten werden, wie man sich ihrer gewoͤhnlich zum Zusammensezen
von Luftballons bedient, und wie man sie in Fig. 22, 24, 26 durch Punkte
angedeutet sieht. Die Vereinigung derselben geschieht, indem man sie auf einem
Holzbloke von gehoͤriger Form und Groͤße zusammenleimt, und hierauf
reinigt und glaͤttet.
Die in Fig. 28
und 29
abgebildeten Resonanzkoͤrper hingegen werden auf folgende Weise gebaut. Man
verfertigt sich nach demselben Plane, nach welchem die Guitarrenmodel gebaut zu
werden pflegen, einen starken hoͤlzernen Model von der Form, welche man dem
Resonanzkoͤrper geben will. In diesem Model gibt man den Seiten des
Koͤrpers, nachdem man sie vorher so genau als moͤglich in die
verlangte Form geschnitten hat, ihre vollkommene Gestalt. Das Biegen des Holzes kann
man, wenn man es fuͤr noͤthig findet, nach dem bei den
Guitarren- und Violinenmachern uͤblichen Verfahren durch Anwendung von
warmem Wasser oder von Dampf erleichtern und beguͤnstigen. Die
Seitenwaͤnde sollen aus Ahorn-, Maulbeer-, Feigen- oder
einem anderen aͤhnlichen festen Holze verfertigt, und aus so wenig
Stuͤken als moͤglich von 1/10 Zoll Dike zusammengefuͤgt werden.
Rund um die innere Seite dieser Seitenwaͤnde muß hierauf in gleicher
Hoͤhe mit deren oberen Oberflaͤche ein kleiner Streifen Holz,
aͤhnlich der gewoͤhnlichen Fuͤtterung der Violinen geleimt
werden, und eben dieß hat auch in der Hoͤhe der unteren Oderflaͤche zu
geschehen, nicht nur um dadurch den Seitenwaͤnden mehr Festigkeit zu geben
und um sie mehr in der Form zu erhalten, sondern auch um den Boden und den Dekel mit
mehr Sicherheit daran befestigen zu koͤnnen.
Der Boden soll aus demselben Holze verfertigt werden, welches man zu den
Seitenwaͤnden nimmt; doch soll es hiezu 1/6 Zoll Dike haben. Sowohl dieser
Boden, als der Dekel oder der eigentliche Resonanzboden wird an die
Seitenwaͤnde geleimt, waͤhrend sich diese noch in dem Model befinden;
ersterer erhaͤlt hiedurch die verlangte Kruͤmmung oder
Woͤlbung, waͤhrend der Resonanzboden flach bleibt. Der Boden kann vor
dem Aufleimen des Dekels oder Resonanzbodens durch Rippen aus weichem Holze, denen man vorher die
gehoͤrige Curve gibt, die man in gewissen Zwischenraͤumen von einander
der Quere nach auf die innere Oberflaͤche des Bodens leimt, und welche in
Fig. 28
und 29 durch
punktirte Linien angedeutet sind, verstaͤrkt werden, gleichwie man die
gewoͤhnlichen Resonanzboden ebenfalls durch aͤhnliche Rippen zu
verstaͤrken pflegt.
Der Resonanzboden oder der Dekel des Schallgehaͤuses, welcher an Dike dem
Resonanzboden der gewoͤhnlichen Pianofortes gleichzukommen hat, wird aus
weichem Holze mit geradlaufenden Fasern, am besten aus Schweizer Trommelholz, dessen
sich die Instrumentenmacher meistens hiezu zu bedienen pflegen, verfertigt. Die
Fasern des Holzes muͤssen mit den Saiten parallel laufen; auch muß dieser
Resonanzboden nach der an den herkoͤmmlichen Resonanzboden uͤblichen
Methode durch Rippen aus weichem Holze verstaͤrkt werden.
Das nach dem eben beschriebenen Verfahren verfertigte Schallgehaͤuse muß nach
einer der beiden sogleich anzugebenden Methoden an dem Pianoforte befestigt werden.
Nach der ersten dieser Methoden soll man naͤmlich an die innere Seite der
Seitenwaͤnde des Schallgehaͤuses mehrere kleine Stuͤke Holz von
solcher Groͤße leimen, daß sie das Gewinde einer eisernen Schraube von
beilaͤufig einem Zoll Laͤnge aufzunehmen im Stande sind. Zehn oder
eilf solche Stuͤke reichen hin; deren Zahl muß jedoch mit der Laͤnge
des Gehaͤuses vermehrt oder vermindert werden, denn ihre Aufgabe ist den
Resonanzboden vollkommen fest zu erhalten, wenn das Instrument besaitet wird. An
einem kreisrunden Schallgehaͤuse koͤnnen diese Stuͤke gleich
weit von einander entfernt angebracht werden; an einem elliptischen hingegen sollen
sie an dem schmaͤleren Ende naͤher an einander stehen, als an dem
breiteren. Die in Fig. 27 angedeuteten Stellen scheinen die geeignetsten zu seyn. An der
aͤußeren Seite des Gehaͤuses soll man an jenen Stellen, welche denen,
an welche innen die Hoͤlzer geleimt sind, entsprechen, mit einer oder zwei
Schrauben von einem Zoll Laͤnge starke, eiserne, unter einem rechten Winkel
gebogene Klammern befestigen, wie man dieß in Fig. 28 an dem
schmaͤleren Ende angedeutet sieht. Mittelst anderer Schrauben muͤssen
diese eisernen Klammern an den Leisten oder an dem Inneren des Kastens, der so
gebaut seyn muß, daß er das Schallgehaͤuse von allen Seiten umgibt,
festgemacht werden. Statt der gewoͤhnlichen Methode diese Kranzleisten
anzubringen, nimmt man ein starkes eichenes Brett von wenigstens 1 1/2 Zoll Dike,
welches den ganzen Kasten ausfuͤllt, uͤber die obere Flaͤche
des als Unterlage dienenden Bohlens geht, und daher die Stelle der
gewoͤhnlichen zur Aufnahme der Stifte bestimmten Bekleidung vertritt. Dieses
Brett muß aus zwei zusammengeleimten, gegen die Richtung der Holzfasern laufenden Schichten
bestehen, und fest an den Kasten und die Unterlage geleimt werden. Aus ihm schneidet
man ein der Form des Schallgehaͤuses entsprechendes Stuͤk aus: so
jedoch, daß der Ausschnitt etwas weniges groͤßer wird, als das
Schallgehaͤuse, und daß mithin lezteres frei in den Ausschnitt eingesezt
werden kann, ohne daß es die Kranzleisten oder das Brett an irgend einer anderen
Stelle beruͤhrt, als da, wo es mittelst der eisernen Klammern daran
festgemacht wird. An der Hinteren Seite und da wo dieß ohne Beeintraͤchtigung
des Schallgehaͤuses geschehen kann, muß dieses Brett nach der
gewoͤhnlichen Methode durch Leisten verstaͤrkt werden.
Nach der zweiten Methode das Schallgehaͤuse an dem Instrumente anzubringen,
soll man den Resonanzboden rings herum um beilaͤufig einen Zoll uͤber
die Seitenwaͤnde des Schallgehaͤuses hinaus ragen lassen, wie dieß in
Fig. 28
an dem breiteren Ende angedeutet ist. Die Haͤlfte dieses vorspringenden
Randes soll man dann in eine Fuge leimen, welche rings um die Oeffnung
laͤuft, die zur Aufnahme des Schallgehaͤuses in die Kranzleisten oder
in das Innere des Kastens geschnitten, und wie oben gesagt, so groß ist, daß
zwischen den Raͤndern und dem Schallgehaͤuse ein solcher Raum bleibt,
daß lezteres an allen Seiten frei ist. Die Fuge muß so tief seyn, daß sie den Saiten
hinreichende Unterlage gestattet. In den zwischen den Kranzleisten und dem
Schallgehaͤuse befindlichen Raum des hervorstehenden Randes muͤssen
mehrere kleine Loͤcher gebohrt werden, um hiedurch so viel als
moͤglich die Uebertragung der Schwingungen von dem Schattgehaͤuse an
den Kasten zu verhuͤten. Die einzige Ruͤksicht, welche beim Bohren
dieser Loͤcher beachtet werden muß, besteht darin, daß das Holz hiedurch
nicht zu sehr geschwaͤcht werden darf; uͤbrigens kann man sich der
Pianofortes auch ohne solcher Loͤcher bedienen.
Der Steg wird auf die herkoͤmmliche Weise an dem Resonanzboden angebracht;
doch kann man ihm auch die aus Fig. 23 und 25
ersichtliche Gestalt geben. In diesem Falle muß die laͤngste oder die
Baßsaite in die Mitte oder an den groͤßten Durchmesser des Resonanzbodens
gebracht werden, waͤhrend man die uͤbrigen abwechselnd zu beiden
Seiten aufzieht und zwar in der Ordnung, in der sie an Laͤnge abnehmen. Der
Patenttraͤger erklaͤrt jedoch diese Art von Steg nicht als seine
Erfindung.
Die Groͤße der in Fig. 21, 23 und 25 abgebildeten
Resonanzboden und folglich der Schallgehaͤuse, an denen sie angebracht sind,
hingt von der Oeffnung der Scala oder von der Entfernung von einer Saite zur anderen
und der hieraus folgenden Laͤnge des Steges ab. Fuͤr kreisrunde
Resonanzboden duͤrfte sich ein Durchmesser von 2 Fuß 6 Zoll bis 3 Fuß am
besten eignen; bildet das Gehaͤuse eine Halbkugel, so soll dessen Tiefe die
Haͤlfte der Breite betragen. Hat der Resonanzboden hingegen eine elliptische
Gestalt, so muß die Laͤnge in gehoͤrigem Verhaͤltnisse zur
Breite stehen, waͤhrend die Tiefe die Haͤlfte des Querdurchmessers des
Resonanzbodens betraͤgt.
Fig. 28 zeigt
das Profil eines Schallgehaͤuses, dessen Resonanzboden man aus Fig. 27 sieht,
und der fuͤr ein horizontales Quer-Fortepiano bestimmt ist. Fig. 29 ist
fuͤr ein aufrechtes oder fuͤr ein großes horizontales Fortepiano
berechnet.
Alle diese Resonanzboden muͤssen von jenem Theile, uͤber welchen die
staͤrkeren oder Baßsaiten gehen, bis zu jenem Theile, uͤber den die
kuͤrzeren oder Discantsaiten gehen, sowohl an Tiefe als an Breite abnehmen.
Die Abnahme an Tiefe muß immer in Linien, welche mit den Saiten parallel laufen,
Statt finden, so zwar, daß die Tiefe zu beiden Seiten des Schallgehaͤuses bei
gleichen Saiten gleich ist. Man ersieht diese Abnahme an Tiefe und Breite aus Fig. 29 und
30. Die
sieben Linien in Fig. 27 und 29 bezeichnen jene
Stellen, uͤber die die sieben Saiten, von denen jede die Note F gibt, gehen; es erhellt hieraus die Tiefe und Breite
des Schallgehaͤuses nach der Scala. Fig. 30 zeigt die Tiefe
allein.
Die Scala der Breite und Tiefe wurde durch Versuche ermittelt, und der Zwek derselben
ist, die Vibrationen des Schallgehaͤuses mit jenen der respectiven Saiten in
Einklang zu bringen. Diese Scala darf nicht nach der Art des Holzes, woraus man das
Schallgehaͤuse verfertigt, wechseln; auch kann man die Dike des Holzes nach
derselben Methode, deren man sich gegenwaͤrtig beim Baue der
gewoͤhnlichen Resonanzboden bedient, abaͤndern.
Ist der Steg kurz und seine Kruͤmmung mithin rasch, so kann die Breite nicht
uͤberall genau nach der Scala gemacht werden; doch soll man nur da von dieser
lezteren abgehen, wo unuͤbersteigliche Schwierigkeiten dieß durchaus
nothwendig machen.Das London Journal sagt keine Sylbe uͤber
die Versuche, welche zur Ermittelung der hier mehrfach erwaͤhnten
Scala angestellt wurden, und schweigt ebenso gaͤnzlich uͤber
das derselben zum Grunde liegende Princip. A. d. R.
Tafeln