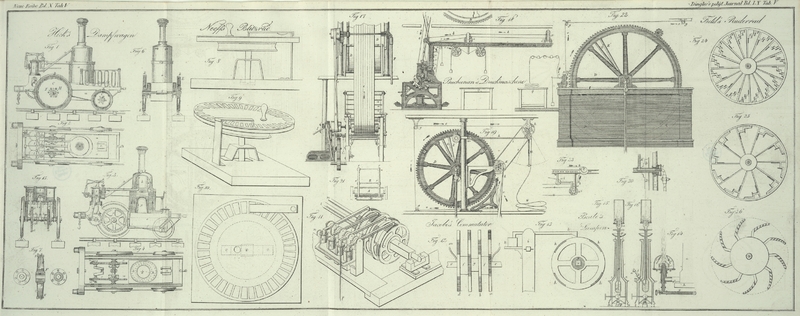| Titel: | Verbesserungen an den Locomotivmaschinen oder Dampfwagen, welche zum Theil auch an den gewöhnlichen Wagen und Dampfmaschinen anwendbar sind, und worauf sich Benjamin Hick, Ingenieur von Bolton-le-Moors in der Grafschaft Lancaster, am 8. Oct. 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. XLVIII., S. 256 |
| Download: | XML |
XLVIII.
Verbesserungen an den Locomotivmaschinen oder
Dampfwagen, welche zum Theil auch an den gewoͤhnlichen Wagen und Dampfmaschinen
anwendbar sind, und worauf sich Benjamin Hick, Ingenieur von Bolton-le-Moors in der
Grafschaft Lancaster, am 8. Oct. 1834 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Januar 1836, S.
205.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Hick, uͤber Dampfwagen.
Die Erfindungen des Patenttraͤgers bezweken eine eigenthuͤmliche
Einrichtung der Dampfcylinder, eine verbesserte Methode die Kraft auf die
Treibraͤder wirken zu lassen, und auch eine Verbesserung an den
Raͤdern selbst. Die beigefuͤgten Zeichnungen zeigen eine diesen
Erfindungen gemaͤß gebaute und fuͤr Eisenbahnen bestimmte
Locomotivmaschine.
Fig. 1 zeigt
einen Seitenaufriß der Maschine und des Wagens. Fig. 2 gibt einen Grundriß
oder eine Ansicht im Vogelperspective. Fig. 3 ist ein
Laͤngendurchschnitt, zum Theil im Aufrisse gezeichnet. Fig. 4 zeigt einen
Grundriß, der gleichfalls zum Theil in Elevation gezeichnet ist. Fig. 5 gibt eine zum Theil
im Durchschnitte gezeichnete Endansicht. Fig. 6 ist ein
Querdurchschnitt der Maschine durch die Mitte der Treibraͤder genommen,
woraus eine Art des Raͤderbaues erhellt, waͤhrend Fig. 7 eine andere Art von
Raͤdern in einem groͤßeren Maaßstabe gezeichnet zeigt. An allen diesen
Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auch auf gleiche Gegenstaͤnde.
a ist der Kessel, in welchem eine große Anzahl
senkrechter und mit Wasser umgebener Roͤhren b
enthalten ist. Die unteren Enden dieser Roͤhren oͤffnen sich in den
Scheitel der Heizkammer c, welche durch die mit dem
Thuͤrchen e verschlossene Oeffnung d mit Brennmaterial gespeist wird. Die Seiten, die Enden
und der Scheitel der Heizkammer sind durch einen mit Wasser ausgefuͤllten
Raum von dem aͤußeren Gehaͤuse des Kessels getrennt. f sind die Roststangen. g
ist ein umgekehrtes Kegelsegment oder eine Art von Kuppel, welche sich in den
Scheitel der Heizkammer oͤffnet, und welche sich von hier aus bis auf eine
geringe Entfernung von dem Niveau des Wassers erhebt, so daß auf diese Weise eine
große Oberflaͤche der directen strahlenden Hize ausgesezt und auch
verhuͤtet wird, daß die erhizten Gase und der Rauch nicht zu schnell durch
die Roͤhren entweichen. Dieselbe Vorrichtung dient uͤbrigens auch zur
Verminderung des Gewichtes des in dem Kessel enthaltenen Wassers.
Die Kammer h nimmt den in dem Kessel erzeugten Dampf auf;
sie ist mit den erhizten Stoffen umgeben, welche aus den oberen Theilen der
Roͤhren entweichen, und welche durch den zwischen dem aͤußeren Dekel
des Kessels und der Heizkammer befindlichen Raum an den Schornstein emporsteigen.
Die Roͤhre i leitet den Dampf aus dem Kessel an
die Ventilbuͤchsen j, von wo er dann nach
einander und in gehoͤrigen Zwischenraͤumen durch die Ventile k in die oberen Theile der drei Cylinder l uͤbergeht. Nach jedem Hube der Kolben m entweicht der Dampf durch die Austrittsroͤhren
n, die ihn auf die gewoͤhnliche Weise in den
Rauchfang leiten. Die Cylinder sind an dem oberen Ende geschlossen, waͤhrend
sie an dem unteren Ende dem Zutritte der atmosphaͤrischen Luft offen stehen;
der Dampf druͤkt mithin nur auf die obere Flaͤche eines jeden der
Kolben. Jede der Verbindungsstangen o ist mit einem
Gefuͤge an die untere Flaͤche des Kolbens gekuppelt; und die Kolben
werden mittelst der kleinen an ihnen befestigten Stangen p, die sich frei in den Fuͤhrern q
bewegen, in den gehoͤrigen Stellungen erhalten. Die drei Verbindungsstangen
wirken auf die gekniete Welle, an welche die Zahnraͤder s, t, die verschiedene Durchmesser haben, geschirrt
sind. Die in den Zahnraͤdern befestigten Krummzapfen u und der Kniehebel v sind unter einem Winkel
von 120° gegen einander gestellt, und dadurch wird der Welle r eine sehr gleichmaͤßige rotirende Bewegung
mitgetheilt. Diese Zahnraͤder treiben zwei andere Raͤder w, x, welche so angebracht sind, daß sie sich frei an
der Achse y drehen, an deren Enden zwei der
Laufraͤder des Wagens fest geschirrt sind. Eine Klauenbuͤchse z schiebt sich seitwaͤrts uͤber
Schluͤssel, welche in die Achse y eingebettet
sind, und welche verhuͤten, daß sich die Klauenbuͤchse ohne die Achse
umdreht. Die seitliche Bewegung kann der Klauenbuͤchse mittelst eines
gabelfoͤrmigen Hebels oder auch auf irgend eine andere geeignete Weise
mitgetheilt werden. Wenn der Wagen mit der groͤßten Geschwindigkeit
fortgetrieben werden soll, wie z.B. auf einer horizontalen Eisenbahnlinie, so wird
die Klauenbuͤchse mit den beiden gleichen Raͤdern s, w zusammen gekuppelt; ist hingegen bei verminderter
Geschwindigkeit eine vermehrte Kraft erforderlich, wie z.B. beim Ansteigen der
Bahnen, so wird die Klauenbuͤchse von den gleichen Raͤdern losgemacht,
und dafuͤr an das an der entgegengesezten Seite befindliche ungleiche
Raͤderpaar t, x geschirrt.
In der Zeichnung ist das kleine Rad t so dargestellt, als
waͤre sein Durchmesser nur halb so groß als jener des groͤßeren Rades
x, so daß der Wagen bei diesen
Groͤßenverhaͤltnissen mit diesen Raͤdern mit der Haͤlfte
der Geschwindigkeit aber mit der doppelten Kraft, welche mit dem gleichen
Raͤderpaare zu erzielen ist, fortgeschafft werden kann. Dieses
Groͤßenverhaͤltniß des ungleichen Raͤderpaares kann
uͤbrigens nach Umstaͤnden so abgeaͤndert werden, daß dadurch
eine groͤßere oder geringere Geschwindigkeit und Kraft erzielt werden
kann.
Beim Hinabfahren uͤber schiefe Flaͤchen kann die Klauenbuͤchse
ganz von den Raͤdern frei gemacht werden, wo sie sich dann in der aus Fig. 4
ersichtlichen Stellung befinden, und der Wagen durch seine eigene Schwere
hinabrollen wird, waͤhrend die Maschinerie mit den Zahnraͤdern
unterdessen im Zustande der Ruhe verbleibt. Eben so erhellt von selbst, daß, wenn
sich die Klauenbuͤchse in lezterer Stellung befindet, die Maschine arbeiten
kann, waͤhrend der Wagen selbst stationaͤr oder unbeweglich
bleibt.
Eine ausfuͤhrliche Beschreibung des Wagengestelles erscheint nicht fuͤr
noͤthig, indem bekanntlich jede eigene Art von Maschine auch einen eigens
fuͤr sie gebauten Wagen erfordert. Eben so wenig halten wir es fuͤr
noͤthig, den Betrieb der Ventile zu beschreiben. Man ersieht naͤmlich
den Ventilmechanismus aus den einzelnen Figuren deutlich genug, und der
Patenttraͤger nimmt weder irgend eine bestimmte Art von Ventil, noch irgend
eine bestimmte Methode die Ventile in Bewegung zu sezen, als seine Erfindung in
Anspruch.
Die bisherige Beschreibung bezieht sich speciell auf die hier abgebildete
Locomotivmaschine, die der Patenttraͤger in ihren einzelnen Theilen auf das
Vortheilhafteste zusammengesezt glaubt. Als seine Erfindung hieran erklaͤrt
er uͤbrigens nur die Verbindung zweier oder mehrerer, an ihrem unteren Ende
offener Cylinder, in denen der Dampf nur auf die oberen Flaͤchen der Kolben
druͤkt, so daß seine Kraft nur in einer Richtung nach Abwaͤrts an die
gekniete Achse oder an die Treibraͤder fortgepflanzt wird. Der
Patenttraͤger glaubt, daß hiebei die Adhaͤsion zwischen den
Raͤdern und den Schienen groͤßer und die dem Wagen mitgetheilte
Schwingung oder Vibrirung geringer seyn wird, als wenn die Kraft abwechselnd in der
Richtung nach Auf- und Abwaͤrts oder nach Vor- und
Ruͤkwaͤrts auf die Raͤder wirkt. Was die Zahl der anzuwendenden
Cylinder betrifft, so bindet er sich hierin nicht an zwei, drei oder eine andere
Zahl; doch glaubt er, daß fuͤr Dampfwagen und zum allgemeinen Gebrauche drei
Cylinder am zwekmaͤßigsten seyn duͤrften. Die Kraft der Maschine kann,
wenn man es vorzieht, auch direct durch die Verbindungsstangen an eine gekniete,
unter den Cylindern befindliche Achse, an der die Treibraͤder angebracht
sind, fortgepflanzt werden, wo dann die Zahnraͤder wegfallen. Endlich ist
klar, daß die hier beschriebene Maschinerie auch auf Dampfmaschinen, die nicht
fuͤr Dampfwagen bestimmt sind, anwendbar ist.
Der Patenttraͤger geht hierauf zur Beschreibung der Verbesserungen uͤber, welche er an den
Wagenraͤdern anbrachte, und die, wie man aus den beiden Durchschnitten Fig. 6 und 7 ersieht, von
zweierlei Art sind. A ist die Nabe aus Gußeisen oder
einem anderen Metalle; B der aus gewalztem Eisen
bestehende Radreifen, welcher durch Scheiben aus Eisenblech C mit der Nabe verbunden ist. Fig. 7 zeigt eine der
Methoden, nach welchen diese Raͤder verfertigt werden koͤnnen. Die
aͤußeren Flaͤchen der Randstuͤke D
sind in gehoͤriger Form gegossen; und die inneren Theile E der Felge oder des Reifens sind zur Aufnahme der
Scheiben abgedreht. Die Scheiben muͤssen genau und fest an die Nabe und die
Felge passen, und werden zu diesem Behufe in einem metallenen Bloke der
Groͤße und Form nach genau ausgepreßt. Die Scheiben koͤnnen auch, wenn
die Raͤder zum Tragen schwerer Lasten bestimmt sind, fest in die Ausschnitte
der Nabe und der Felge gedruͤkt werden, oder man kann die Felgen erhizen und
sie dann nach der gewoͤhnlichen Methode uͤber den Scheiben sich
zusammenziehen lassen. Die Scheiben werden uͤberdieß durch vier oder mehr
Bolzen F je nach der Groͤße der Raͤder
befestigt; diese Bolzen gehen durch die vorspringenden Raͤnder der Nabe; eben
so sind die Scheiben auch durch einige Bolzen an dem Reife befestigt.
Fig. 6 zeigt
eine andere Verfertigungsmethode dieser Raͤder, woraus man ersehen wird, daß
an die Nabe A nur ein einziger vorspringender Rand
gegossen ist, dessen aͤußere Seite parallel zur Aufnahme des getrennten
Randstuͤkes G, welches genau ausgebohrt ist, und
an welches eine der Scheiben gebolzt wird, abgedreht ist. Dieses Stuͤk G wird, nachdem es mit seiner Scheibe auf die Nabe
gelegt worden ist, mit den Spannschrauben H, die durch
dasselbe und den vorspringenden Rand D gehen, so
angezogen, daß der Umfang der Scheiben sich in inniger Beruͤhrung mit der
inneren Oberflaͤche der zu deren Aufnahme abgedrehten Felge befindet.
Uebrigens kann das einzelne Stuͤk mit seiner Scheibe auch nach der oben
beschriebenen Methode mit Bolzen befestigt werden. Um dasselbe mit der Scheibe an
der Nabe zu befestigen, ist auch ein kleiner Zapfen angebracht.
Man wird aus der Zeichnung ersehen, daß die abgebildeten Felgen oder Reifen
fuͤr Eisenbahnen eingerichtet sind; aber der Patenttraͤger
beschraͤnkt sich nicht hierauf allein, sondern haͤlt es fuͤr
vortheilhaft auch die Raͤder fuͤr Karren, Wagen und Kutschen nach
demselben Principe zu bauen. Die Formen, Dimensionen und Materiale der Naben,
Scheiben und Felgen, so wie die Verbindungsweise derselben, koͤnnen je nach
dem einzelnen Zweke, zu welchem sie bestimmt sind, und je nach der Abnuͤzung,
der sie ausgesezt sind, verschieden abgeaͤndert werden. Fuͤr
Raͤder von sehr großem Durchmesser, fuͤr welche man sich nicht wohl ganze
Eisenplatten von gehoͤriger Groͤße verschaffen kann, kann man diese
Scheiben wohl auch aus mehreren Platten zusammennieten.
Tafeln