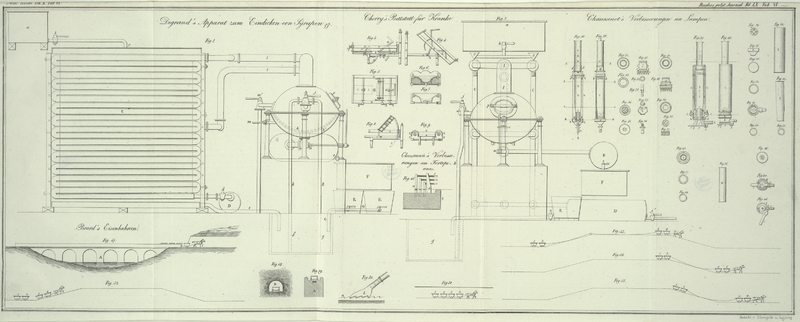| Titel: | Ueber den von Herrn E. Degrand erfundenen Apparat zum Eindiken von Syrupen und zukerhaltigen Säften bei niedriger Temperatur. |
| Fundstelle: | Band 60, Jahrgang 1836, Nr. LXVIII., S. 354 |
| Download: | XML |
LXVIII.
Ueber den von Herrn E. Degrand erfundenen Apparat zum Eindiken von
Syrupen und zukerhaltigen Saͤften bei niedriger Temperatur.
Aus dem Recueil industriel, Januar und Februar
1836.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Degrand's Apparat zum Eindiken und Versieden der
Syrupe.
Wir beginnen die ausfuͤhrlichere Mittheilung, die wir uͤber den mit
Recht gepriesenen Apparat des Hrn. Degrand machen wollen,
mit einer Beschreibung desselben, der wir dann Bemerkungen uͤber die
Vortheile, die er gewaͤhrt, folgen lassen wollen.Es ist dieß derselbe Apparat, auf welchen die Bruͤder Reybaud von Marseille im Jahre 1834 in Frankreich
ein Patent erhielten. A. d. R.
Die Verdampfung der zukerstoffhaltigen Fluͤssigkeiten wird in dem aus zwei
Halbkugeln bestehenden Kessel A vorgenommen. Der zur
Erhizung dienende Dampf circulirt in einem doppelten Boden und in einem
Schlangenrohre: dieses Heizsystem ist durch h, h' in
Fig. 1
angedeutet.
Die Austreibung der atmosphaͤrischen Luft geschieht mittelst eines
Dampfstromes. Sobald man naͤmlich die Haͤhne m und j' oͤffnet, fuͤhrt der
Dampf, welcher in den geschlossenen Kessel eintritt, und der nachdem er den Kessel,
den Verdichter C und den an dessen Ende befindlichen
Cylinder D durchstroͤmt hat, bei j' in die atmosphaͤrische Luft austritt, die in
dem Apparate enthalten gewesene Luft mit sich fort. Ist die Luft ausgetrieben, so
schließt man m und j', und
oͤffnet dafuͤr b, wo dann die in a enthaltene Fluͤssigkeit auf den Condensator zu
fließen und den luftleeren Raum zu erzeugen beginnt. Bald darauf saugt man in den
Kessel A den einzudikenden oder zu versiedenden Syrup,
indem man zu diesem Behufe den Hahn j oͤffnet,
damit man je nach Belieben aus dem Behaͤlter f
oder g schoͤpfen kann. Deutet das in den Kessel
gebrachte Niveau an, daß der Eintrag vollkommen geschehen ist, so unterbricht man
den Syrupzufluß, indem man den Hahn j schließt. Bevor
jedoch der Eintrag noch vollendet ist, oͤffnet man die beiden Haͤhne
m, m', um den zur Erhizung dienenden Dampf in den
Heizapparat eintreten zu lassen. Der im Kessel enthaltene Saft oder Syrup beginnt
dann zu sieden, sobald dessen Temperatur der Spannung des Dampfes das Gleichgewicht
haͤlt.
Gesezt nun der Saft befinde sich im Sude, so werden die von ihm ausgestoßenen
Daͤmpfe durch die Roͤhren l, l in den
Verdichter
C gefuͤhrt, der aus zwei horizontalen
Roͤhrensystemen besteht, an welchem sich die im Zigzag laufenden und durch
Kniee verbundenen Roͤhren in einer senkrechten Flaͤche befinden. In
diesen Roͤhren circuliren die in dem geschlossenen Kessel erzeugten
Daͤmpfe, um an deren innerer Oberflaͤche abgekuͤhlt und
verdichtet zu werden. Wir nennen uͤbrigens diese Vorrichtung nicht nur den
Verdichter, sondern wegen einer anderen Function, die sie, wie wir gleich zeigen
werden, gleichzeitig vollbringt, auch einen Verdampfer, Condensateur-évaporateur.
Bei a befindet sich ein Behaͤlter, welcher mit
gelaͤutertem Safte gespeist wird. Die Roͤhre b, durch welche der Saft aus diesem Behaͤlter in die beiden
Trichter c abfließt, ist zum Behufe der Regulirung
dieses Abflusses mit einem Hahne versehen. Von diesen beiden Trichtern ist
uͤber jedem der beiden Roͤhrensysteme, und in einer und derselben
Flaͤche mit ihnen je einer angebracht. Sie dienen dazu den Saft, der ihnen
aus dem Behaͤlter a zufließt, gleichmaͤßig
auf der ganzen Oberflaͤche der ersten Roͤhre des zu ihnen
gehoͤrigen Roͤhrensystemes zu vertheilen. Von dieser ersten
Roͤhre gelangt der Saft auf die Oberflaͤche der zweiten; von dieser
auf die dritte u.s.f. bis er endlich die unterste Roͤhre erreicht hat: so
zwar, daß saͤmmtliche Roͤhrenoberflaͤchen bestaͤndig mit
zufließendem Safte benezt sind, waͤhrend das Innere der Roͤhren mit
den in dem Kessel entwikelten Daͤmpfen erfuͤllt wird.
Aus dieser Einrichtung, deren Idee wir Hrn. Charles Derosne verdanken, ergibt sich, daß waͤhrend im Inneren dieses
Apparates die Abkuͤhlung und Verfluͤssigung der Daͤmpfe von
Statten geht, auf der aͤußeren Oberflaͤche der Roͤhren eine
Verduͤnstung vorgeht, durch welche dem Safte eine Quantitaͤt Wasser
entzogen wird, die dem Gewichte nach beinahe den im Inneren verfluͤssigten
Daͤmpfen gleichkommt. Man erzielt demnach durch diese Einrichtung ohne alle
Vermehrung des Bedarfes an Brennmaterial eine Verdoppelung des Nuzeffectes.
Der Saft gelangt, nachdem er in dem eben beschriebenen Apparate eine beginnende
Concentration oder Eindikung erlitten, auf eine schiefe Flaͤche, von der er
durch die Roͤhre e in den Behaͤlter f fließt, um aus diesem durch Aufsaugung zur Speisung
des Kessels verwendet zu werden. Da ferner die unterste Roͤhre des Apparates
mit dem Cylinder D communicirt, so sammelt sich das
Wasser, welches durch Verduͤnstung der Daͤmpfe an der inneren
Oberflaͤche der Roͤhren entsteht, in diesem Cylinder. Dieses Wasser
wird nach Belieben entfernt oder abgelassen, ohne daß man deßhalb Luft in den
Apparat eindringen laͤßt, und ohne daß dadurch der Verdampfungsproceß in dem Kessel und auf
dem Condensator unterbrochen wuͤrde. Man laͤßt zu diesem Endzweke,
nachdem man den Hahn d geoͤffnet, von dem
Dampferzeuger her einen Dampfstrom in den Cylinder D
treten, und man oͤffnet den Abflußhahn j' dieses
Cylinders, gleichsam als wollte man die Luft aus demselben austreiben. Ist das
Wasser auf diese Weise entfernt worden, so verschließt man den zum Wasserabflusse
und den zur Dampfeinleitung dienenden Hahn, und oͤffnet dafuͤr wieder
den Hahn d.
Fuͤr den Fall, daß der Versieder unterlassen haͤtte zur
gehoͤrigen Zeit Butter oder irgend einen anderen fetten Koͤrper in die
der Verdampfung ausgesezte Fluͤssigkeit zu bringen; oder wenn diese
Fluͤssigkeit viel Gas enthielte, so daß ein tumultuarisches Aufsieden
entstuͤnde, welches weder durch Eintragen eines Fettes, noch auch durch
Ermaͤßigung der Heizung bemeistert werden koͤnnte, wuͤrde Syrup
aus dem Kessel hinaus geschleudert werden. Dieser Syrup wuͤrde sich jedoch
mit etwas Wasser verduͤnnt in dem Cylinder D
ansammeln. Dieser Cylinder dient uͤbrigens auch noch zu einem anderen Zweke.
Wenn naͤmlich waͤhrend einer Operation aus irgend einem Grunde etwas
Luft in den Apparat eindringt, so wird diese Luft, durch den in den Roͤhren
circulirenden Dampf gegen diesen Cylinder gefuͤhrt; und da dieser Cylinder
einen bedeutenden Theil des ganzen Rauminhaltes des Apparates bildet, so erhellt
offenbar, daß wenn man die Luft aus dem Cylinder austreibt, die Gesammtmenge der in
dem Apparate enthaltenen Luft dadurch in bedeutendem Maaße verringert wird; so zwar,
daß wenn zufaͤllig eine groͤßere Menge Luft in den Apparat
eingedrungen waͤre, durch mehrfache Wiederholung der eben angegebenen
Operation wieder der fruͤhere luftleere Raum hergestellt werden
koͤnnte, ohne daß deßhalb die Verduͤnstung eine Unterbrechung erlitte,
und ohne daß in die Fluͤssigkeit, welche verdampft wird, Wasser
eingefuͤhrt wuͤrde.
Unter dem Kessel A befindet sich ein Cylinder B, der zur Aufnahme jenes Saftes, welcher in dem Kessel
vollkommen concentrirt, oder jenes Syrupes dient, der hinreichend versotten worden
ist. An der Roͤhre, welche die Verbindung zwischen dem Kessel und dem
Cylinder vermittelt, ist ein Hahn angebracht, damit die Communication zwischen
diesen beiden geschlossenen Gefaͤßen nach Belieben hergestellt oder
unterbrochen werden kann. Dieser Hahn wird geschlossen, wenn man die Luft aus dem
Apparate austreiben will, und daher wird der Cylinder B
nicht durch dieselbe Operation luftleer gemacht. Dafuͤr sind aber zu diesem
Zweke eigens fuͤr ihn bestimmte Vorrichtungen vorhanden: d.h. ein Hahn, durch
welchen nach Belieben Dampf von dem Dampferzeuger her einstroͤmen kann, und
ein zur Entleerung dienender Hahn. Der Cylinder B kann demnach nach
Belieben von der in ihm enthaltenen Luft befreit werden, ohne daß deßhalb der Dienst
des Abdampfkessels unterbrochen wuͤrde.
Dieses Austreiben der Luft geschieht auch wirklich waͤhrend der Concentration
oder waͤhrend des Versiedens. Ist das Versieden beendigt und soll der Kessel
entleert werden, so schließt man die beiden Haͤhne m,
m', und oͤffnet dafuͤr den Hahn n; waͤhrend man zugleich zur Herstellung des Gleichgewichtes der
Spannung im Kessel und im Cylinder einen Hahn oͤffnet, der an einer
Roͤhre angebracht ist, welche von dem obersten Theile des Cylinders
auslaͤuft, und sich in eine der Roͤhren l
endigt, die vom Kessel an den Verdichter laufen. Auf diese Weise laͤßt sich
der Abdampfkessel entleeren, ohne daß deßhalb in den ganzen Apparat Luft eintritt;
und hieraus folgt, daß man unmittelbar nach erfolgter Entleerung einen neuen Eintrag
aufsaugen kann. Es findet demnach kein Zeitverlust Statt; alle Operationen folgen
ohne Unterbrechung auf einander, und deßwegen nennen wir den Cylinder B auch Cylindre de
continuité.
Diese Eigenschaft des Apparates waͤre, wenn sie auch keine andere, als die
eben angedeutete Function leistete, von großem Nuzen; sie hat aber auch noch eine
andere Wirkung, welche besonders fuͤr die Raffinerien von großer Wichtigkeit
ist: sie erleichtert naͤmlich die Granulation oder Koͤrnung.
Der so eben beschriebene Apparat eignet sich ganz besonders auch fuͤr die
Runkelruͤbenzuker-Fabrication. Da die beiden Roͤhrensysteme von
allen Seiten zugaͤngig sind, so kann der Fabrikant die erste Eindikung des
Saftes nach Belieben leiten. In den Raffinerien hingegen, wo nur Wasser auf den
Verdichter gegossen wird, ist dieß nicht durchaus noͤthig, und daher wendet
Hr. Degrand an diesen als Verdichter auch nur ein
Schlangenrohr an, welches in einem langen, oben und unten offenen Fasse
untergebracht ist. Die Ersparniß an Wasser ist bei dieser Einrichtung so bedeutend,
daß das Wasser, welches durch die Verdichtung der aus dem geschlossenen Kessel
entwikelten Daͤmpfe gewonnen wird, hinreicht; denn obschon dieses Wasser, da
es sogleich emporgepumpt wird,Das Wasser steigt in einer Huͤlle, die die Roͤhre, in der die
Daͤmpfe von dem Kessel in den Verdichter stroͤmen, umgibt,
empor, um dann aus dieser Huͤlle in den Trichter uͤberzugehen.
A. d. O. lauwarm in den uͤber dem Verdichter angebrachten Trichter gelangt, um
aus diesem in Regengestalt auf die neue Art von Verdichter herabzufallen, so wird
hiedurch doch die Verdichtung der Daͤmpfe mit groͤßter
Regelmaͤßigkeit bewirkt.
Wir haben in der Zeichnung zur Vermeidung von Verwirrung nicht alle zu dem neuen
Apparate gehoͤrigen Theile angegeben, und begnuͤgen uns damit noch zu
bemerken, daß der Cylinder D mit einem Manometer
versehen ist, der den Unterschied andeutet, welcher zwischen dem Druke der
atmosphaͤrischen Luft und der Spannung des in dem Apparate enthaltenen
Gemenges aus Luft und Dampf besteht. Eben so muͤssen wir bemerken, daß an dem
Kessel A noch angebracht sind: 1) ein Thermometer, der
die Temperatur andeutet, bei welcher die Verdampfung geschieht; 2) ein Butterhahn;
3) Fenster, bei denen man in den Kessel sehen kann, um zu beobachten was darin
vorgeht; 4) ein Loch zum Einsteigen, damit man die obere Halbkugel nicht abzunehmen
braucht, wenn etwas im Kessel zu thun ist; 5) ein Hahn zum Nehmen von Proben,
welcher Hahn einfacher ist, als die Sonden und Pumpen.
Der Degrand'sche Apparat verdichtet und kuͤhlt
demnach die Daͤmpfe, welche sich beim Eindiken und Versieden aus dem Kessel
entwikeln, oder mit anderen Worten, er bewirkt und unterhaͤlt den luftleeren
Raum durch Verduͤnstung und Ventilation, waͤhrend die Apparate von Howard, Roth, Pelletan und Trappe dieselbe Wirkung durch Vermengung von kaltem Wasser mit den
Daͤmpfen erzeugen. An ersterem wirken die Kuͤhlmittel lediglich auf
die aͤußere Oberflaͤche des Verdichters, waͤhrend an den
uͤbrigen die Verdichtung im Inneren des Verdichters bewirkt wird. An ersterem
hilft die atmosphaͤrische Luft mit zur Erzielung des Nuzeffectes,
waͤhrend an den uͤbrigen die Luft dem Nuzeffect Eintrag thut, so daß
man, da man deren Eindringen nicht verhuͤten kann, gezwungen ist sie
auszutreiben.
Wir wollen nun zur Eroͤrterung der Vortheile uͤbergehen, welche der Degrand'sche Apparat gewaͤhrt, und fuͤhren
hiebei an der Spize folgende Stellen an, die wir aus einem Berichte, den die HH. Arago, Dulong und Dumas der
Akademie in Paris uͤber diesen Gegenstand erstatteten, entnehmen.
„Der Apparat besteht aus einem geschlossenen Kessel und einem
Condensator ohne Luftpumpe; der Condensator ist von neuer Art, und bietet Alles
dar, was man in den Kuͤnsten eine Erfindung und zwar eine sehr wichtige
Erfindung zu nennen pflegt. Der Apparat verzehrt kein Wasser; oder richtiger
gesprochen: die Verdampfung wird in dem Kessel durch Verduͤnstung einer
geringeren Menge Wasser unterhalten, als jene ist, welche den zu verdichtenden
Dampf erzeugt, weil zu dieser Verdichtung alle jene Waͤrme benuzt wird,
welche durch die Luft, die in raschem Strome durch die Verdichtungsroͤhre
streicht, entzogen wird. Man kann demnach diesen Apparat selbst in solchen
Localitaͤten benuzen, in welchen man sich der Apparate Howard's und Roth's wegen Wassermangel
nicht bedienen kann.“ Diese Angaben sind so wahr und richtig, daß in
den Raffinerien von Hrn. Guillon und Hrn. Ferat in Paris, so wie in jenen der Bruͤder Reybaud und der HH. Tiers,
Gavot und Callaman in Marseille, das Wasser,
welches durch Verdichtung der aus dem geschlossenen Kessel emporsteigenden
Daͤmpfe gewonnen wird, mehr als hinreichend ist, um den Apparat in Gang zu
erhalten.
Dem Degrand'schen Apparate kommen ferner auch noch
folgende Vorzuͤge vor allen uͤbrigen bisher bekannt gewordenen und mit
dem luftleeren Raume arbeitenden Apparaten zu: 1) ist der geschlossene Kessel mit
Fenstern ausgestattet, durch welche man den Gang des Versiedens des Syrupes und des
Saftes beobachten kann. Hr. Pelletan bedient sich mit
Unrecht aͤhnlicher Fenster; denn sein Patent ist um 6 Monate juͤnger,
als jenes der HH. Reybaud und Degrand. 2) befindet sich an demselben ein Behaͤlter, der zur
Aufnahme des versottenen Syrupes dient, und in welchen dieser abfließen kann, ohne
daß deßhalb in den ganzen Apparat Luft eindringt. Die Folge hievon ist, daß mehrere
Operationen ohne Unterbrechung auf einander folgen koͤnnen, und daß sich in
den Raffinerien die Wiedererwaͤrmung leicht leiten laͤßt. 3) endlich
ist an demselben auch noch fuͤr eine Vorrichtung gesorgt, womit man ohne
Unterbrechung des Versiedens die Luft aus dem Apparate austreiben kann, und welche
auch zum Aufsaugen des Syrupes dient, der bei großer Nachlaͤssigkeit des
Versieders allenfalls aus dem Kessel geschleudert wird. An den anderen
aͤhnlichen Apparaten geht der Zuker in dem Verdichter in eine zu große Menge
Wassers uͤber, als daß er mit Vortheil daraus gewonnen werden
koͤnnte.
Der Degrand'sche Apparat bedingt ferner eine bedeutende
Ersparniß an Brennmaterial, und diese zeigt sich hauptsaͤchlich bei der
Runkelruͤbenzuker-Fabrication, bei der man mit Benuzung einer von Derosne angegebenen Verbesserung mit einer einfachen
Ausgabe an Brennmaterial einen doppelten Nuzeffect erzielen kann. Diese Verbesserung
besteht in der Anwendung der in dem Degrand'schen
Verdichter circulirenden Waͤrme, um damit die Concentration der zukerhaltigen
Saͤfte bei freier Luft und niedriger Temperatur zu beginnen. Der Raffineur,
der sich des Degrand'schen Apparates bedient,
laͤßt Wasser auf den Verdichter fließen; der Zukerfabrikant hingegen nimmt
statt des Wassers Saft. Ersterer benuzt also die in dem Verdichter circulirende
Waͤrme nicht, weil er damit Wasser ohne Nuzen verdampft; der Fabrikant
hingegen benuzt sie, indem er durch sie eine Concentration des Syrups bewirkt. Da
nun diese leztere
Verduͤnstung beinahe jener gleich ist, welche in dem geschlossenen Kessel vor
sich geht, so bezwekt der Fabrikant mit einem einzigen Feuer einen beinahe doppelten
Nuzeffect. Der Unterschied, welcher sich hieraus fuͤr eine Fabrik ergibt, die
taͤglich mit 300 Hectolitern gelaͤuterten Saftes von 4°, 5
arbeitet, ist enorm.
Wir haben berechnet, daß eine solche Fabrik, welche mit einem Apparate von Howard, Roth, Pelletan oder Trappe arbeitet, zur Verdampfung taͤglich 5520 Kil. Kohlen
verbrauchen wuͤrde, und zwar abgesehen von der Erzeugung an Dampf, welche
fuͤr die Luftpumpe oder an jenen Apparaten, die mit keiner solchen
ausgestattet sind, zum Austreiben der Luft erforderlich waͤre. Die Summe der
Ersparniß an Brennmaterial, welche Degrand's Apparat im
Vergleiche mit den uͤbrigen mit luftleerem Raume arbeitenden Apparaten
gewaͤhrt, betraͤgt daher taͤglich 3400 Kil. Wir wollen dieß
durch numerische Daten nachweisen. Der Howard'sche
Apparat braucht, wie gesagt, zur Verdampfung 5520 Kil.; hiezu 1280 Kil. fuͤr
den Betrieb der Luftpumpe, gibt in Summa 6800 Kil. Der Roth'sche Apparat braucht einerseits 5520 Kil., andererseits 1104 Kil., in
Summa also 6624 Kil. Das Mittel fuͤr beide Apparate betraͤgt demnach
6700 Kil.
Mit dem Degrand'schen Apparate dagegen ergibt sich
folgendes Resultat. Wenn auf dem Heerde des Dampferzeugers 3067 Kil. Kohlen
verbrannt werden, so wird nach den gewoͤhnlichen Annahmen fuͤnf Mal so
viel Wasser, d.h. 15,335 Kil. verdampft. Dieser Dampf circulirt in den
Schlangenroͤhren und in dem doppelten Boden des geschlossenen Kessels, wo er
sich verdichtet und dann wieder in den Dampferzeuger zuruͤkkehrt. Diese
Verdichtung kann aber nur geschehen, indem der Dampf den Syrupen, welche die
Schlangenroͤhren und den geschlossenen Kessel umfließen, auch wieder 15,335
Wasser entzieht. Dieß ist also der erste Nuzeffect. Die 15,335 Kil. Dampf, welche
die in dem geschlossenen Kessel enthaltenen Saͤfte oder Daͤmpfe
ausstoßen, verfluͤssigen sich an der inneren Oberflaͤche der
Roͤhren des Verdichters, und diese Verdichtung bewirkt ihrerseits au der
aͤußeren Oberflaͤche der Roͤhren die Verdampfung eines
Gewichtes, welches dem Gewichte der in dem geschlossenen Kessel erzeugten
Daͤmpfe beinahe gleichkommen wuͤrde, wenn nicht ein Theil des
Waͤrmestoffes an den aufsteigenden auf die Roͤhren wirkenden Luftstrom
abgegeben wuͤrde. Nach den von Derosne
angestellten Versuchen betraͤgt die auf diese Weise zur Verdampfung benuzte
Waͤrme mehr als 4 Fuͤnftheile des Ganzen. Nehmen wir jedoch nur 4
Fuͤnftheile an, so bedingt die Verdichtung der 15,335 Kil. Dampf, welche im
Inneren des Verdichters circuliren, auf dessen aͤußerer Oberflaͤche immer noch
eine Verduͤnstung von 12,265 Kil. Wasser, welche mithin dem Safte zum Behufe
seiner Eindikung entzogen werden. Dieß ist der zweite Nuzeffect. Es werden demnach
mit 3067 Kil. Kohlen, die auf dem Heerde des Dampferzeugers verbrannt werden, 15,335
Kil. Wasser im Kessel und 12,265 Kil. auf dem Verdichter verfluͤchtigt, was
in Summa 27,600 Kil. oder 276 Hectoliter gibt. Oder mit anderen Worten: der Degrand'sche Apparat entzieht den Syrupen oder
zukerhaltigen Saͤften mit einem Verbrauche von 3067 Kil. Kohlen eben so viel
Wasser, als die uͤbrigen mit dem luftleeren Raume arbeitenden Apparate mit
einem Verbrauche von 5520 Kil. zu entziehen im Stande sind.
Nach diesen Berechnungen verzehrt der Degrand'sche Apparat
fuͤr Verdampfung 3067 Kil. und zur Austreibung der Luft 233 Kil.: in Summa
3300 Kil. Kohlen. Da der taͤgliche Verbrauch der uͤbrigen Apparate
dagegen im mittleren Durchschnitte 6700 Kil. betraͤgt, so ergibt sich mit
ersterem ganz richtig eine taͤgliche Ersparniß von durchschnittlich 3400
Kil.
Was die Kosten der ersten Anschaffung betrifft, so ergibt sich auch hier wieder
daraus, daß man mit einem einzigen Feuer einen doppelten Nuzeffect zu erzielen im
Stande ist, eine bedeutende Ersparniß; denn, man braucht entweder mehrere oder
groͤßere Howard'sche, Roth'sche, Pelletan'sche oder Trappe'sche Apparate, um mit diesen dasselbe zu leisten,
wie mit dem Degrand'schen. Es kommt naͤmlich
hiebei zu betrachten: 1) die eigentlichen Anschaffungskosten; 2) die Kosten der zum
Dienste dieses Apparates gehoͤrigen Dampferzeuger; und 3) die Kosten der
Aufstellung des Apparates.
Was erstere betrifft, so kostet ein Roth'scher Apparat von
zweiter Groͤße mit einem Kessel von 5 Fuß, womit man in 24 Stunden 150 bis
160 Hectoliter Saft verarbeiten kann, ein fuͤr alle Mal 17,000 Fr.
Fuͤr eine Fabrik, welche taͤglich mit 300 Hectolitern Saft arbeitet,
sind zwei solche Apparate erforderlich, die eine Summe von 34,000 Fr. kosten.
Ein Degrand'scher Apparat von erster Groͤße dagegen
mit einem Kessel von 5 Fuß, wie ihn eine Runkelruͤbenzuker-Fabrik
braucht, die taͤglich mit 300 Hectoliter Saft arbeitet, kostet nur 17,000 Fr.
Rechnet man hiezu noch drei Annuitaͤten, jede zu 1750 Fr., so gibt dieß eine
baare Summe von 4700 Fr., welche bei der Ablieferung bezahlt wird. Die Gesammtkosten
belaufen sich daher hier auf 21,700 Fr., und ergeben also zu Gunsten des Degrand'schen Apparates eine Summe von 12,300 Fr.
Was die Dampferzeuger betrifft, so muͤssen sie, sie moͤgen fuͤr
den Dienst eines Degrand'schen oder eines Roth'schen Apparates bestimmt seyn, nicht bloß zur
Eindikung des Saftes, zum Versieden des Syrupes und zur Austreibung der Luft aus dem
Apparate Kohle verbrennen; sondern auch noch zum Behufe der Laͤuterung und
Klaͤrung. Da diese beiden Operationen an freier Luft geschehen, und folglich
einen Dampf von 135° bis 140° des hundertgraͤdigen Thermometers
erfordern, so bedient man sich gewoͤhnlich der Dampferzeuger mit hohem Druke
oder mit einem Druke von 5 Atmosphaͤren.
In einer Fabrik, welche taͤglich 300 Hectoliter Saft verarbeitet, muß man
diesen zum Behufe der Laͤuterung bis zur Siedhize erwaͤrmen, und
uͤberdieß 92 Hectoliter Syrup zum Behufe der Klaͤrung sieden; auch muß
man diese 392 Hectoliter Saft und Syrup eine kurze Zeit uͤber siedend
erhalten: ein Waͤrmeeffect, welcher nach den gewoͤhnlichen Annahmen
zusammen einer Verdampfung von 80 Hectolitern Wasser oder der Verbrennung von 1600
Kil. Kohlen gleichkommt.
Dieser Verbrauch trifft sowohl den Roth'schen, als den Degrand'schen Apparat; allein lezterer verbrennt zum
Behufe der Eindampfung der Saͤfte und der Syrupe, so wie zum Behufe des
Austreibens der Luft, nur 3300 Kil. Kohlen, waͤhrend ersterer ihrer 6624 Kil.
verzehrt. Die Dampferzeuger, welche zum Betriebe der zwei Roth'schen Apparate noͤthig sind, deren eine taͤglich 300
Hectoliter Saft verarbeitende Fabrik bedarf, verbrennen demnach einerseits 1600 und
andererseits 6624 Kil., was zusammen fuͤr 24 Stunden einen Verbrauch von 8224
Kil. Kohlen gibt. Dieß gibt also 343 Kil. fuͤr die Stunde, und dieß
repraͤsentirt, 5 Kil. per Stunde auf eine
Pferdekraft gerechnet, Dampferzeuger, deren Totalkraft 68 Pferden gleichkommt. An
einem Degrand'schen Apparate erster Groͤße
dagegen, welcher denselben Nuzeffect gibt, wie zwei Roth'sche Apparate zweiter Groͤße, betraͤgt die unter den
Dampferzeugern verbrannte Quantitaͤt Kohlen einerseits 1600, und andererseits
3300 Kil., zusammen also 4900 Kil. Hienach kommen hier 204 Kil. auf die Stunde, und
dieß repraͤsentirt Dampferzeuger mit einer Totalkraft von 41 Pferden. Wenn
daher der Verbrauch der Dampferzeuger fuͤr den Degrand'schen Apparat durch die Zahl 41 ausgedruͤkt ist, so
betraͤgt diese Zahl fuͤr den Roth'schen
Apparat beilaͤufig 68. Da nun die Dampferzeuger fuͤr einen Degrand'schen Apparat, wie sie Hr. Ch. Derosne liefert, 12,000 Fr. kosten, waͤhrend sie
fuͤr zwei gleichviel leistende Roth'sche Apparate
auf 19,500 Fr. zu stehen kommen, so ergibt sich zu Gunsten des ersteren auch hierin
ein Vortheil von 7500 Fr.
Was endlich die Emballage, die Transport- und Aufstellungskosten, das Sezen
der Oefen und den Bau der Schornsteine betrifft, so sind auch diese um so
geringer, je leichter und kleiner die Dampferzeuger sind. In dieser Hinsicht ergibt
sich abermal ein Vortheil zu Gunsten des Apparates des Hrn. Degrand, der sich im mittleren Durchschnitte auf 1200 Fr. anschlagen
laͤßt.
Faßt man alle diese Vortheile, die sich fuͤr eine Fabrik, welche
taͤglich 300 Hectoliter gelaͤuterten Saft von 4,5° in der
Waͤrme verarbeitet, durch die Anwendung des Apparates des Hrn. Degrand im Vergleiche mit dem Roth'schen ergeben, so erhaͤlt man die bedeutende Summe von 21,000
Fr.
Erklaͤrung der Kupfer.
A ist ein großer sphaͤrischer Kessel, welcher den
einzudikenden oder zu versiedenden Saft enthaͤlt.
B der continuirlich arbeitende Cylinder.
C die zur Verdichtung und zum Verdampfen dienende
Vorrichtung, welche aus zwei parallel angebrachten Roͤhrensystemen
besteht.
D der Cylinder, der zur Aufnahme des verdichteten
Wassers dient, und mit dessen Huͤlfe man auch die Luft aus dem Apparate
austreiben kann, ohne daß man neuerdings wieder einen luftleeren Raum zu erzeugen
braucht.
a der Behaͤlter fuͤr den
gelaͤuterten Saft.
b eine Roͤhre mit einem Hahne, der zur Regulirung
des Abflusses des Saftes auf den Verdichter C dient.
c ein Trichter, zur regenartigen Vertheilung des Saftes.
d Haͤhne, womit man die Communication
zwischen C und D nach
Belieben unterbrechen kann.
e eine Roͤhre, die den uͤber den
Verdichter C gelaufenen Saft in den Behaͤlter f leitet, von wo er dann zur Speisung des geschlossenen
Kessels aufgesogen wird.
g ein Behaͤlter, in welchen der Syrup nach der
Filtration zu 20° am Araͤometer gelangt.
h, h' das Heizsystem, welches aus einem Schlangenrohre
und einem doppelten Boden besteht.
j ein Saughahn, welcher zum Behufe der Speisung des
Kessels mit den Roͤhren k, k bald in dem
Behaͤlter f, bald in dem Behaͤlter g Saft aufsaugt.
j' der Entleerungshahn fuͤr den Cylinder D.
m, m' Haͤhne, die den Dampf in den Heizapparat
h, h' leiten. Der Hahn m' ist so eingerichtet, daß er nach Belieben in daß Schlangenrohr h oder in den Kessel A Dampf
eintreten laͤßt, je nachdem dieser zum Heizen oder zum Austreiben der Luft
verwendet werden soll.
n ein Hahn, mit dessen Huͤlfe der Kessel A in den Cylinder B entleert
werden kann.
o ein Hahn zur Entleerung des Cylinders B dienend.
p ein Loch, durch welches im Nothfalle in den Kessel A eingestiegen werden kann.
Um die Zeichnung nicht zu verwirren, wurden an dem geschlossenen Kessel die Fenster,
der Thermometer, der Probirhahn, der Oehl- oder Butterhahn, und an den
Cylindern B und D die
Dampfroͤhre und der Lufthahn weggelassen. Eben so gehoͤrt an den
Cylinder D auch noch ein Manometer.
Zu den Nebentheilen, welche nicht eigentlich zu dem Apparate selbst zu zaͤhlen
sind, gehoͤren:
E die Dumont'schen
Filtra.
F der Behaͤlter fuͤr den eingedikten
Syrup.
G eine Roͤhre mit einem Hahne, die den filtrirten
Syrup von E in g leitet.
––––––––––
Wir wollen der Beschreibung, welche wir von dem Degrand'schen Apparate zum Eindiken und Versieden der SyrupeWir finden uns vorzuͤglich wegen dem großen Anklang, den die
Runkelruͤbenzuker-Fabrication nunmehr endlich auch in
Deutschland findet, veranlaßt, der Beschreibung des Degrand'schen Apparates auch die Vergleichung desselben mit den
aͤlteren aͤhnlichen Apparaten nachzutragen.A. d. R. gegeben haben, nunmehr auch eine Vergleichung desselben mit den
uͤbrigen, auf demselben Systeme, d.h. auf Verdampfung bei niederer Temperatur
beruhenden Apparaten nachschiken. Alle diese uͤbrigen Methoden wirken mehr
oder minder nachtheilig auf den Zuker, und werden daher gewiß von allen Fabrikanten
aufgegeben werden, wenn sie zur Einsicht ihrer wahren Interessen gekommen sind, und
wenn sie die zur Vornahme der Veraͤnderungen noͤthigen Capitalien
besizen.
Howard's Apparat. Der Erfinder des neuen Systemes, zu
welchem der beschriebene Degrand'sche und alle
uͤbrigen hier zu erwaͤhnenden Apparate gehoͤren, ist Hr. Howard.Man sehe uͤber die Howard'sche Methode
Polyt. Journal Bd. XIX. S. 376, Bd. XXVI. S. 425, Bd. XXVII. S. 30 und S. 125, Bd. XXIX. S. 275 und Bd. XXXIV. S. 197.A. d. R. Der von ihm ausgedachte Apparat besteht: 1) aus einem geschlossenen Kessel
mit doppeltem Boden, welcher von dem in diesem doppelten Boden circulirenden Dampfe
geheizt wird; 2) aus einem Verdichter; und 3) aus einer Luftpumpe. Die aus dem
Syrupe emporsteigenden Daͤmpfe vermengen sich in dem Verdichter mit einem
Strahle kalten Wassers, wodurch sie verdichtet werden. Das hiedurch entstehende
lauwarme Wasser
wuͤrde den Verdichter in Kuͤrze erfuͤllen, wenn es nicht
ausgetrieben wuͤrde. Da das eingesprizte kalte Wasser Luft enthaͤlt,
und da sich diese Luft beim Eintritte des Wassers in den Apparat entbindet, so muß
nothwendig diese Luft entleert werden. Hr. Howard hat
daher seinen Apparat mit einer Luftpumpe ausgestattet, welche sowohl zum Austreiben
der Luft als zum Entfernen des lauen Wassers bestimmt ist. Diese Pumpe wird durch
eine Dampfmaschine in Bewegung gesezt; die Kraft, deren sie bedarf, ist um so
groͤßer, je mehr die Temperatur in dem Verdampfungskessel erniedrigt ist.
Dieser Apparat verbraucht eine so bedeutende Quantitaͤt Wasser, daß er sich
nur fuͤr solche Localitaͤten eignet, in welchen man uͤber
enorme Wassermassen verfuͤgen kann, und wo man alles Wasser, welches bereits
ein Mal gedient hat, immer ohne Nachtheil ausleeren lassen kann. Man kann sich einen
Begriff hievon machen, wenn man bedenkt, daß diese Quantitaͤt 18 Mal so groß
ist, als das Gewicht des in dem zu versiedenden Syrupe enthaltenen Wassers, so daß
eine Fabrik, welche taͤglich 300 Hectoliter gelaͤuterten Saftes von
4°,5 in der Waͤrme zu verdichten haͤtte, taͤglich
uͤber 5000 Hectoliter Wasser verbrauchen wuͤrde!
Roth's Apparat.Man findet uͤber diesen Apparat im Polyt. Journal Bd. XXXIII. S. 269 und Bd. LVII. S. 78 alle
Aufschluͤsse.A. d. R. Ein geschlossener Kessel mit doppeltem Boden und mit einem Verdichter bilden
auch hier die hauptsaͤchlichsten Theile. Die Heizung geschieht mittelst
Dampf, der in dem doppelten Boden in einem Schlangenrohre circulirt. Um die
Luftpumpe zu ersezen, kam Hr. Roth auf die Idee die Luft
und das lauwarme Wasser nach jeder Operation durch Dampf auszutreiben. Hieraus
folgt, daß sein Verdichter viel geraͤumiger und diker als der Howard'sche seyn muß, indem er allen Dampf, der sich
waͤhrend der Dauer der Operation verdichtet, und alle Luft, die sich aus dem
kalten Verdichtungswasser entwikelt, fassen muß. Die Weglassung der Luftpumpe macht
den Roth'schen Apparat allerdings einfacher; allein
dagegen geht an dem Howard'schen Apparate, wo das laue
Wasser und die Luft fortwaͤhrend abfließen, viel weniger Zeit verloren, als
an dem Roth'schen, an welchem der Wasserabfluß nur nach
jeder Operation Statt findet und jedes Mal 8 bis 9 Minuten Zeit braucht. –
Der Roth'sche Apparat konnte in seiner
urspruͤnglichen Einrichtung gleichfalls nur an solchen Orten angebracht
werden, an welchen man Wasser in Ueberfluß hatte, und wo man das Wasser des
Verdichters leicht abfließen lassen konnte. Spaͤter hingegen erfand Roth, in der Absicht sein System allen
Localitaͤten anzupassen, eine Methode, wonach das Wasser so abgekuͤhlt
werden kann, daß es sich
immer wieder benuzen laͤßt, oder daß wenigstens nur in mehr oder minder
großen Zwischenraͤumen eine Erneuerung desselben nothwendig wird. Diese
Methode hat man in Paris in der Fabrik des Hrn. Bayvet,
eines Associé Roth's, mit Vortheil befolgt. Das am
Ende einer jeden Operation abfließende Wasser gelangt in einen auf gewisser
Hoͤhe angebrachten hoͤlzernen Behaͤlter, in dessen Boden sich
zahlreiche kreisrunde Oeffnungen von beilaͤufig 3 Zoll im Durchmesser
befinden. An jeder dieser Oeffnungen ist ein an beiden Enden offener Schlauch aus
Leinen-, Wollen- oder Baumwollenzeug angebracht, welcher oben in einer
kupfernen, bis zur Hoͤhe des Randes des Behaͤlters emporreichenden
Roͤhre festgehalten ist, waͤhrend er unten durch einen bleiernen Ring
gespannt erhalten wird. An dem unteren Theile der kupfernen Roͤhren und in
der Naͤhe der Verbindung derselben mit den Schlaͤuchen sind an der
Oberflaͤche kleine kreisrunde Loͤcher angebracht, durch welche das
Wasser des Behaͤlters aussikert, welches bestaͤndig laͤngs der
Schlaͤuche herabfließt und dieselben uͤberall durch die
Capillaritaͤt befeuchtet. Es entsteht auf diese Weise an der
Oberflaͤche der Roͤhren eine Verduͤnstung und ein
emporsteigender Luftstrom, welcher die Abkuͤhlung der in den kupfernen
Theilen der Roͤhren enthaltenen Luftsaͤule beguͤnstigt. Man
kann nach dieser Methode, welche nur geringe Kosten veranlaßt, mit groͤßter
Geschwindigkeit jede beliebige Wassermenge, wie groß sie auch seyn mag, auf die
Temperatur der Luft, die sie umgibt, abkuͤhlen. Da sich der hoͤlzerne
Behaͤlter uͤber der Abflußoͤffnung fuͤr das heiße Wasser
befindet, so wird dieses durch den Druk des Dampfes, der am Anfange einer Operation
zur Erneuerung des luftleeren Raumes in den Apparat eingeleitet wird, in den
Behaͤlter getrieben.
Pelletan's Apparat.Man vergleiche hieruͤber Polyt. Journal Bd. LII. S. 408, Bd. LIII. S. 39 und S. 235, Bd. LVIII. S. 416.A. d. R. Auch dieser wird wie der Howard'sche mit Dampf
geheizt, der in dem doppelten Boden eines geschlossenen Kessels circulirt. Die
Luftpumpe ist hier gleichfalls weggelassen; die Verdichtung geschieht mittelst
fortwaͤhrender Einsprizung von kaltem Wasser. Anstatt jedoch die aus dem
Wasser sich entwikelnde Luft durch einen Dampfstrahl aus dem Apparate hinaus zu
treiben, wird hier der Dampfstrahl so geleitet, daß er die Luft mit sich aus dem
Apparat hinaus fuͤhrt. Es geht hier allerdings weniger Zeit verloren, als an
dem Roth'schen Apparate; allein die zum Austreiben der
Luft noͤthige Quantitaͤt Dampf ist beinahe eben so groß, als die zum
Betriebe der Howard'schen Luftpumpe erforderliche. Der
Verbrauch an Wasser ist zwar geringer, als an dem Roth'schen Apparate, aber immer noch so groß, daß auch diese Vorrichtung sich
nur fuͤr
solche Orte eignet, wo man Ueberfluß an Wasser hat. Dagegen hat man hier den
Nachtheil, daß der zur Heizung dienende Dampf einen Druk von 4 bis 5
Atmosphaͤren haben muß.
Trappe's Apparat, der von den HH. Trappe und Louvier Gaspard in einer Raffinerie
in Paris errichtet worden ist, arbeitet mit dem luftleeren Raume und ohne Luftpumpe.
Die Verdichtung geschieht durch eine innere Einsprizung von kaltem Wasser; allein
der Verdichter unterscheidet sich von den fruͤher angegebenen dadurch, daß er
sich in eine Torricellische Roͤhre von beilaͤufig 32 Fuß senkrechter
Hoͤhe endigt. Das laue Wasser wird durch diese Roͤhre in einen Graben
entleert, und der aus dem kalten Wasser entwikelten Luft entledigt man sich, indem
man auf dieselbe Weise, wie an dem Roth'schen Apparate,
Dampf in den Apparat treibt. Die Trappe'sche Vorrichtung
erfordert etwas weniger Dampf und etwas weniger Wasser, als die vorhergehenden; doch
ist der Verbrauch immer noch so groß, daß auch sie nur da anwendbar ist, wo man
einen Ueberfluß an Wasser hat, und wo man eine Roͤhre anbringen kann, die bis
auf 32 Fuß unter den Verdichter hinabreicht.
Brame's Apparat glauben wir gleichfalls im Detail
betrachten zu muͤssen, obgleich er eigentlich nicht, mit dem luftleeren Raume
arbeitet.Siehe Polyt. Journal Bd. LVII. S.
314.A. d. R. Wir halten dieß fuͤr um so nothwendiger, als bei der lezten
Industrieausstellung in Paris eine sehr gut gearbeitete Vorrichtung dieser Art zu
sehen war, und als diese sowohl auf die einfachen Liebhaber, als auf die Mechaniker
von Profession einen sehr guten Eindruk gemacht zu haben scheint; und als es mithin
von Nuzen seyn kann, wenn die Vortheile, die sie gewaͤhren kann, erwogen, und
untersucht wird, ob diese Vortheile groͤßer sind, als bei den fruͤher
aufgefuͤhrten Apparaten. Die Eindikung und das Versieden der Syrupe geschieht
hier durch Einblasen von heißer Luft in das Innere der Kessel, die durch Dampf,
welcher in Roͤhren circulirt, geheizt werden. Die Haupttheile, aus denen der
Apparat besteht, sind: 1) zwei Geblaͤspumpen, welche durch eine Dampfmaschine
in Thaͤtigkeit gesezt werden. 2) ein Luftheizer bestehend aus einem Cylinder,
in welchem eine gewisse Anzahl von Roͤhren enthalten ist. 3) Abdampfkessel,
welche dem Zutritte der Luft offen stehen. Die Pumpen saugen Luft ein und treiben
sie dann in den Cylinder, in welchem sie durch circulirenden Dampf erhizt wird,
bevor sie am Grunde der Kessel unter eine Platte gelangt, in der sich zum Behufe der
Vertheilung der Luft zahlreiche sehr kleine Loͤcher befinden. Die
Luftblaͤschen nehmen beim Emporsteigen durch den Syrup Feuchtigkeit auf, so daß die
Zukertheile nach und nach immer mehr und mehr concentrirt werden. Am Grunde der
Abdampfkessel sind Circulationsroͤhren angebracht, welche zur Aufnahme des
Dampfes, der zum Heizen und zum Verdampfen der Fluͤssigkeit dienen soll,
bestimmt ist. Man bedarf bei Anwendung dieser Vorrichtung keines kalten
Einsprizwassers, was allerdings von Vortheil ist; allein dieser Vortheil vermag die
Ersparniß an den Errichtungskosten, den geringeren Verbrauch an Brennmaterial, und
die groͤßere Guͤte der erzeugten Zuker, welche die mit dem luftleeren
Raume arbeitenden Apparate bedingen, nicht aufzuwiegen; besonders im Vergleiche mit
dem Degrand'schen Apparate, der nicht bloß kein kaltes
Wasser verbraucht, sondern sogar lauwarmes Wasser liefert.
Der unbestreitbare Vorzug, den die mit dem luftleeren Raume arbeitenden Apparate vor
dem von Hrn. Brame erfundenen und uͤbrigens
sinnreichen Systeme verdienen, wird fuͤr jeden Unparteiischen am offenbarsten
aus den Daten erhellen, die wir am Schlusse dieses Aufsazes in einer Tabelle
zusammengestellt haben. Eine Vergleichung saͤmmtlicher in dieser Tabelle
angegebener Resultate wird aber auch ganz zu Gunsten des Degrand'schen Apparates ausfallen; denn dieser allein laͤßt sich
unter allen Localverhaͤltnissen anbringen, was mit den Howard'schen und Roth'schen Vorrichtungen nicht
der Fall ist; er allein liefert Producte, welche allen Anforderungen, die man bei
dem gegenwaͤrtigen Zustande unserer theoretischen und praktischen Kenntnisse
an die Zukerfabrication machen kann, genuͤgen; er kommt uͤberdieß am
wohlfeilsten zu stehen, und zwar sowohl in Hinsicht auf die Anschaffungskosten, als
in Hinsicht auf die taͤglichen Betriebskosten.
Die Vortheile, die die Arbeit mit dem Degrand'schen
Apparate gewaͤhrt, werden noch weit groͤßer werden, wenn man ein Mal,
wie es zu erwarten steht, in den Fabriken statt der Presse, welcher man sich bisher
bediente, die Maceration in Anwendung bringt, bei der man nach wiederholt
angestellten Versuchen eine groͤßere Menge Zuker zu gewinnen im Stande ist.
Da naͤmlich bei dem Macerationsverfahren um 21 Proc. mehr Wasser verdampft
werden muß, als wenn das Runkelruͤbenmark in der Presse ausgepreßt worden
ist, so wuͤrde, wenn man sich hier des Howard'schen Apparates bedienen wollte, eine noch weit groͤßere Menge
Wasser erforderlich seyn, waͤhrend der Degrand'sche Apparat nur die durch das Macerations-Verfahren bedingte
Vermehrung des Wassers um 21 Proc. zu verdampfen hat.
Wir glauben diesen Aufsaz nicht besser schließen zu koͤnnen, als mit einer Bemerkung, welche Hr.
Degrand machte, und welche sich eben so gut auch auf
jeden anderen Industriezweig anwenden laͤßt.
„Wenn ein industrielles Verfahren ein gutes Resultat geben soll, so muß
dasselbe nicht nur an und fuͤr sich gut seyn, sondern der Fabrikant, der
es annahm, muß auch gelernt haben sich dessen zu bedienen; denn in diesem Tacte
und in den Handgriffen zeigt sich der große Unterschied zwischen den einzelnen
Menschen: es mag sich um ein neues Verfahren oder um Methoden handeln, welche
seit Jahrhunderten bekannt sind. Dieser Unterschied ist so groß, daß ein
gewandter Arbeiter mit schlechten Werkzeugen haͤufig besser arbeitet, als
ein minder gewandter mit den vollkommensten Instrumenten. Wenn man sich
bekannter Methoden bedient, so kann derjenige, der weniger Gutes vollbringt, nur
sich selbst anklagen; handelt es sich hingegen darum eine neue Erfindung in
Ausfuͤhrung zu bringen, so wird derjenige, dem dieß nicht unmittelbar
gelingt, natuͤrlich geneigt seyn zu glauben, daß der Fehler nicht in ihm,
sondern in der Erfindung selbst gelegen ist. Die Folge hievon ist dann, daß die
Gegner der neuen Sache dieses Nichtgelingen aufgreifen, um das gaͤnzliche
Mißlingen derselben auszuschreien und selbst die Unmoͤglichkeit des
Gelingens zu behaupten. So wie man aber die gewoͤhnlichen
Verfahrungsweisen nur durch Praxis und Uebung erlernt, eben so bedarf es auch
fuͤr die neuen Methoden einer Lehr- und Lernzeit: ja man
stoͤßt hier sogar auf zwei anstatt einer einzigen Schwierigkeit; denn man
ist gezwungen sich mancher Ansichten zu entledigen, die man bisher fuͤr
wahr und richtig gehalten, und dann erst neue Kenntnisse, der man bedarf, zu
erwerben.“
Die Société d'encouragement hat in
ihrer Generalversammlung vom 30. December 1835 Hrn. Degrand fuͤr den von ihm erfundenen Apparat den Preis von
4000 Fr. zuerkannt, den sie fuͤr den besten
Apparat zum Abdampfen von salz- oder zukerhaltigen oder anderen
Aufloͤsungen im luftleeren Raume ausgeschrieben hatte.
A. d. R.
Textabbildung Bd. 60, S. 370-371
Apparate; Mittlere Temperatur des
Herzkoͤrpers; Mittlere Temperatur der Verdampfung; Verbrauch an kaltem
Wasser in 24 Stunden; Verbrauch an Kohle in 24 St., die zur Laͤuterung u.
Klaͤrung erforderliche Quantitaͤt nicht mitgerechnet; Zur
Eindikung D. Saftes u. z. Versieden; Syrupes; Zur Erzeugung der Triebstoff; Zum
Austreiben der Luft; Zum Erhizen der Luft; Summa; Kosten d. Brennmaterials
fuͤr d. Dienst Apparates p. Campagne, d. Kil. Kohle zu 4 Cent. gerechnet,
und abgesehen von der zur Laͤuterung u. Klaͤrung erforderlichen
Quantitaͤt; Gr. R. Hct. Kilogr. Kil. Franken; Howard; Roth; Pelletan;
Trappe; Degrand; Brame; Kosten der ersten Einrichtung; Eigentlicher Apparat mit
Einschluß der Praͤmie der Patenttraͤger; Errichtungs- und
andere Kosten, annaͤherungsweise; Summa; Qualitaͤt des erzielten
Productes; Bemerkungen; Franken; Fr. Schoͤn; Man verfertigt in Frankreich
keine derlei Apparate; (c) Der Betrag hievon ist unter dem zur Austreibung der
Luft noͤthigen begriffen; Nicht sehr entsprechend; Da bisher nur sehr
wenige derlei Apparate errichtet wurden, so fehlt es noch an genauen Daten in
Betreff der Kosten; Entsprechend; Es besteht bis jezt nur ein einziger Apparat
dieser Art; (a) Der Apparat verbraucht nicht nur kein kaltes Wasser, sondern er
erzeugt sogar bei einer Fabrication von taͤglich 300 Hectoliter gegen 150
Hectoliter heißes destillirtes, zu verschiedenen Zweken anwendbares Wasser; Um
so schaumiger und um so schwerer zu reinigen, je weiter unten es genommen ist;
Es gelangt leicht freie Kohlensaͤure in den Syrup oder in den Saft,
wodurch derselbe schwerer krystallisirbar wird; (b) Man kann nicht unter
75° R. eindampfen ohne die Kosten der ersten Einrichtung und den
Verbrauch an Brennmaterial uͤber die Maßen zu erhoͤhen
NB. Die Fabrik, welche diesen Berechnungen zum Grunde
gelegt ist, macerirt nicht; sie haͤtte in diesem Falle um 21 Proc. mehr
Wasser zu verdampfen, und man muͤßte dann bei jedem Apparate den Verbrauch an
kaltem Wasser und die Kosten des Brennmaterials um 21 Proc., die Anschaffungskosten
hingegen um 15 bis 18 Proc. hoͤher ansezen.
Es ist bei diesen Berechnungen ein Apparat angenommen, der taͤglich 300
Hectoliter gelaͤuterten Ruͤbensaft von 4° 5 in der
Waͤrme oder in 140 Tagen 10 Mill. Pfd. Runkelruͤben zu Zuker
verarbeitet.
Tafeln