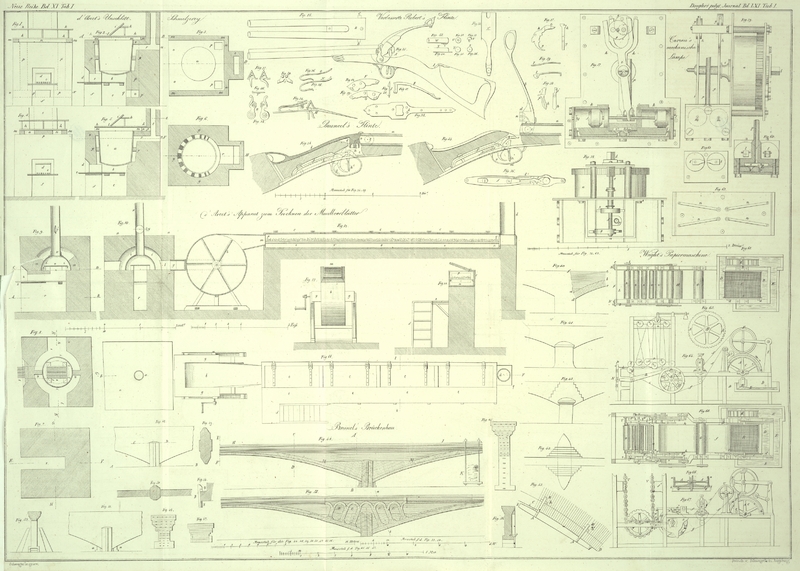| Titel: | Bericht des Hrn. Francoeur über eine neue mechanische Lampe von der Erfindung des Hrn. Careau in Paris, rue des Fossés-Montmartre, No. 21. |
| Fundstelle: | Band 61, Jahrgang 1836, Nr. VI., S. 24 |
| Download: | XML |
VI.
Bericht des Hrn. Francoeur uͤber eine neue mechanische Lampe
von der Erfindung des Hrn. Careau in Paris, rue des
Fossés-Montmartre, No. 21.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement. Januar 1836, S. 1.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Careau's neue mechanische Lampe.
An den Carcel'schen Lampen wird bekanntlich ein
horizontaler Kolben durch ein Uhrwerk in Hin- und Herbewegung versezt, und
dadurch zwingt der Kolben bald mit der einen, bald mit der anderen seiner Basen das
Oehl in einer Roͤhre emporzusteigen, welche dasselbe zur Speisung der Flamme
an den Docht abgibt. Da jedoch die Beleuchtung in langen Winterabenden
hinlaͤnglich lange dauern muß, ohne daß das Raͤderwerk aufgezogen zu
werden braucht, so muß die Entwikelung der Feder langsam und mit
Regelmaͤßigkeit von Statten gehen. Hr. Carcel
verspaͤtet diese Entwikelung, indem er seine Trommel in ein Raͤderwerk
eingreifen laͤßt, welches jenem einer Pendeluhr mit Schlagwerk vollkommen
aͤhnlich ist. Ein Flugrad, welches mit sehr großer Geschwindigkeit in Bewegung gesezt
wird, so lange die Feder auf den Kolben wirkt, verspaͤtet den Gang des
Mechanismus, und gestattet ihm nur die dem fraglichen Zweke entsprechende
Geschwindigkeit.
Alle Lampenerfinder wendeten ein aͤhnliches Raͤderwerksystem an, weil
das Oehl sonst mit zu viel Kraft emporgetrieben und vielleicht ganz in die Luft
geschleudert und die Triebkraft in einigen Augenbliken erschoͤpft werden
wuͤrde. Die HH. Gagneau, Wagner und Galibert benuzen saͤmmtlich ein
Schlagwerkraͤderwerk; in vielen anderen Theilen unterscheiden sich jedoch
ihre Mechanismen wesentlich von einander, indem die Triebkraft bald zur Bewegung der
Kolben, bald zur Vertheilung des Oehles in die Speisungscanaͤle dient.
Man versuchte zwar mehrere Male die Raͤder und das Flugrad, wodurch die Lampen
complicirt, kostspielig, leicht verderbbar und schwer zu repariren werden, zu
umgehen; aber immer mußte man wieder zu diesem Moderator seine Zuflucht nehmen. Hrn.
Careau ist endlich die Loͤsung dieser
wichtigen Aufgabe gelungen, und er ist durch seine Erfindung in Stand gesezt dem
Publicum sehr gute mechanische Lampen aus lakirtem Bleche von jeder Groͤße
fuͤr den Preis von 45 Fr. zu liefern. Seine Lampen zeichnen sich dabei eben
so sehr durch ihre Einfachheit, als durch die Art und Weise aus, auf welche die
Pumpen in Thaͤtigkeit gesezt werden. Hr. Careau
verfertigt uͤberdieß auch kleinere Lampen fuͤr 40 Fr., welche beinahe
um die Haͤlfte weniger Oehl verbrennen, dabei aber auch natuͤrlich ein
minder schoͤnes Licht verbreiten.
Eine sehr große, an ihrem Umfange verzahnte Trommel enthaͤlt eine Stahlfeder
von solcher Kraft, daß sie die Lampe beilaͤufig 8 Stunden lang, wie es
fuͤr lange Winterabende noͤthig ist, in Gang zu erhalten im Stande
ist. Diese Verzahnung greift in ein Getrieb, an dessen Welle sich ein Excentricum
oder eine Art von Muschelrad befindet, welches vier Kolben hin und her bewegt. Die
Lampe hat zwei Pumpen mit doppelten Kolben; waͤhrend die eine das Oehl
emportreibt, sinkt in der anderen der Kolben herab und umgekehrt. Diese
Wechselbewegungen reichen hin, um die Lampe gehoͤrig mit Oehl zu speisen. Das
Merkwuͤrdigste an dieser Lampe ist jedoch, daß Hr. Careau dem Oehle selbst den Widerstand entnommen hat, der noͤthig
ist, um die Entwikelung der Treibfeder zu maͤßigen. Das Oehl kann
naͤmlich der Wirkung des Kolbens bei dessen ruͤkgaͤngiger
Bewegung nur folgen, indem es durch kleine Oeffnungen dringt, deren Caliber der
Erfinder durch vorhergehende Versuche bestimmt. Dieser Widerstand darf nicht zu
gering seyn, indem sonst das Oehl aus der Lampe hinausgetrieben werden
wuͤrde; er darf aber auch nicht zu klein seyn, weil sonst das Oehl den Docht nicht hinreichend
traͤnken koͤnnte.
Es stand zu befuͤrchten, daß, wenn das Fuͤllen der Lampe mit Oehl
vergessen wuͤrde, oder wenn das Oehl nach mehrstuͤndigem Brennen der
Lampe zu mangeln anfinge, der Widerstand dann zu gering werden koͤnnte, so
daß die Triebkraft der Feder zu groß werden und das Oehl mit Gewalt
hinausgeschleudert werden wuͤrde. Die Erfahrung hat jedoch in dieser Hinsicht
Folgendes gelehrt. Wenn es der Lampe des Hrn. Careau an
Oehl zu mangeln beginnt, so bemerkt man ein leises Pfeifen, welches diesen Zustand
andeutet; man muß daher, da die Pumpe in diesem Falle beinahe leer arbeitet, neues
Oehl in den Behaͤlter nachgießen. Wuͤrde die Lampe ohne alle
Beaufsichtigung brennen, so wird sich der Docht in einem solchen Falle, da er keine
Speisung mit Oehl mehr erhaͤlt, verkohlen und ausloͤschen. Die Feder
faͤhrt zwar unter diesen Umstaͤnden in ihren Bewegungen fort; ja ihre
Geschwindigkeit nimmt sogar zu, bis die Kraft ganz erschoͤpft ist; allein
nirgendwo bemerkt man, daß Oehl hinausgeschleudert wird.
Ueber die Qualitaͤt des Lichtes dieser Lampen bleibt nichts zu sagen, da
dieselben eben so trefflich brennen, wie die uͤbrigen mechanischen Lampen,
die sich in keiner anderen Beziehung als durch die Verschiedenheit im Mechanismus
von einander unterscheiden. Was kommt es auch hier auf den Mechanismus an, wenn der
Docht nur ununterbrochen mit der gehoͤrigen Quantitaͤt Oehl gespeist
wird.
Die Commission schlaͤgt demnach vor, die Gesellschaft soll der von Hrn. Careau erfundenen Lampe ihre Approbation ertheilen, und
dem Erfinder den Dank der Gesellschaft ausdruͤken.
Fig. 57 zeigt
den Mechanismus der Careau'schen Lampe im Frontaufrisse
mit einem Durchschnitte des Pumpenstiefels und der Ventile.
Fig. 58 zeigt
den Mechanismus von Unten.
Fig. 59 ist
ein seitlicher Aufriß desselben.
Fig. 60 ist
ein Querdurchschnitt des Pumpenstiefels und der Steigroͤhre.
Fig. 61 ist
eine Platte fuͤr die Saugventile von Ihnen gesehen.
Fig. 62 zeigt
den Pumpenstiefel von Unten, woraus man die Canaͤle ersieht, in denen das von
den Kolben ausgetriebene Oehl ausstroͤmt.
a ist eine an ihrem Umfange verzahnte Trommel, an deren
vierekigen Zapfen b der zum Aufziehen dienende
Schluͤssel gestekt wird.
c ist ein Sperrrad, welches die
ruͤkgaͤngige Bewegung der Trommel, deren Welle durch den ganzen
Mechanismus laͤuft, hindert.
e ein Getrieb, in welches das Zahnrad der Trommel
eingreift, und an dessen Welle f die beiden Excentrica
g, g, welche sich in den Gabeln h, h der beiden Hebel i, i
bewegen, aufgezogen sind. Jeder dieser Hebel, deren Bewegungsmittelpunkt sich in d befindet, bewegt abwechselnd einen doppelten Kolben in
dem Pumpenstiefel k hin und her, und bewirkt dadurch,
daß die Saugventile abwechselnd geschlossen und geoͤffnet werden. Da der
Pumpenstiefel ringsum mit Oehl umgeben ist, so wird das Oehl durch die
ruͤkgaͤngige Bewegung der Kolben j
aufgesogen, und bei den Oeffnungen l eintreten, um dann
durch die kleinen Loͤcher m, die man in Fig. 59 sieht,
in die Canaͤle n, n zu gelangen, und von hier aus
durch die Oeffnungen der Ventile o, die sich abwechselnd
oͤffnen und schließen, in einen Raum zu treten, aus welchem es in die
Steigroͤhre p emporgetrieben wird.
Es erhellt, daß in Folge der Bewegungen der Hebel i, i
immer je zwei der Kolben auf ein Mal einsaugen, waͤhrend die zwei anderen das
Oehl austreiben, um den Docht fortwaͤhrend mit Oehl zu speisen.
Hr. Careau sagt, daß er, um seine Lampe bei den lezten
Bewegungen der Feder zu probiren, diese so weit herabsinken ließ, daß sie nur mehr
eine einzige Bewegung zu machen hatte, und daß die Lampe dessen ungeachtet bis zum
lezten Ende mit gleicher Intensitaͤt brannte. Er richtete ferner eine seiner
Lampen und eine Carcel'sche so ein, daß man alles Oehl,
welches jede dieser Lampen lieferte, sammeln konnte, ohne daß man den Docht
anzuzuͤnden brauchte. Das Resultat war folgendes. Gaͤnzlich aufgezogen
hob die Feder an der Carcel'schen Lampe stuͤndlich
26 Quentchen 6 Gran, an der Lampe Careau's hingegen 54
Quentchen 5 Gran an den Lampenschnabel empor. Um eine Umdrehung aufgezogen, d.h.
zuerst um drei Umdrehungen aufgezogen und dann wieder um zwei nachgelassen, hob die
erstere stuͤndlich 12 Quentchen 2 Gran, leztere hingegen 31 Quentchen 1 Gran
Oehl. Betraͤgt demnach der stuͤndliche Verbrauch 10 Quentchen, so
liefert die Carcel'sche Lampe bei ganzer Aufziehung etwas
mehr als 2 1/2 Mal, am Ende der Aufziehung aber nur 1 1/5 Mal ihren Verbrauch an
Oehl, waͤhrend an der Lampe Careau's das
Verhaͤltniß 5 und 3 1/10 betraͤgt.
Tafeln