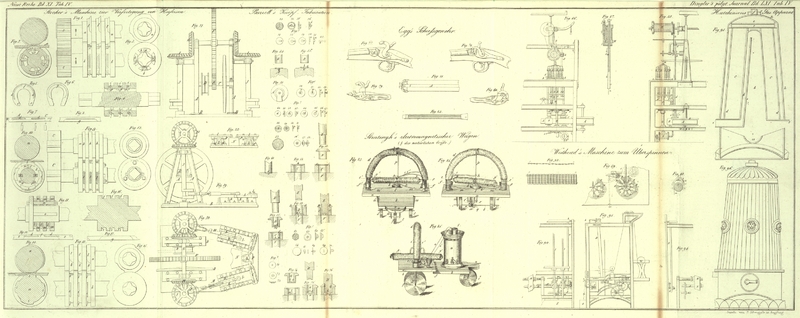| Titel: | Ueber die elektro-magnetische Triebkraft und deren Anwendung auf einen elektro-magnetischen Wagen. Von den HH. S. Stratingh Ez. und C. Becker. |
| Fundstelle: | Band 61, Jahrgang 1836, Nr. L., S. 247 |
| Download: | XML |
L.
Ueber die elektro-magnetische Triebkraft
und deren Anwendung auf einen elektro-magnetischen Wagen. Von den HH. S. Stratingh Ez. und C. Becker.
Aus der Allgemeenen Konst- en Letterbode 1835, No.
54 und 55.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Stratingh u. Becker, uͤber elektro-magnetische
Triebkraft.
Die von Hrn. Jacobi bewerkstelligte Anwendung des
Elektro-Magnetismus zur Erzeugung einer TriebkraftPolytechn. Journal Bd. LX. S.
282. veranlaßte uns zu versuchen, ob wir nicht auch nach einer fruͤher von
uns in Betreff des Elektro-Magnetismus gemachten Erfindung zu demselben Zweke
gelangen koͤnnten, und ob es nicht moͤglich waͤre, eine
passende Anwendung dieser neuen Triebkraft zu zeigen.
Jacobi verfertigte seinen Apparat, indem er zwei eiserne,
mit Kupferdraht umwundene Staͤbe von der Dike eines Daumens, von denen jeder
aus 8 Stuͤken bestand, nahm, und den einen auf einer um ihre Achse
umlaufenden, den anderen hingegen auf einer unbeweglichen Scheibe befestigte, und
zwar so, daß bei der durch einen galvanischen Apparat erzeugten Bewegung die Enden
der beweglichen Staͤbe so nahe als moͤglich an den unbeweglichen
voruͤber gingen, und dabei durch das Abstoßen der Pole eine Bewegung
erzeugten. Die Masse der hiedurch erzeugten Kraft ward zu 25 niederl. Pfunden
angegeben, und die mit dem Apparate erzielte Triebkraft ward auf 5–6 Pfd.
angeschlagen. Zu den Vorzuͤgen dieser Kraft vor der Dampfkraft rechnete man
hauptsaͤchlich den, daß hier die Vermehrung der Kraft nicht so wie bei
anderen Kraͤften mit den Erzeugungskosten in geradem Verhaͤltnisse
steht; und daß die Kraft auf dreierlei Weise, namentlich durch Anwendung dikerer
Staͤbe, erhoͤht werden kann.
Wir wollen nun versuchen zu zeigen, ob sich diese elektro-magnetische
Triebkraft nicht auf eine andere einfachere Weise herstellen, und zu einem im
taͤglichen Leben vorkommenden Zweke anwenden laͤßt. Man sieht den von
uns verfertigten, nur als Modell zu betrachtenden Apparat in der beigefuͤgten
Zeichnung um zwei Drittheile verkleinert abgebildet, und zwar in Fig. 83 von Vorne, in
Fig. 84
von Hinten, und in Fig. 85 von der Seite. Der bewegliche magnetische Apparat ist auf dem
vierekigen Brette a angebracht, waͤhrend sich der
Elektromotor n oder jener Apparat, der den elektrischen
Strom entwikelt, auf einem abgerundeten, an diesem Brette hervorragenden Theile b befindet. Der ganze Apparat muß in doppelter Hinsicht
betrachtet werden: naͤmlich 1) in so fern er Kraft genug zur Darstellung der
elektro-magnetischen Bewegung besizt; und 2) in so fern diese Triebkraft auf
passende Weise zur Herstellung eines magnetischen Wagens benuzt ist.
In ersterer Hinsicht finden wir hier den hufeisenfoͤrmig gebogenen Stab d, der aus weichem Eisen besteht, und unbeweglich in das
Bodenbrett a eingelassen ist. Dieses Hufeisen bildet
einen etwas in die Breite gezogenen Halbkreis, damit die beiden Pole so weit aus
einander fallen, daß fuͤr den mittleren, beweglichen, sogleich weiter zu
beschreibenden Stab g, g' hinlaͤnglich Raum
bleibt. Es ist an seinen unteren Enden e, e' von Innen
beiderseits etwas platt gefeilt, damit sich der bewegbare Stab g, g' im Vorbeigehen so viel als moͤglich der
platten, breiteren Oberflaͤche der Hufeisenenden e,
e' annaͤhern kann. Das Hufeisen ist ferner in zwei Lagen mit
Kupferdraht von beilaͤufig einem Striche (streep)
Dike und beilaͤufig 4 niederl. Ellen Laͤnge umwunden. Der Draht ist
nicht mit Seide uͤbersponnen, wie es sonst gewoͤhnlich zu geschehen
pflegt, sondern bloß gehoͤrig uͤberfirnißt; ein Firnißuͤberzug
ist auch zwischen den beiden Lagen oder Schichten angebracht. Da dieses
Ueberfirnissen eben so genuͤgend befunden ward, wie das muͤhsamere,
umstaͤndlichere und mehr Raum einnehmende Ueberspinnen mit Seide, so verdient
es den Vorzug vor lezterem, und zwar um so wehr, als es zugleich auch einfacher,
dauerhafter und minder kostspielig ist. Die Umwindung ist so bewerkstelligt, daß die
Enden einer jeden Drahtschichte mit den Hauptleitungsdraͤhten verbunden sind,
und daß die Windungen in zwei Theile getheilt und dann wieder vereinigt sind, damit
der Lauf des elektrischen Stromes dadurch verkuͤrzt und mithin beschleunigt
wird. Die aͤußeren Enden der breiten Hauptleitungsdraͤhte laufen vorne
in zwei Schaͤlchen aus Ebenholz f, f', die mit
Queksilber gefuͤllt sind, damit das Hufeisen auf diese Weise magnetisch wird
und entgegengesezte Polkraͤfte bekommt.
Der zweite Theil des Apparates besteht aus dem beweglichen, aus weichem Eisen
verfertigten Stabe g, g', der mit einem Senkmaaße
versehen ist, damit er sich innerhalb des beschriebenen Hufeisens d horizontal in der Runde herum bewegen kann. Er ist
stielrund, an beiden Enden jedoch abgeplattet, damit er mit diesen Enden zwischen
den inneren flachen Polenden des Hufeisens e, e'
vorbeigehen kann, ohne sie zu beruͤhren. Seine in der Mitte angebrachte Achse
ruht mit ihrem gestaͤhlten Ende in einer staͤhlernen oder achatenen
Pfanne, die sich in der Mitte des runden, auf dem Bodenbrette befestigten
Queksilberschaͤlchens k, k' befindet. Das obere
Ende der Achse
laͤuft gleichfalls in einer mit Stahl oder Achat gefuͤtterten Pfanne
h, die von zwei aus starkem Kupferdrahte
verfertigten, rechtwinkelig gebogenen und zur Seite des linken Hufeisenendes e in das Bodenbrett eingelassenen Traͤgern i, i' festgehalten wird. Auf welche Weise die Achse zum
Behufe der Uebertragung der Bewegung einiger Maßen abgeaͤndert wurde, soll
spaͤter gezeigt werden.
Die Umwindung dieses Stabes geschieht so wie an dem Hufeisen mit Kupferdraht von
beilaͤufig 2 niederl. Ellen Laͤnge; der elektrische Strom wird auch
hier wieder von zwei breiteren platten Kupferdraͤhten, deren Enden in das in
der Mitte des Bodenbrettes angebrachte Queksilberschaͤlchen k, k' auslaufen, aufgenommen. Auch dieser Stab muß zur
Erzielung einer hinreichenden magnetischen Kraft eines elektrischen Stromes
theilhaftig werden; da er aber eine dem Hufeisen gleichartige magnetische Kraft
bekommen wuͤrde: d.h. da z.B. sowohl an dem Ende e' des Hufeisens, als an dem Ende g' des
Stabes Nordpol und an den entgegengesezten Enden Suͤdpol werden
wuͤrde, so wuͤrde hieraus nothwendig folgen, daß der Nordpol des
Stabes g' von dem Nordpole des Hufeisens e' und eben so der Suͤdpol des Stabes g von dem Suͤdpole des Hufeisens e abgestoßen wuͤrde, und daß gar keine Bewegung
entstuͤnde, wenn sich gleich anfangs entgegengesezte Pole gegenuͤber
stuͤnden. Die Bewegung wuͤrde demnach unbedeutend oder ganz nichtig
werden; und das Ganze wuͤrde sich nicht anders verhalten, als wenn man ein
elektromagnetisches Hufeisen mit einem umgekehrt elektro-magnetischen Stabe
in Verbindung braͤchte, wobei die Anziehung entgegengesezter Pole nur um so
staͤrker waͤre. Dagegen war vorauszusehen, daß sich allerdings eine
Bewegung erlangen ließe, wenn man sowohl durch den Stab g,
g' as durch das Hufeisen e, e einen eigenen
elektrischen Strom gehen ließe, und wenn man dann den Strom des beweglichen Stabes
g, g' auf diese oder jene Weise schnell umwandelte.
Daß dieß allerdings zu bewerkstelligen war, wurde wohl ausgemittelt; allein wie die
Umwandlung der Pole genau zur rechten Zeit und schnell geschehen koͤnnte, war
nicht so leicht anzugeben. Nach unserer Ansicht laͤßt sich dieser Zwek jedoch
auf folgende einfache und hinreichend sichere Weise erreichen.
Das flache aus Ebenholz bestehende Queksilberschaͤlchen k, k', welches zur Aufnahme der Enden der Umwindungen des beweglichen
Stabes g, g' dient, ist naͤmlich durch eine nicht
leitende Scheidewand aus Elfenbein l in zwei
Abtheilungen geschieden, so daß, wenn der eine Pol des Stabes nach dem einen der
Pole des Hufeisens gerichtet ist, das eine Ende der Stabumwindung in die eine und
das andere Ende in die andere Abtheilung des Schaͤlchens fuͤhrt. Da
nun aber diese beiden
Enden eine freie Bewegung haben muͤssen, und in dieser keineswegs durch die
Scheidewand l beschraͤnkt werden duͤrfen,
so wurde dieses Hinderniß auf einfache Weise durch eine zufaͤllige
Eigenthuͤmlichkeit des Queksilbers: naͤmlich in den Gefaͤßen,
in denen es sich befindet, eine erhabene gewoͤlbte Oberflaͤche
anzunehmen, beseitigt. Hiedurch bleiben naͤmlich die Poldrahtenden des Stabes
g, g' waͤhrend der Bewegung stets hinreichend
mit ihren bestaͤndig dieselbe Elektricitaͤt annehmenden
Queksilberabtheilungen k, k' in Beruͤhrung. Die
kurze Unterbrechung, welche bei dem Uebergange uͤber die Scheidewand Statt
findet, ist wegen der raschen Umdrehung des Stabes als null und nichtig zu
betrachten, obschon sie, wie kurz sie auch seyn mag, dennoch als nothwendig erachtet
werden muß. Der Mechanismus der Polverwechslung liegt demnach in dem Apparate
selbst, und wird durch dessen eigene Kraft und ohne die geringste Aufopferung einer
zweiten Kraft bewerkstelligt. Das Durchlaufen der Draͤhte durch die kleinen
Queksilberhaͤufchen kann nicht in Anschlag kommen, indem hiedurch kein
Verlust an Kraft, der auch nur von einigem Belange waͤre, bedingt ist.
Man koͤnnte den Einwurf machen, daß, wenn dieser Apparat zum Betriebe eines
Wagens oder zu anderen Zweken, bei denen Erschuͤtterung Statt findet, benuzt
wuͤrde, diese Queksilberleitung kaum vollkommen unterhalten werden
duͤrfte. Fuͤr diesen Fall haben wir jedoch bereits gefunden, daß diese
umspringende Leitung auch mit anderen Mitteln, die alle Bedenken beseitigen
duͤrften, erzielt werden koͤnnte.
Damit das Queksilberschaͤlchen k, k' stets mit dem
Elektromotor c in Verbindung bleibe, ist dasselbe zu
beiden Seiten fuͤr jede seiner beiden Abtheilungen mir einem kupfernen
Leitungsdrahte m, m' versehen, wodurch es sowohl aus dem
rechten als aus dem linken Schaͤlchen f, f' den
elektrischen Strom mitgetheilt bekommt. Der Elektromotor c, dessen wir uns zu diesem Zweke bedienten, besteht lediglich aus einem
sogenannten Hare'schen Calorimotor oder auch aus einem
einfachen, umgerollten, und mit Hoͤlzchen 2 niederl. Striche von einander
entfernten Plattenpaare aus Kupfer und Zink von 25 bis 30 niederl. Zoll
Laͤnge und 15 Zoll Hoͤhe. Weitere Untersuchungen werden noch lehren,
welche Art von Elektromotor sich am besten hieher eignet, und am anhaltendsten
wirkt; ebendieß gilt auch von der zur Erregung der Elektricitaͤt
benoͤthigten Saͤure oder sauren Fluͤssigkeit. Wir halten hiezu
ein Gemenge von gleichen Theilen Schwefel- und Salpetersaͤure, mit 40
Theilen Wasser verduͤnnt, vorraͤthig, und finden dieß zur Erzielung
der gewoͤhnlichen Bewegung genuͤgend; nebenbei halten wir eine
staͤrkere, mit 20 bis 10 Theilen Wasser verduͤnnte Saͤure
bereit, um von ihr Gebrauch zu machen, wenn die Bewegung zu traͤg oder groͤßere
Kraftanwendung noͤthig wird. Man kann uͤbrigens, um die
Thaͤtigkeit anhaltender und geregelter zu machen, auch waͤhrend der
Bewegung selbst langsam Saͤure zufließen lassen. Dieser Elektromotor befindet
sich in einem passenden glaͤsernen oder porcellanenen Gefaͤße n, welches auf dem vorstehenden Fußgestelle b angebracht wird, und durch die Draͤhte o, o' bis an die hinter ihm befindlichen zwei
Haupt-Queksilberschaͤlchen f, f', welche
ihrerseits sowohl mit dem Hufeisen, als mit dem Stabe in Verbindung stehen, reichen.
Wenn Alles solcher Maßen eingerichtet worden ist, hat man nichts Anderes zu thun,
als die Saͤure in das Gefaͤß des Elektromotors n zu gießen, wo dann schnell hinreichende Elektricitaͤt entwikelt
werden wird, was aus den beinahe augenbliklich eintretenden Umdrehungen des Stabes
g, g' erhellt. Die Wirksamkeit wird sich hiebei nach
der Staͤrke der Saͤure und nach der Ausdehnung der mit der
Saͤure in Beruͤhrung kommenden Metalloberflaͤche richten, so
daß die entwikelte Stroͤmung um so weniger schnell, aber um so anhaltender
seyn wird, je schwaͤcher die angewendete Saͤure ist.
Wir wollen nun den Gang der Stroͤmung naͤher betrachten, und hiebei
annehmen, daß der rechte Draht o' des Calorimotors die
rechte Seite des Hufeisens e' zum Nordpole, die linke
e hingegen zum Suͤdpole macht. In Folge der
getroffenen Einrichtung kann in demselben Augenblike das rechte Ende des Stabes g', wenn dieser quer zwischen den Hufeisenenden e, e' steht, zum Nord- und das linke zum
Suͤdpole magnetisirt werden, wo dann zu beiden Seiten die Pole des Hufeisens
und des Stabes in eine zwar gleichnamige, jedoch feindliche Richtung kommen. Da es
nun scheint, daß sich die Abstoßungskraft nach einer festen, rechten oder linken
Seite regelt, so folgt hieraus, daß die Pole des beweglichen Stabes g, g' nicht bloß abgestoßen, sondern auch je nach der
Art der elektrischen Stroͤmung gegen die eine der beiden Seiten hingezogen
werden, und zwar mit einer Kraft, die mehr als hinreicht, um deren Umlaufen bis zu
dem anderen Pole zu bewirken. Sind die Pole daher bis zu dieser Haͤlfte der
Umdrehung gelangt, so wird das Ende des ersten rechten Poles g' nunmehr aus der einen Abtheilung k des
Queksilberschaͤlchens in die andere Abtheilung k'
uͤbergehen, wodurch jenes Ende, welches so eben der rechte Nordpol des Stabes
g' war, nunmehr zum Suͤdpole wird,
waͤhrend umgekehrt der linke Suͤdpol g in
den Nordpol verwandelt wird. Hiedurch treffen nun wieder gleichnamige Pole des
Stabes g, g' und des unbeweglichen Hufeisens e, e' zusammen, wodurch eine abermalige Abstoßung
erfolgt und eine einmalige Umdrehung zuruͤkgelegt wird. Der gute Fortgang
dieses elektromagnetischen Spieles, welches sich selbst regulirt, beruht auf der
Moͤglichkeit einer so schnellen Polumwechslung, wie sie hier erforderlich
ist, und die lediglich durch die elektro-magnetische und nicht durch die
magnetische Stroͤmung hervorgebracht wird; diese Moͤglichkeit ist
durch den fraglichen Apparat erwiesen. Ein sehr großer Vortheil ergibt sich hiebei
daraus, daß wegen dieser Polumwechslung die magnetische Kraft, welche in dem
unbeweglichen Hufeisen durch einen anhaltend gleichbleibenden elektrischen Strom
angeregt werden koͤnnte, keine nachtheilige Wirkung auf das Ganze
auszuuͤben im Stande ist, indem durch fortwaͤhrende Polumwechslung die
in dem Hufeisen aufgeregte magnetische Kraft in jedem Augenblik wieder vernichtet
wird. Gaͤbe es ein Mittel, womit man bei diesem Apparate, einiger Maßen so
wie bei der Zamboni'schen Saͤule, den elektrischen
Strom bestaͤndig andauernd machen koͤnnte, so waͤre hiedurch
eine Art von Perpetuum mobile dargestellt.
Was nun die Anwendung der elektro-magnetischen Triebkraft betrifft, so kamen
wir auf die Idee den Apparat auf Raͤder zu sezen, und ihn dann zum
Fortschaffen verschiedener darauf gebrachter oder angehaͤngter
Gegenstaͤnde zu benuzen. Uebrigens versteht sich von selbst, daß sich auf
aͤhnliche Weise auch verschiedene andere Bewegungen oder mechanische
Vorrichtungen bewirken lassen.
Es ist, wie bereits erwaͤhnt worden, an dem Apparat die Einrichtung getroffen,
daß sich die Achse des bewegbaren Stabes h nach Oben in
eine duͤnne Spindel endigt, welche in einer entsprechenden Pfanne
laͤuft, die von den seitlichen Traͤgern i,
i' und von Oben her von einem gegen den obersten Theil des Hufeisens d gestemmten Staͤbchen p festgehalten wird. Der untere Theil der Achse q laͤuft mit einer gleichen Spindel in einer staͤhlernen
Pfanne, die von einem kupfernen, mit Schrauben an dem unteren Theile des
Bodenbrettes a befestigten Arme r getragen und unterstuͤzt wird. Dieser untere Theil der Achse
laͤuft, um dahin zu gelangen, durch den mittleren canalfoͤrmigen Theil
des Queksilberschaͤlchens k, k', ohne dabei in
seiner Bewegung ein Hinderniß zu erfahren.
Der ganze Apparat, so wie man ihn in der Zeichnung ersieht, ruht auf drei kleinen
Raͤdern, von denen zwei s, s' hinten und eines
s'' vorne angebracht ist. Eines der hinteren
Raͤder, hier das zur rechten Seite s' allein, ist
dazu bestimmt unmittelbar von der Achse q des
beweglichen Stabes her die Triebkraft mitgetheilt zu bekommen. Das linke Rad ist
frei und wird in Folge der Bewegung des rechten mit groͤßerer oder geringerer
Geschwindigkeit mitgefuͤhrt; ebendieß gilt auch von dem vorderen Rade s'', welches jedoch mit einer Steuerung v, womit man den Wagen lenken kann, versehen ist. Die
Achse t der hinteren Raͤder laͤuft durch
kupferne Traͤger u, u, welche fuͤr die
hinteren Raͤder an der unteren Flaͤche des Bodenbrettes a, fuͤr das vordere Rad hingegen an der unteren
Flaͤche des Vorsprunges b festgemacht sind. An
dem rechten hinteren Rade befindet sich ein Kronrad w,
dessen Zaͤhne nach Innen gerichtet sind, und durch dessen Umdrehung auch das
Rad umgetrieben wird. Das Kronrad selbst wird umgetrieben, indem der unterste Theil
der Spindel des beweglichen Stabes q ein
achtzaͤhniges Getrieb bildet, welches in das 24zaͤhnige Kronrad
eingreift, so daß durch 4 Umdrehungen der Spindel ein Umgang des Kronrades und
mithin auch ein Umgang des rechten hinteren Wagenrades hervorgebracht wird.
Wenn man den hiemit beschriebenen Wagen mit dem Elektromotor und der Saͤure
versehen und damit gegen 3 niederl. Pfund waͤgend auf einen großen runden
Tisch sezt, so wird er 15 bis 20 Minuten lang mit ziemlich gleichmaͤßiger
Geschwindigkeit darauf herumlaufen; ja man kann ihn sogar mit der Haͤlfte
seines Gewichtes befrachten, ohne daß dadurch dessen Lauf merklich an
Geschwindigkeit verliert. Dabei kommt noch zu bemerken, daß zur Unterhaltung einer
bestaͤndig im Kreise herumfuͤhrenden und umwendenden Bewegung mehr
Kraft erforderlich ist, als wenn die Fahrt in gerader Linie von Statten zu gehen
haͤtte. Die eigenthuͤmliche Kraft eines derlei Apparates sollte mit
einer in groͤßerem Maaßstabe gebauten Vorrichtung erprobt werden; uns
genuͤgt bewiesen zu haben, daß sich auf die angegebene Weise eine anhaltende,
selbst eine Beschwerung zulassende Bewegung vollkommen gut erzielen
laͤßt.
Es erhellt von selbst, daß sowohl hier, als an den Dampfwagen, der zum Unterbringen
von Personen und Guͤtern dienende Raum auf dem Gestelle selbst unmittelbar
vor oder hinter dem Apparate angebracht werden kann, oder daß sich ein derlei
Apparat auch als Zugkarren, dem ein oder mehrere Wagen angehaͤngt werden,
benuzen laͤßt. Da an unserem kleinen Instrumente anfaͤnglich eine
Umdrehung des beweglichen Magnetstabes Statt fand, ohne daß zugleich die
Raͤder eine freie Bewegung bekamen, und da hiebei die Zaͤhne des
Kronrades leicht eine Beschaͤdigung haͤtten erleiden koͤnnen,
so wurde dieses Rad solcher Maßen an der Achse des rechten hinteren Rades
angebracht, daß mittelst der Feder x einige Bewegung
dieses Rades um die Achse moͤglich war, ohne daß zugleich auch die Achse in
Bewegung kommen mußte; uͤbrigens pakte das Kronrad die Achse immer noch fest
genug, um die Umdrehung der Achse und des Rades zu bewirken.
Da dieser Apparat einer groͤßeren und ausgedehnteren Anwendung faͤhig
zu seyn scheint, so nehmen wir leinen Anstand ihn zur allgemeinen Kenntniß zu bringen;
und zwar um so mehr, als alle ihm zu Grunde liegende Triebkraft vor vielen anderen
und selbst vor der vielfach in Anwendung gebrachten Dampfkraft den Vorzug verdienen
duͤrfte. Die Kraft kann naͤmlich vergroͤßert werden, ohne daß
zugleich eine Vergroͤßerung des Elektromotors oder des Entwiklers der
Grundkraft noͤthig waͤre; denn derselbe Elektromotor, der hier z.B.
dem Hufeisen eine Kraft von 10 Pfd. mitzutheilen im Stande ist, kann einem
groͤßeren, aber auf gleiche Weise eingerichteten Hufeisenmagnete eine
Tragkraft von 25 bis 30 Pfd. geben. Ja Hr. Becket hat
bereits mit Polenden von 3 Palmen Weite und mit einem Elektromotor von 2 Palmen
Hoͤhe und 6 bis 8 Palmen Laͤnge Hufeisenmagnete verfertigt, welche ein
Gewicht von 200 Pfd. zu tragen vermoͤgen, und deren Kraft sich durch
Ausbreiten der Hufeisen noch vergroͤßeren laͤßt. Ueberdieß kann man
die Kraft auch noch dadurch, daß man uͤber einander zwei sich kreuzende
Hufeisen und Staͤbe anbringt, verdoppeln und selbst noch mehr
erhoͤhen. Jedenfalls duͤrfte es der Muͤhe werth seyn, die
Regeln der Kraftentwiklung und deren Vermehrung an dem fraglichen Apparate weiter zu
untersuchen.
Daß der neue Kraftapparat bei gegebener Moͤglichkeit einer groͤßeren
Verstaͤrkung und einer ausgedehnteren Benuzung im Allgemeinen vor allen
anderen, und selbst vor der klassisch gewordenen Dampfkraft den Vorzug verdienen
duͤrfte, unterliegt wohl keinem Zweifel. Er eignet sich zum Transporte schon
deßhalb besser, weil er nicht so schwer ist, als die Dampfmaschinen; seine Steuerung
laͤßt sich auf sehr einfache Weise durch Regulirung des Elektromotors
beliebig reguliren; der ganze Apparat ist einfacher, weniger Raum einnehmend und
unmittelbar auf die zu bewegenden Theile selbst anwendbar; die zur Kraftentwiklung
noͤthige Saͤure nimmt keinen so großen Raum ein, als das an den
Dampfmaschinen noͤthige Brennmaterial; und endlich fallen hier auch alle
Gefahren weg, selbst wenn die Kraft zufaͤllig uͤber die Maßen
erhoͤht werden sollte: denn Alles wird durch eine bestaͤndig wirkende,
nach Belieben zu beschraͤnkende Kraft ohne gefaͤhrliche Spannung oder
Hize zu Stand gebracht. Moͤchten diese Bemerkungen zu einer weiteren
Verfolgung dieses Gegenstandes Anlaß geben!
Tafeln