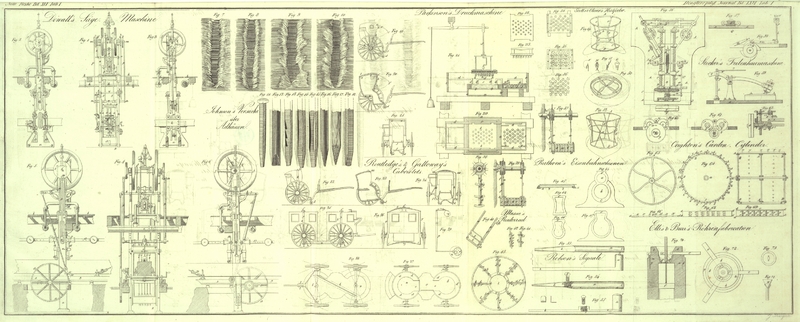| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Sägen von Holz, und an der Methode die Triebkraft auf sie wirken zu lassen, worauf sich John M'Dowall, Ingenieur in Manchester, am 24. Jun. 1836 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. VI., S. 29 |
| Download: | XML |
VI.
Verbesserungen an den Maschinen zum Saͤgen
von Holz, und an der Methode die Triebkraft auf sie wirken zu lassen, worauf sich
John M'Dowall,
Ingenieur in Manchester, am 24. Jun. 1836 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Julius 1837, S.
193.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
M'Dowall's verbesserte Maschinen zum Saͤgen von
Holz.
Gegenwaͤrtige Erfindungen bestehen: 1) in einer verbesserten Maschine zum
Saͤgen von Brettern oder Dielen aus Balken oder Baͤumen; 2) in einer
Modifikation dieser Maschine, damit man schwere Bloͤke oder Kloͤze in
kleine Stuͤke oder Brettchen schneiden kann; und 3) in der Ausstattung einer
jeden dieser Saͤgen mit einem eigenen Dampfcylinder und Kolben, um jede einzeln treiben
zu koͤnnen. Jedes der Saͤgegestelle wird auf diese Weise in eine
eigene, von den uͤbrigen unabhaͤngige Maschine umgewandelt, welche
sich nach Belieben anhalten und in Gang bringen laͤßt, ohne daß der Gang oder
die Geschwindigkeit der uͤbrigen dadurch auch nur im Geringsten
beeintraͤchtigt wird. Diese Maschinen lassen sich, wenn sie nicht zum
Betriebe der Saͤgen dienen, auch als gewoͤhnliche Dampfmaschinen zum
Betriebe verschiedener anderer Apparate oder Maschinerien benuzen. So koͤnnte
man z.B. an der Haupttreibwelle der Maschine eine Rolle anbringen, und um diese
einen Treibriemen schlingen. Wollte man die verbesserte Saͤgemaschine
uͤbrigens durch eine gewoͤhnliche stationaͤre Dampfmaschine in
Bewegung sezen, so brauchte es nichts weiter als an der Haupttreibwelle eine feste
und eine lose Rolle anzubringen, und uͤber diese einen Treibriemen zu
fuͤhren.
Fig. 1, 2, und 3 geben
Ansichten jener Maschine, welche zum Zerschneiden von weichen Balken oder
Baͤumen in Bretter oder Dielen von beliebiger Beschaffenheit bestimmt ist.
Fig. 4,
5 und 6 hingegen
zeigen jene Maschine, in der Bloͤke oder Kloͤze schweren Holzes zu
Brettchen oder kleinen Stuͤken (scantlings)
zerschnitten werden sollen. Erstere Maschine nennt der Patenttraͤger Saw-Frame, leztere hingegen Balk-Frame.
Fig. 1 ist ein
Frontaufriß; Fig.
2 ein Endaufriß oder eine seitliche Ansicht, links von Fig. 1 genommen; und Fig. 3 ein
theilweiser durchschnittlicher Aufriß senkrecht gegen die in Fig. 1 angedeuteten
punktirten Linien A, B genommen.
Die Haupttragepfosten a, a der Maschine sind fest an die
Grundlage gebolzt, und auch auf andere Weise gehoͤrig an Ort und Stelle
befestigt; auch sind sie an die Haupttragebalken des Bodens b, b gebolzt, so daß die Maschine zum Theil dem oberen, zum Theil dem
unteren Stokwerke angehoͤrt, von denen das eine die Triebkraft, das andere
dagegen mehr jene Theile der Maschinerie aufnimmt, die unmittelbar auf das Holz
einzuwirken haben.
Der zum Betriebe der Saͤgemaschine bestimmte Dampfcylinder c wird auf die gewoͤhnliche Weise durch
Schiebventile, welche in der Dampfkammer d, d
untergebracht sind, mit Dampf versehen; und in diese Kammer gelangt der Dampf von
dem Kessel her durch die Hauptdampfroͤhre e und
die Einfuͤhrungsroͤhre f. Nachdem der
Dampf auf den Kolben gewirkt hat, entweicht er dagegen durch die Roͤhre g aus dieser Kammer in die
Ausfuͤhrungsroͤhre h, h.
Die Haupttreibwelle i, i ruht in Unterlagen oder
Anwellen, welche auf dem Scheitel der gußeisernen Tragepfosten a, a fixirt sind. Sie fuͤhrt zwei
Schwungraͤder j, j, zwei Excentrica k¹, k² und
auch zwei Scheiben l, l, in denen die Kurbelzapfen m, m befestigt sind. Leztere stehen durch die
Gelenkstuͤke oder Stangen p, p mit der Welle n, n in Verbindung, und diese fuͤhrt den
Saͤgerahmen o, o, der sich in den an den
Tragepfosten a, a angebrachten Leitstuͤken o*, o* bewegt. Es erhellt hieraus, daß, waͤhrend
das Excentricum k¹ die Schiebventile, welche den
Dampf in den Cylinder c ein- und aus demselben
austreten lassen, in Bewegung sezt, das Excentricum k² die Stirnraͤder q, q in
Thaͤtigkeit bringt, damit das zu zerschneidende Holz vorwaͤrts bewegt
wird. Es geschieht dieß mittelst des Verbindungsstuͤkes oder der Stange r, r und des Sperrkegels s,
s, der das Sperrrad t und das Getrieb u, welches mit lezterem an einem und demselben Zapfen
angebracht ist, umtreibt. Diese Stirnraͤder q, q,
deren Zaͤhne keine große Entfernung von einander haben duͤrfen,
theilen dem zu versaͤgenden Holze mittelst der Winkelraͤder und Wellen
v, v, v, v eine langsam vorschreitende Bewegung mit.
Man ersieht auch, daß die vier unteren Winkelraͤder-Paare, welche sich
in senkrechter Stellung befinden, an den Enden jener Wellen aufgezogen sind, welche
die gezahnten, eisernen Speisungswalzen w, w
fuͤhren, so daß also leztere saͤmmtlich und gleichzeitig einer
gleichmaͤßigen Bewegung theilhaftig werden, und das mit x, x bezeichnete Holz fortwaͤhrend in die
Maschine bewegen, damit es den Saͤgezaͤhnen dargeboten werde. Es
versteht sich, daß das Maaß der Bewegung des Holzes regulirt werden kann; und zwar
dadurch, daß man den Sperrkegel s bei seinen
ruͤkgaͤngigen Bewegungen uͤber eine groͤßere oder
geringere Anzahl der Zaͤhne des Sperrrades in springen laͤßt; denn
hiedurch laͤßt sich die Geschwindigkeit der Annaͤherung des Holzes
gegen die Saͤgezaͤhne je nach der Beschaffenheit der Holzfaser
abaͤndern.
Der Governor, der zur Regulirung des Dampfzuflusses an die Dampfkammer dient,
befindet sich an dem oberen Ende der Maschine und ist von der gewoͤhnlichen
Art. Seine arbeitenden Theile sind an der kreisrunden Metallscheibe z, die durch die Reibung des Umfanges des umlaufenden,
an die Hauptwelle gekeilten Halsringes 1 umgetrieben wird, befestigt. Der
Patenttraͤger gibt dieser Methode den Governor bloß durch Reibung umzutreiben
den Vorzug, weil man zum Behufe der Adjustirung nur den Halsring naͤher gegen
den Mittelpunkt der Scheibe z hin oder weiter davon
wegzuschieben braucht. Auf diese Weise laͤßt sich naͤmlich die
Geschwindigkeit des Governors beliebig reguliren, wenn die Geschwindigkeit der
Maschine je nach der Beschaffenheit des zu zersaͤgenden Holzes
abgeaͤndert werden soll.
Der Patenttraͤger gibt als Triebkraft der Hochdrukdampfmaschine den Vorzug, und nach diesem
Principe ist auch die in Fig. 1, 2 und 3 Abgebildete gebaut.
Gegen 7 Pferdekraͤfte werden im Allgemeinen fuͤr gewoͤhnliches
weiches Holz hinreichen. Die Maschine ist in dem sogenannten halben Hube (half stroke) abgebildet. Wenn sie durch Oeffnen des
Drosselventiles, das in der Einfuͤhrungsroͤhre f angebracht ist, in Thaͤtigkeit versezt wird, so wird der Dampf
durch seine Elasticitaͤt den Kolben y
emportreiben, und durch das Querhaupt 2, 2 und die seitlichen Verbindungsstangen 3,
3 die Welle n, n, die den Saͤgerahmen o, o fuͤhrt, emporziehen. Die Verbindungsstangen
p, p werden die Scheiben l,
l umtreiben, und dadurch die rotirende Bewegung an die Hauptwelle i, i uͤbertragen, die ihren Trieb an die
Schwungraͤder j, j mittheilen und zugleich auch
die Excentrica k¹ und k² zum Umlaufen veranlassen wird. Das Excentricum k¹ gibt durch die Stange 4 die
Verbindungsstuͤcke 5, 5 und die Welle 6 den Schiebventilen eine Hin-
und Herbewegung. So wie sich daher der Kolben in dem Cylinder auf und nieder bewegt,
werden auch die die Saͤgen enthaltenden Rahmen o,
o gehoͤrig auf und nieder bewegt werden. Die Saͤgen, welche
sich in den Rahmen beliebig adjustiren lassen, koͤnnen, wie sich von selbst
versteht, in beliebiger Anzahl und Entfernung von einander angebracht werden.
Es ward bereits oben bemerkt, daß waͤhrend die Maschine arbeitet, das
Excentricum k² das Holz gegen die Zaͤhne
der Saͤge treibt. Es erhellt aber ferner aus Fig. 1, daß jede der
senkrechten Spindeln oder Wellen v, v mit einer Feder
oder einem Keile versehen ist, damit sie die horizontalen Winkelraͤder mit
sich umtreibt, und ihnen doch waͤhrend des Umlaufens gestattet, an der
Spindel emporzusteigen oder herabzusinken, im Falle die auf der Oberflaͤche
des Holzes befindlichen Unebenheiten ein Emporsteigen oder Herabsinken der oberen
Speisungswalzen w, w bewirken. Der Knauf des
horizontalen Raͤderpaares ist in die Laͤnge gezogen; auch ist eine
Auskehlung in denselben gedreht, damit er das Ende der Welle der Speisungswalzen
umfasse, wie man bei 8 sieht. Vor der Maschine oder vor den Saͤgerahmen sind
gewoͤhnliche Speisungstafeln mit Walzen angebracht, damit das zu
zerschneidende Holz auf die Platten 9, 9, von denen es waͤhrend des
Saͤgeprocesses getragen wird, gefuͤhrt wird. Auf dieser Platte ist in
der Fronte der Maschine ein centrales Fuͤhrstuͤk 10 angebracht, gegen
welches das Holz durch die Federn 11, 11, an deren Enden sich Reibungsrollen
befinden, angedruͤkt wird. Die Kraft der Klemmung dieser Federn laͤßt
sich mittelst der kleinen Kurbel und Schraube 12 reguliren. Aehnliche Tafeln sind
auch hinter den Maschinen zum Behufe der Aufnahme des zerschnittenen Holzes
anzubringen. An den Wellen des oberen Paares der Speisungswalzen
w, w sind, wie die Zeichnung andeutet, mittelst der
Stangen 14, 14 zwei Gewichte 13, 13 aufgehaͤngt, welche dieselben mit solcher
Gewalt auf den oberen Rand des Holzes niederzuhalten haben, daß das Emporheben der
Saͤge waͤhrend des Schneidens dadurch verhindert wird. Diese Gewichte
sind auch in der Mitte mittelst einer kleinen Kette und Rolle an der Welle 15
aufgehaͤngt, an deren einem Ende sich ein Sperrrad 16 befindet, in dessen
Knauf Zapfenloͤcher geschnitten sind. In diese Zapfenloͤcher wird ein
Stab eingestekt, wenn das Gewicht und die oberen Walzen emporgehoben werden
sollen.
Die Maschine zum Zerschneiden harter Bloͤke und Kloͤze unterscheidet
sich von der eben beschriebenen nur durch eine groͤßere Staͤrke in
ihrem Baue und durch eine Modification des Mechanismus, der das Holz durch die
Maschine bewegt. Man sieht diese Maschine in Fig. 4 von der Fronte und
zwar am Ende des Schnittes oder Hubes. Fig. 5 ist ein seitlicher
Aufriß der rechten Seite von Fig. 4; und Fig. 6 ein
theilweiser Durschnitt senkrecht nach den punktirten Linien A, B in Fig. 4 genommen.
Wie an der beschriebenen Maschine so auch hier ist a, a
das Hauptgestell, welches gleichfalls an dem Boden des ersten Stokwerkes festgemacht
ist. c, c ist der Dampfcylinder; d die Dampfkammer; e die
Hauptdampfroͤhre, die den Dampf durch die Einfuͤhrungsroͤhre
f an die Ventile leitet; waͤhrend das
Entweichen des Dampfes durch die Ausfuͤhrungsroͤhre g und durch die Roͤhre h Statt findet. Die Haupttreibwelle i, i
fuͤhrt gleichfalls die beiden Schwungraͤder j,
j und die beiden Excentrica k¹,
k², die ebenso durch die Verbindungsstangen 5 und durch die Spindel
6 die Schiebventile, und durch die an die Spindel 8 geschirrten Verbindungsstangen
7, 7 den Wagen, auf dem sich das Holz befindet, in Bewegung zu sezen haben. Die
beiden Scheiben l, l, welche die Kurbelzapfen m, m fuͤhren, werden durch das Auf- und
Niedersteigen der Spindel n, n umgetrieben, wo dann der
Saͤgerahmen o, o sich in den Leitplatten o*, o* auf und nieder bewegen muß. Die Spindel n, n ist ganz genau nach der fruͤher
beschriebenen Methode durch die Verbindungsstangen p, p
mit den Kurbelstiften verbunden.
Die Annaͤherung des Holzes gegen die Saͤgen, worin sich diese Maschine,
wie gesagt, hauptsaͤchlich von der fruͤher beschriebenen
unterscheidet, wird hier auf folgende Weise bewerkstelligt. Der Kloz oder Blok wird
auf einen zu seiner Aufnahme eingerichteten Wagen gebracht, welcher mit 9,9
bezeichnet ist. Dieser Wagen laͤuft mit Reibungsrollen in Unterlagen, die auf
Balken, welche zu beiden Seiten laͤngs der Maschine laufen, gebolzt sind.
Seine Laͤnge hat der gewoͤhnlichen Laͤnge der Kloͤze zu
entsprechen. An seiner unteren Seite ist fuͤr eine Zahnstange gesorgt, in
welche die Getriebe 10,10 eingreifen. Leztere sind an einer Welle 11 aufgezogen, an
deren einem Ende das Zahnrad 12 so aufgezogen ist, daß es die kleinen Getriebe in
Bewegung sezt. An derselben Welle befindet sich auch das Zahnrad 13, welches durch
den Sperrkegel 14, der an dem Ende der Stange 15 angebracht ist, umgetrieben wird,
sobald diese Stange durch das Umlaufen des Excentricums k² in Thaͤtigkeit geraͤth. Der Blok ruht,
waͤhrend er auf diese Weise gegen die Saͤgezaͤhne hin bewegt
wird, auf der Reibungsrolle 16. Die beschwerten Hebel 17,17 und die aufrechten Arme
18,18, an denen sich die Reibungsrollen 19,19 befinden, erhalten den Blok auf seiner
Unterlage, d.h. sie verhuͤten das Emporsteigen desselben beim Emporsteigen
der Saͤge. Zum Festhalten des Blokes dient aber ferner auch noch die Klammer
20, welche an das Ende des Wagens gebolzt ist, und an der sich eine Schraube mit
einer Kurbel befindet, womit man den Blok im Mittelpunkte des Saͤgerahmens
adjustiren kann.
In Fig. 4 ist
angedeutet, wie, waͤhrend ein Blok zertheilt wird, ein zweiter unter die
Einwirkung der Saͤge gebracht werden kann. Dieser Blok wild naͤmlich
an der Seite des Wagens auf Querklammern, oder auch auf einen eigenen Wagen
gebracht. Von dem oberen und unteren Theile des Saͤgerahmens o, o fuͤhren zwei schmiedeiserne Arme herab,
welche eine einzelne, zum Schneiden des Blokes bestimmte Saͤge tragen. Man
braucht also das ganze Saͤgensystem nicht zu beeintraͤchtigen, wenn
man nur einen einzelnen Schnitt fuͤhren will. Diese Methode die Saͤge
aufzuziehen laͤßt sich mit Vortheil auch anwenden, um Furnirstuͤke zu
schneiden, ohne sich hiezu der gewoͤhnlichen kreisrunden Furnirsaͤgen
zu bedienen. In diesem Falle muß jedoch zur Verstaͤrkung der Saͤge
eine schraͤg abgedachte Platte angebracht werden, gleichwie dieß auch an den
gewoͤhnlichen Furnirsaͤgen zu geschehen pflegt.
Der Patenttraͤger beschraͤnke sich nicht darauf, den Kolben durch Dampf
allein in Bewegung zu sezen, sondern er behaͤlt sich vor, hiezu auch irgend
andere elastische Gase oder Daͤmpfe zu benuzen. Auch bindet er sich nicht an
eine bestimmte Form und Groͤße der Dampfcylinder, welche eben so gut auch
unter den Saͤgerahmen, und in horizontaler, senkrechter oder irgend einer
anderen beliebigen Stellung angebracht werden, und stationaͤr, schwingend
oder rotirend seyn koͤnnen.
Tafeln