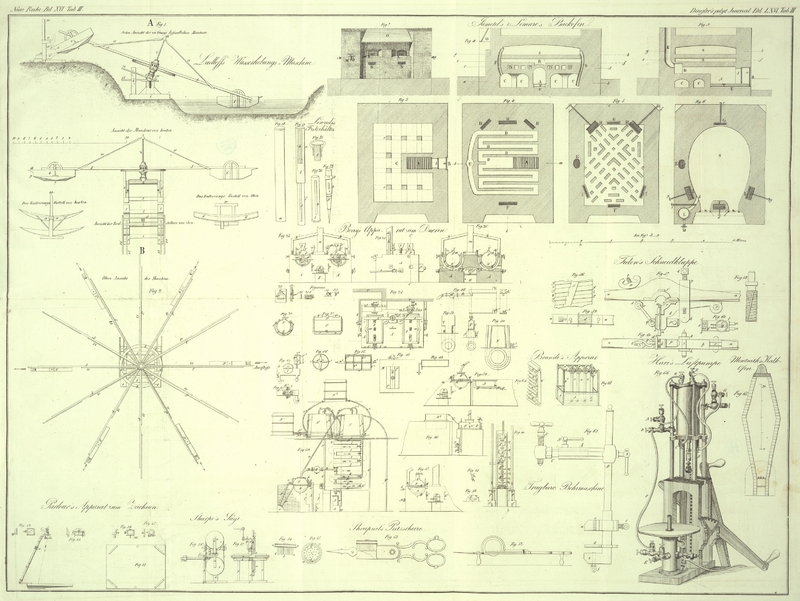| Titel: | Verbesserter Apparat zum Darren, Baken und Rösten vegetabilischer Stoffe, besonders des Stärkmehls zur Fabrication von Gummi für Kattundrukereien, welcher auch zum Abdampfen von Syrupen anwendbar ist und worauf sich Miles Berry, Civilingenieur im Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, am 13. Junius 1836 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. XLII., S. 194 |
| Download: | XML |
XLII.
Verbesserter Apparat zum Darren, Baken und
Roͤsten vegetabilischer Stoffe, besonders des Staͤrkmehls zur Fabrication
von Gummi fuͤr Kattundrukereien, welcher auch zum Abdampfen von Syrupen anwendbar
ist und worauf sich Miles
Berry, Civilingenieur im Chancery-Lane in der Grafschaft
Middlesex, am 13. Junius 1836 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. August 1837, S.
257.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Berry's verbesserter Apparat zum Darren, Baken und Roͤsten
vegetabilischer Stoffe.
Der Apparat, der den Gegenstand dieses Patentes bildet, eignet sich
zuvoͤrderst besonders zum Darren und Roͤsten mehliger vegetabilischer
Stoffe, wie z.B. Weizen- oder Kartoffelstaͤrke, Mehl oder Sazmehl;
ferner zur Fabrication des sogenannten englischen Gummis (british gum), einer schleimigen Substanz, deren sich die Calicodruker
anstatt der fremden Gummi zur Verdikung ihrer Farben und Beizen bedienen, und der aus
Kartoffel- oder Weizenstaͤrke, welche auf den gehoͤrigen Grad
geroͤstet worden ist, besteht; und endlich auch zum Darren und Roͤsten
verschiedener Samen und Koͤrner, sie moͤgen gemahlen worden seyn oder
nicht. Mit einigen Modificationen und Zusaͤzen versehen ist der Apparat aber
auch zum Concentriren und Abdampfen von Syrupen und Salzaufloͤsungen
anwendbar. Der Patenttraͤger beschreibt den Apparat zuerst den ersteren
Zweken gemaͤß eingerichtet, und zwar mit folgenden Worten.
Fig. 23 zeigt
den Apparat von Vorne; Fig. 24 gibt einen
Grundriß oder eine horizontale Ansicht davon; Fig. 25 ist eine vom Ende
her genommene Ansicht; und Fig. 26 ist ein
senkrechter Durchschnitt nach den in Fig. 24 und 25 bemerkbaren
punktirten Linien A, B und C,
D. An saͤmmtlichen Figuren wurden gleiche Theile mit gleichen
Buchstaben bezeichnet. A, A ist das Mauerwerk der
Feuerstelle, in welches zwei cylindrische Retorten oder Roͤstkammern F, F von gleichem Baue eingesezt sind. B ist das Ofenthuͤrchen; C das Innere des Ofens oder die Feuerstelle; D
der Rost; E das Aschenloch. Die Register oder
Daͤmpfer G, G sind mit der Schaͤrfe in das
Mauerwerk und in die Feuerzuͤge eingesezt, und bewegen sich horizontal, damit
man das Feuer unter der einen oder der anderen der beiden Roͤstkammern nach
Belieben leiten kann. H, H, H sind die in den
Seitenwaͤnden und im Ruͤken des Ofens angebrachten Feuerzuͤge,
von denen erstere die Hize unter die Oefen oder Darrkammern leiten. Mit dem Register
i, Fig. 24, welches sich in
senkrechter Richtung bewegt, kann die im Ruͤken des Ofens angebrachte
Oeffnung H, Fig. 25, nach Belieben
geoͤffnet oder geschlossen werden. Die beiden Register K, L, die gleichfalls eine senkrechte Bewegung haben, oͤffnen oder
versperren dem Rauche den Uebergang in den Rauchfang. Der aus Eisen oder Baksteinen
gebaute Feuerzug m bildet den Rauchfang, durch den der
Rauch aus dem Ofen entweicht; er ist mittelst einer in Fig. 24 bemerkbaren,
senkrechten Scheidewand n in zwei Theile abgetheilt, um
den Rauch, der beim Oeffnen des Registers k emporsteigt,
von jenem zu scheiden, der durch das Register l in den
Schornstein gelangt. Die zu beiden Seiten des Ofens in dem Mauerwerke angebrachten
Oeffnungen o, o werden luftdicht verschlossen,
ausgenommen man will in das Innere des Ofens oder in den unteren Theil der
Darrkammern bliken.
Da diese beiden Kammern einerlei Bau haben, so brauchen wir hier nur eine derselben
zu beschreiben. Eine solche Kammer, welche aus Kupfer oder einem anderen
entsprechenden Materiale verfertigt seyn kann, sieht man in Fig. 27 und 28 einzeln
fuͤr sich abgebildet, und zwar in ersterer Figur in einem senkrechten
Laͤngendurchschnitte, in lezterer hingegen in einem Querdurchschnitte. Die
Kammer ist 4 Fuß lang, und besteht aus zwei uͤber einander angebrachten
Theilen. Der obere dieser Theile p, welcher den Dekel
bildet, kann in Hinsicht auf Groͤße von 1/4 bis zu 1/8 des Umfanges der
Kammer wechseln. Der untere Theil besteht aus zwei Metallblechen, einem inneren q und einem aͤußeren r; zwischen beiden befindet sich ein Raum s
von beilaͤufig 1 1/2 Zoll, welcher zur Aufnahme von Oehl dient, damit auf
diese Weise ein heißes Bad fuͤr die Darrkammer gebildet werde. Der Dekel und
der untere Theil oder Koͤrper der Kammer werden bei t durch Randvorspruͤnge, welche sich an dem Dekel befinden, und
durch Schraubenbolzen genau schließend mit einander vereinigt. Schraubt man diese
Bolzen los, so kann man den Dekel abnehmen, um zum Inneren der Kammer zu gelangen.
An dem Dekel p sieht man kurze, rechtekige, metallene
Roͤhren v, v, v befestigt, und in diese werden
die Trichter x gebracht. Die Enden der Darrkammern sind
durch Bolzen oder Loͤthung so zu schließen, daß nichts von dem in dem Raume
s enthaltenen Oehle in deren Inneres gelangen kann.
An dem vorderen Ende ist mit Schraubenbolzen eine dike Kupferplatte Y, Fig. 23, befestigt,
welche zum Verschließen der Thuͤre oder Oeffnung dient, durch welche die
Substanzen nach vollbrachter Darre oder Roͤstung herausgeschafft werden. Zur
Seite dieser Platte befindet sich ein Probehahn z, den
man oͤffnet, wenn man sich von dem Zustande der in der Kammer befindlichen
Substanz uͤberzeugen will. In Fig. 23 sieht man bei a ferner eine an dem Ende der Kammer fixirte
Metallplatte, welche zur Verstaͤrkung dieses Endes, und wie spaͤter
gezeigt werden wird, zur Aufnahme der Achse des Agitators dient. Die Platte Y ist mit zwei hoͤlzernen Griffen b¹, b¹ versehen, womit sie nach Losmachung
der Schrauben weggehoben werden kann.
Sollte man es fuͤr besser halten, so koͤnnte man das vordere Ende der
Kammer auch auf folgende, in Fig. 29 von Vorne und in
Fig. 30
im Durchschnitte dargestellte Weise verfertigen. q, r
sind hier naͤmlich die beiden Metallplatten, aus denen der doppelbodige
Kessel zusammengesezt ist. In dem zwischen ihnen befindlichen Raume C¹ sind an jener Stelle, an welche die
Kesselthuͤr zu liegen kommt, zwei Metallplatten D¹, E anzubringen, welche in Hinsicht auf Form mit der dritten oder
aͤußeren Platte F¹ uͤbereinstimmen.
Die eine dieser Metallplatten D¹ ist an die
innere Flaͤche der Platte q genietet und
geloͤthet; die andere E¹ hingegen an die
innere Flaͤche der Platte r. Die Verbindung
dieser Theile ist durch Blei, welches zwischen sie gelegt wird, vollkommener
gemacht, und das Ganze wird auf die weiter unten zu beschreibende Weise
zusammengeschraubt. Die
dritte aͤußere Platte F¹ ist durch
Schraubenbolzen, welche durch die drei Platten gehen, und die Fugen luftdicht
verschließen, an der aͤußeren Flaͤche des Endes der Kammer r fixirt. In den oberen Theil der Platte F¹ sind fuͤnf Loͤcher q¹ gebohrt, durch welche die Schraubenbolzen
gehen, womit die Stopfbuͤchse, die man in Fig. 31 von Vorne und in
Fig. 32
von der Seite abgebildet sieht, an der Platte fixirt ist. In der Mitte dieser
Stopfbuͤchse befindet sich ein Loch k¹,
welches mit dem in der Platte F angebrachten Loche g² correspondirt, und durch welches die Achse des
spaͤter zu beschreibenden Agitators laͤuft. Der Dekel, welcher das
Thuͤrchen der Kammer bildet, ist mit vier Schraubenbolzen befestigt, welche
durch Loͤcher gestekt werden, die zu diesem Zweke in dem unteren Theile der
Platte F¹ angebracht sind. Den eben
erwaͤhnten Dekel oder Hut sieht man in Fig. 33 von der Seite und
in Fig. 34
von Vorne einzeln fuͤr sich abgebildet; man bemerkt an ihm eine Fuge n¹, die zur Aufnahme der Bolzen h² bestimmt ist, wenn der Dekel auf die Platte
F¹ gesezt wird. Der Probehahn o² ist hier in diesem Falle in der Mitte des
gleichfalls mit hoͤlzernen Griffen versehenen Thuͤrchens
angebracht.
Zur Beschreibung der ersteren Figuren zuruͤkkehrend sind l¹, l¹, Fig. 23 und 24, zwei
starke eiserne Stangen, die mit ihren Enden in dem Mauerwerke ruhen, waͤhrend
sich in deren Mitte die Zapfenlager oder Anwellen a²,
a² fuͤr die Enden der Agitatorwelle befinden. n¹ sind Thermometer, welche in das in dem Raume
s enthaltene Oehl untertauchen und dessen Temperatur
andeuten. Die Roͤhre n¹ communicirt
gleichfalls mit dem Raume s, und auf deren oberem Ende
bemerkt man einen Trichter o¹. Die gebogene
Roͤhre p dient zur Herbeileitung des Oehles aus
einem benachbarten Behaͤlter in den Raum s, wenn
dieser nachgefuͤllt werden muß; an ihr ist ein Hahn Q¹ angebracht, womit dem Oehle der Durchgang eroͤffnet oder
abgesperrt wird.
Zur Speisung des Oehlbades der zweiten zur Linken befindlichen Darrkammer dient eine
zweite Roͤhre, welche so lang ist, daß sie bis in den Trichter o²
reicht. Die mit dem Oehlbade s communicirende
Roͤhre r¹ laͤßt das aus dem
erhizten Oehle entwikelte Gas entweichen, waͤhrend die Roͤhre s¹ zur Regulirung der Hoͤhe dient, auf der
das Oehl in dem Oehlbade steht: und zwar indem sie alles in Ueberschuß in das Bad
gelangte Oehl ableitet. Die Roͤhre t¹
verbindet den unteren Theil des Bades s mit einem
Behaͤlter, der in einem benachbarten Gemache untergebracht ist, und dient zur
Ausleerung des Bades; sie ist zu diesem Zweke mit einem Hahne u¹ versehen. v¹ ist die Wand,
welche die beiden Gemaͤcher von einander scheidet. x¹ ist ein eiserner roͤhrenfoͤrmiger Feuerzug, der
von dem Feuerzuge y unter die Kammern des Rauchfanges
m fuͤhrt.
Einer der wesentlichsten Theile des Apparates ist der in dessen Innerem befindliche
Agitator, den man in Fig. 35 in einer
Laͤngenansicht, und in Fig. 36 in einer
Endansicht gewahr wird. Sein Zwek ist, wenn er in Bewegung gesezt wird, die in die
Darrkammer gebrachte Substanz fortwaͤhrend umzuwenden. Er besteht aus einer
eisernen Achse a², welche mitten durch die
Darrkammer laͤuft, und sich in den erwaͤhnten Zapfenlagern der Stangen
l¹ dreht. An dieser Achse sind die metallenen
Arme b², b² aufgezogen, und an dem Ende
dieser Arme sind mit Schrauben oder auf andere Weise die vier Blaͤtter oder
Fluͤgel c², c², deren Kanten, wie
man aus Fig.
36 sieht, schraͤg abgeschnitten sind, und an denen sich ihrer
ganzen Laͤnge nach Saͤgezaͤhne befinden, festgemacht. Diese
ausgezahnten Raͤnder der Fluͤgel muͤssen so gestellt seyn, daß
sie mit den Seitenwaͤnden und dem Boden der Kammer beinahe, jedoch nicht ganz
in Beruͤhrung kommen; nur wenn sie an dem oberen Theile der Kammer, dem Dekel
p gegenuͤber anlangen, bleibt wegen der
ovalen Gestalt des Dekels zwischen diesem und den Fluͤgeln des Agitators ein
kleiner Zwischenraum. Die Fluͤgel muͤssen eben nicht ausgezahnt seyn,
sondern man kann ihnen auch eine flache oder irgend eine andere, der zu behandelnden
Substanz angepaßte Gestalt geben. Wenn man es fuͤr zwekdienlich haͤlt,
kann man den Agitator auch eben so gut einer seitlichen als einer rotirenden
Bewegung theilhaftig machen. Seine Bewegung erhaͤlt er von einem Laufbande,
welches von irgend einem ersten Beweger her an den Rigger d² laͤuft. Seine Geschwindigkeit duͤrfte 40 bis 55
Umgaͤnge in der Minute betragen.
Das Spiel dieses Apparates ist folgendes. Gesezt es soll zuerst die zur Rechten
befindliche Darrkammer in Thaͤtigkeit gesezt werden, so oͤffnet man
zuerst den Hahn Q¹, Fig. 24, um Oehl in den
Trichter o¹ und aus diesem durch die
Roͤhre n¹ in den Raum s gelangen zu lassen. Ist dieser Raum so weit
gefuͤllt, daß das Oehl bis zur Roͤhre s
hinauf steigt, so schließt man den Hahn q¹. Ist
dieß geschehen, so zieht man das Register g heraus,
damit der aus dem fruͤher im Ofen aufgezuͤndeten Feuer entwikelte
Rauch und erhizte Dampf durch den Feuerzug H
stroͤmen, sich in dem zwischen der Außenseite der Kammer und dem Mauerwerke
befindlichen Feuerzuge verbreiten, und dadurch das Oehl im Bade s erhizen kann. Waͤhrend die Erhizung des Oehles
von Statten geht, sind in die Darrkammer gegen 130 Pfd. Staͤrke oder eine
entsprechende Quantitaͤt der sonstigen darin zu behandelnden Substanz
einzutragen, und zwar durch den mittleren Trichter X.
Wenn der Thermometer m anzeigt, daß das Oehl eine Temperatur von
250 bis 266° F. erlangt hat, so sezt man den Agitator in Thaͤtigkeit.
Der groͤßere Theil der Feuchtigkeit, welche in der in die Kammer
eingetragenen Substanz enthalten ist, wird ausgetrieben, und diese Austreibung wird
durch die Thaͤtigkeit des Agitators sehr beguͤnstigt. Ist der
groͤßere Theil dieser Feuchtigkeit ausgetrieben, so traͤgt man 130
Pfd. derselben Substanz ein, jedoch in kleinen Quantitaͤten auf ein Mal und
im Verlaufe von beilaͤufig einer halben Stunde. Sind sonach 260 Pfd.
eingetragen, so verschließt man die Trichter mit einem Drahtgitter oder mit einem
anderen durchloͤcherten Dekel, worauf man die Temperatur bis auf 455 bis
473° F. treibt. Kurze Zeit, d.h. 5 bis 10 Minuten vor Beendigung der Darre
oder der Roͤstung ist das Register g zu
schließen; und sobald die Roͤstung vollendet ist, wovon man sich durch
oͤfteres Oeffnen des Probehahnes uͤberzeugt, ist der Hahn u¹ zu oͤffnen. Wenn das heiße Oehl
hiedurch entleert, und der Raum s dafuͤr mit
kaltem Oehle gefuͤllt worden ist, so laͤßt man den Agitator noch so
lange laufen, bis die Temperatur auf 302 bis 329° F. gesunken ist; und ist
dieß der Fall, so nimmt man die Thuͤr x ab, und
schafft die gedarrte oder geroͤstete Substanz aus der Kammer heraus, um sie
in große hoͤlzerne Behaͤlter zu bringen, und auf deren aus Kupferblech
bestehenden Boden auszubreiten, damit sie daselbst auskuͤhle und nach dem
Auskuͤhlen gesiebt, verpakt und aufbewahrt werden koͤnne.
Zu bemerken ist, daß jede Operation je nach dem Grade der Trokenheit oder
Feuchtigkeit der Substanzen, mit denen man arbeitet, 2 1/2 bis 3 1/2 Stunde dauert;
und daß, wenn man ein dunkel gefaͤrbtes Product zu erzielen wuͤnscht,
die Roͤstung in der Kammer uͤber freiem Feuer und mit Hinweglassung
des Oehlbades zu geschehen hat. In lezterem Falle ist jedoch die Kammer nach
beendigter Roͤstung alsogleich auszuleeren, und deren Inhalt in
duͤnnere Schichten auszubreiten, damit er die gewuͤnschte Farbe auch
beibehalte. Ferner kann man anstatt des Oehles auch irgend eine andere Substanz als
Bad anwenden, in so fern dieselbe ohne Gefahr bis auf eine Temperatur von 455 bis zu
473° F. erhizt werden kann. Eben so lassen sich die Dimensionen der
Darrkammer ohne Nachtheil abaͤndern; nur muß in diesem Falle die
Quantitaͤt der in sie einzutragenden Substanz in denselben
Verhaͤltnissen abgeaͤndert werden. Endlich muß die Darrkammer, damit
sie außen von dem an ihr sich ansezenden Schmuze gereinigt werden kann, so gebaut
seyn, daß ihr aͤußerer Durchmesser durch die Oeffnung des aͤußeren
Gehaͤuses oder Bades gehen kann. Will man die Kammer durch directe Einwirkung
der Flamme erhizen, so muß der zur Bestimmung der Temperatur dienende Thermometer in einer
kupfernen, in dem Ofen befindlichen Roͤhre angebracht werden; und um den Gang
der Operation besser reguliren zu koͤnnen, waͤre auch ein Ventilator
anzuwenden, der unmittelbar nach beendeter Roͤstung zum Abkuͤhlen der
Kammer benuzt werden koͤnnte. Das Ausleeren der Kammer und das Ausbreiten der
geroͤsteten Substanzen in duͤnnen Schichten muß moͤglichst
beschleunigt werden. Endlich kommt zu bemerken, daß der Ofen entweder, wie man es
denn auch in der Zeichnung sieht, zwischen den beiden Kammern, oder auch nur unter
einer derselben angebracht seyn kann; in jedem Falle ist er mit den noͤthigen
Feuerzuͤgen und Registern zu versehen, damit sich die Hize nach Belieben
reguliren laͤßt.
Was nun die Modificationen und Zusaͤze betrifft, in Folge deren der
beschriebene Darrapparat auch zum Concentriren oͤder Eindiken von Syrupen,
zukerhaltigen Saͤften oder Salzaufloͤsungen dient, so soll zuerst
diese Eindikung in Gefaͤßen, welche dem atmosphaͤrischen Druke
ausgesezt sind, beruͤksichtigt werden. Dieselbe geschieht in einem
cylindrischen Kessel mit doppeltem Boden oder mit Oehlbad, welcher mit einem Ofen,
der dem oben beschriebenen aͤhnlich ist, in Verbindung gebracht wird. Der
Boden des Kessels kann, wenn man will, gerieft oder gerippt seyn, um auf diese Weise
die Heizoberflaͤche zu vergroͤßern und die Operation zu beschleunigen;
dasselbe gilt auch von dem spaͤter zu beschreibenden, zum Abdampfen im
luftleeren Raume bestimmten Apparate. Dimensionen und Gestalt des Kessels wurden
bereits oben bei der Roͤstkammer angegeben; die in ihm enthaltene
Fluͤssigkeit wird gleichfalls durch einen Agitator in Bewegung gesezt.
Fig. 37 gibt
einen Frontaufriß eines solchen Kessels, an dessen Boden A die durch Punkte angedeuteten Rippen oder Falten bemerkbar sind.
Zwischen ihm und dem aͤußeren Gehaͤuse B
befindet sich der das Oehlbad enthaltende Raumt C, von
welchem die Entleerungsroͤhre mit dem Hahne d¹ auslaͤuft. E ist der Dekel
des Kessels, der hier eine pyramidale Gestalt hat, und anstatt der Trichter x des Darrapparates dient. F
ist eine mit einem Hahne versehene Roͤhre, durch welche die eingedikte
Fluͤssigkeit aus dem Inneren des Kessels entfernt wird. Die Roͤhren
g, g, welche mit dem Oehlbade communiciren, dienen
zum Ablassen des Oehles. Die Roͤhren H, H lassen
die Luft entweichen, wenn das Oehlbad gefuͤllt wird. i ist der Thermometer, der die Temperatur des Oehlbades anzudeuten hat.
Durch die an beiden Kesselenden befindlichen Stopfbuͤchsen j laufen die Wellzapfen des Agitators, um endlich in der
eisernen Stange k, welche in dem Mauerwerke fixirt ist,
ihre Anwellen zu finden. An dem Ende dieser Agitatorwelle ist eine Rolle oder Scheibe
angebracht, die man in Fig. 43 bei L sieht, und womit derselbe in Bewegung gesezt wird. M ist die Fronte des Ofens; N die Ofenthuͤr; O das Aschenloch. Fig. 43 zeigt
den Kessel im Grundrisse, an welchem man den oberen Theil bei p, p, p an dem unteren Theile befestigt sieht. Wenn man den in dem Kessel
entwikelten Dampf oder Dunst in den Ventilirkasten, den man in Fig. 44 und 45 abgebildet
sieht, gelangen lassen will, damit er durch den darin befindlichen Ventilator
fortgeschafft werde, so muß der obere Theil des Kessels E mit einer Platte verschlossen seyn, welche man in Fig. 15 bei Q angebolzt sieht. Von dieser Platte aus beginnt eine
Roͤhre R, welche durch ein Gefuͤge s² mit dem Ventilirkasten communicirt, den man in
Fig. 44
von Vorne und in Fig. 45 im Grundrisse abgebildet sieht. T ist
der Kasten, der sowohl gegen die zum Austritte der Fluͤssigkeit bestimmte
Roͤhre s, als auch gegen den Scheitel des
Recipienten s¹ hin schief geneigt ist. In dem
Kasten selbst bemerkt man den Ventilator bei u; der
Dekel des Kastens kann, wenn man will, abgenommen werden, nachdem die Schrauben bei
X nachgelassen worden sind. Die mittelst eines
Gefuͤges angebrachte Roͤhre s communicirt
mit einem Recipienten, der dem in Fig. 39 bei S, T, S, T ersichtlichen aͤhnlich ist, und der
mit einer graduirten Roͤhre zu versehen ist, welche den Stand der
Fluͤssigkeit in ihm andeutet. In dem Scheitel des Kastens ist eine
Roͤhre s¹, Fig. 44 befestigt, an
deren oberem Ende sich ein Schlangenrohr befindet. Diese Roͤhre soll sich
beilaͤufig 35 Fuß hoch uͤber dem Abdampfkessel befinden, und deren
Schlangenwindung soll mit einem Kuͤhlgefaͤße T¹ umgeben seyn, welches durch die Roͤhre u¹ mit Wasser gespeist wird, waͤhrend das
uͤberschuͤssige Wasser durch die Roͤhre u² abfließt. R¹ sind die
Fluͤgel des Ventilators; Y, Y die Zapfenlager
seiner Welle, welche durch die an ihr aufgezogene Scheibe Z in Bewegung gesezt wird. Fig. 46 ist ein
seitlicher Aufriß des Ofens und des Kessels, woran T den
zum Entleeren des lezteren dienenden Hahn bezeichnet; waͤhrend A² ein kleiner Hahn ist, welcher sich an einer
Roͤhre befindet, die von der Roͤhre des eben erwaͤhnten Hahnes
T an das Gefaͤß B² laͤuft. Lezteres ist an das Ende dieser Roͤhre
geschraubt.
Dieser Apparat arbeitet ohne Ventilator auf folgende Weise. Wenn der Raum C bis zur Muͤndung der Abflußroͤhre d empor mit Oehl gefuͤllt worden ist, so
zuͤndet man das Feuer an, und gießt eine gehoͤrige Quantitaͤt
der abzudampfenden Fluͤssigkeit in den Kessel. Hat die Fluͤssigkeit
dem Thermometer i gemaͤß eine Temperatur von
112° F. erreicht, so laͤßt man den Agitator mit einer Geschwindigkeit
von 40 bis 50 Umgaͤngen in der Minute umlaufen, und zwar bis zur Erlangung der
gewuͤnschten Concentration. Ist diese erzielt, so schließt man das Register
h¹, Fig. 37, und bringt
zugleich den Agitator zur Ruhe. Um sich von Zeit zu Zeit von dem Grade der
Concentration uͤberzeugen zu koͤnnen, dient der kleine Hahn A², aus welchem die Fluͤssigkeit, wenn er
geoͤffnet wird, in das kleine Gefaͤß B² laͤuft, worin man sie mit einem Hydrometer pruͤfen
kann. Nach Beendigung der Operation laͤßt man die concentrirte
Fluͤssigkeit durch den Hahn T in ein geeignetes
Gefaͤß abfließen. Das Spiel des Apparates mit dem Ventilator ist folgendes.
Wenn das Feuer aufgezuͤndet worden ist, wenn die Temperatur 124° F.
erreicht hat, und wenn der Agitator sowohl als der Ventilator arbeiten, so steigt
der Dampf aus dem Kessel durch die Roͤhre s² empor, um dann von dem Ventilator rasch in das Schlangenrohr s¹ getrieben zu werden, wo er verdichtet wird.
Das verdichtete Wasser laͤuft aus dem Ventilatorkasten durch die
Roͤhre S in den Recipienten, der mit der
erwaͤhnten graduirten Roͤhre versehen ist, damit man sieht, wie viel
Wasser sich darin angesammelt hat, und damit man auf diese Weise erfaͤhrt, ob
der abzudampfenden Fluͤssigkeit bereits die entsprechende Wassermenge
entzogen worden ist. Man kann uͤbrigens auch hier mittelst des
Gefaͤßes B² beliebige Proben zur
Untersuchung nehmen. Nach Beendigung der Operation wird das Register h² geschlossen, und sowohl der Agitator als der
Ventilator angehalten; ersterer ist uͤbrigens aber auch ganz entbehrlich,
wenn man sich des lezteren bedient. Will man sich dieses Apparates zum Destilliren
von Seewasser oder zum Abdampfen von Salzsohle bedienen, so muͤssen
saͤmmtliche Theile desselben aus verzinntem Kupfer gearbeitet seyn.
Der zur Concentration und Abdampfung im luftleeren Raume dienende Apparat ist in Fig. 39 im
Aufrisse dargestellt. Der Kessel hat gleichfalls einen doppelten Boden, und kann mit
oder ohne Rippen oder Falten versehen seyn. Der Ofen ist dem an dem Darrapparate
verwendeten aͤhnlich. Das Vacuum wird durch Verdichtung des Dampfes erzeugt,
der von einem Dampfkessel e durch die mit einem
Sperrhahne versehene Roͤhre F herbeigelangt.
Diese Roͤhre ist naͤmlich mit dem oberen Theile des Abdampfkessels
verbunden, und fuͤhrt in die Mitte eines Verdichtungs- oder
Kuͤhlapparates, der aus zwei Theilen besteht, von denen der obere aus
mehreren geschlossenen Kammern zusammengesezt ist, deren Waͤnde zur
Vermehrung des Flaͤchenraumes gerippt sind; waͤhrend der untere Theil
aus mehreren geschlossenen, nicht gerippten Kammern K, K
besteht. Diese Kammern sind im Zigzag uͤber einander angebracht, und zwar so,
daß sie miteinander communiciren; sie sind saͤmmtlich mit einem
Gehaͤuse umgeben, in welches mit Huͤlfe eines Ventilators fortwaͤhrend kalte Luft
eingetrieben wird. Der aus dem Abdampfkessel emporsteigende Dampf gelangt zuerst in
den oberen Theil des Verdichters, und nachdem er alle die gerippten Kammern
durchstroͤmt hat, endlich in das zur Linken befindliche, mit zwei
Haͤhnen ausgestattete Verdichtungsgefaͤß N. Der eine dieser Haͤhne dient zum Einlassen von Dampf, der andere
laͤßt die durch den Dampf vertriebene Luft austreten. Das
Verdichtungsgefaͤß ist luftdicht geschlossen, hat nur am Grunde eine
Oeffnung, und ist in einen mit Wasser gefuͤllten Behaͤlter
untergetaucht. Ist dasselbe mit Dampf erfuͤllt, so wird der Lufthahn
geschlossen, und dafuͤr ein anderer Hahn, welcher sich an dem unteren Theile
des Verdichters befindet, geoͤffnet; zugleich wird aus einem uͤber dem
Verdichtungsgefaͤße angebrachten Behaͤlter ein Wasserstrahl in das mit
Dampf erfuͤllte Gefaͤß eingetrieben, wodurch eine Verdichtung erfolgt.
Der verdichtete Dampf gelangt dann von dem oberen Theile des Kuͤhlapparates
in den unteren herab, und aus diesem durch eine Roͤhre zugleich mit all der
Luft, die er allenfalls mit sich fuͤhrte, in einen Recipienten, so daß auf
diese Weise ein Vacuum im Apparate erzeugt wird. Ist dieß der Fall, so wird der am
unteren Theile des Reciplenten befindliche Hahn, so wie auch die Roͤhre, die
den Dampf in den Kessel leitet, geschlossen, und das Register dafuͤr
geoͤffnet, damit die Hize Zutritt zum Kessel erhaͤlt. Wenn dann die
Roͤhre, die den Kessel mit jenem Bottiche verbindet, in welchem die zu
behandelnde Fluͤssigkeit enthalten ist, geoͤffnet worden, und sobald
Dampf emporzusteigen beginnt, laͤßt man von Unten auf Luft in das
Gehaͤuse des Verdichters oder Kuͤhlgefaͤßes treten, damit diese
waͤhrend des Versiedens des Zukers den aus der Fluͤssigkeit
emporsteigenden Dampf fortwaͤhrend abkuͤhle. Dasselbe laͤßt
sich auch erreichen, wenn man anstatt der Luft Wasser oder eine andere
Fluͤssigkeit oder Wasser und Luft zugleich uͤber die flachen
Verdichtungskammern streichen laͤßt.
Wenn man zur Abkuͤhlung des Verdichters in Verbindung mit dem Ventilator von
der zukerhaltigen oder sonstigen Aufloͤsung anwenden will, so soll die obere
Flaͤche der Verdichtungskammern seichte Rinnen bilden. Der Syrup oder die
Aufloͤsung muß dabei aus zwei verschiedenen Roͤhren herbeigelangen,
von denen die eine auf die Oberflaͤche der achten oder oberen gerieften
Kammer I, und die andere auf die dritte Kammer k, von Unten an gezaͤhlt, leitet. Alle diese
Rinnen sind mit Wollen- oder Baumwollzeug zu umgeben; der Syrup oder die
Aufloͤsung wird von einer Rinne zur anderen gelangen, und dadurch, daß er der
durch den Ventilator eingetriebenen Luft ausgesezt wird, abgekuͤhlt werden.
Es erfolgt hiedurch aber auch eine bedeutende Verduͤnstung der
Fluͤssigkeiten, die in dem Maaße, als sie von den Verdichtern herbeigelangen, in
entsprechenden Gefaͤßen gesammelt werden muͤssen. Um das Vacuum in dem
Apparate zu unterhalten, waͤhrend sich in dem oberen linken
Verdichtungsgefaͤße eine gewisse Quantitaͤt Luft und Dampf ansammelt,
wird in dem zur Rechten befindlichen oberen Verdichtungsgefaͤße N ein Vacuum erzeugt, und zwar mittelst einer mit einem
Hahne versehenen Roͤhre, die den Dampf in den oberen Theil dieses
Verdichtungsgefaͤßes einleitet, waͤhrend die Luft durch eine am Grunde
dieses Gefaͤßes befindliche Luftroͤhre entweicht. Jedes der beiden
Verdichtungsgefaͤße ist in einen mit kaltem Wasser gefuͤllten Bottich
untergetaucht. Sobald die Wirksamkeit des Vacuums im ganzen Apparate
nachlaͤßt, wird der Hahn, der den Verdichter mit dem zur linken befindlichen
Gefaͤße verbindet, geschlossen, waͤhrend unmittelbar der kleine Hahn
o¹ und einige Secunden spaͤter der
große Hahn o² geoͤffnet werden muß,
welcher leztere die Communication zwischen dem Verdichter oder Kuͤhlapparate
und dem zur rechten befindlichen Verdichtungsgefaͤße, in welchem vorher das
Vacuum erzeugt wurde, herstellt. Der kleine Hahn o muß
geschlossen werden, sobald der große Hahn o²
geoͤffnet worden ist. Diese Operation wird, indem man sich abwechselnd des
rechten oder linken Verdichtungsgefaͤßes bedient, so oft wiederholt, als es
noͤthig ist, um in dem Apparate das Vacuum auf dem gehoͤrigen Grade zu
erhalten.
Von dem gehoͤrigen Grade der Concentration der Fluͤssigkeiten
uͤberzeugt man sich: 1) durch die graduirte an dem linken Recipienten
angebrachte Roͤhre, welche genau angibt, wie viel Wasser aus einer bestimmten
Quantitaͤt Fluͤssigkeit ausgezogen wurde. 2) durch die auf die
Operation verwendete Zeit, welche unwandelbar ist, wenn man das Oehlbad
fortwaͤhrend auf einer und derselben Temperatur, und das Vacuum auf einem und
demselben durch den Manometer angedeuteten Grad erhaͤlt. 3) Durch Proben, die
man von Zeit zu Zeit durch Einfuͤhrung einer hohlen Roͤhre in den
Kessel nimmt, bis man sich ein Mal an den Apparat gewoͤhnt hat. 4) Dadurch,
daß man an der zum Entleeren des Kessels dienenden Roͤhre einen Sperrhahn mit
einer kleinen Roͤhre, an deren Ende ein Schaͤlchen angeschraubt ist,
anbringt, und hiedurch eine kleine Quantitaͤt der Fluͤssigkeit
abzieht, um sie mittelst des Hydrometers pruͤfen zu koͤnnen. Nach
Beendigung der Operation laͤßt man durch einen kleinen, am Scheitel des
Kessels angebrachten Hahn Luft in den Kessel eintreten, worauf man dann den zum
Entleeren des Kessels dienenden Hahn oͤffnet, und die eingedikte
Fluͤssigkeit in entsprechende Gefaͤße abfließen laͤßt. Will man
mit schwachen Saͤften arbeiten oder die Abdampfung laͤngere Zeit
fortsezen, so duͤrfte der Rauminhalt des linken, unter dem Verdichter angebrachten Recipienten
nicht ausreichen; in diesem Falle muͤßte dann in dem zur Rechten befindlichen
Recipienten ein Vacuum erzeugt, und nach Absperrung des Hahnes jener Roͤhre,
welche den linken Recipienten mit dem Verdichter verbindet, der Hahn jener
Roͤhre geoͤffnet werden, die von dem rechten Recipienten an den
Verdichter fuͤhrt. Zu bemerken ist, daß die Verdichtungsgefaͤße,
welche als uͤber dem Kuͤhlapparat angebracht beschrieben wurden, sich
auch unter ihm oder in irgend einer anderen Stellung unterbringen lassen; und daß
deren Rauminhalt mannigfach abgeaͤndert werden kann. Im Falle man den
Abdampfkessel groͤßer macht, muͤssen auch alle uͤbrigen Theile
in demselben Verhaͤltnisse zunehmen; auch sind die Verdichtungs- oder
Kuͤhlkammern zu vermehren, sey es, daß man sie uͤber einander oder in
zwei Reihen anbringt. In lezterem Falle sollte die von dem Kessel
herfuͤhrende Roͤhre sich in zwei Arme theilen, damit die
Daͤmpfe in beide Kammerreihen gelangen.
Wir gehen nunmehr zur eigentlichen Beschreibung jenes Apparates uͤber, der zum
Abdampfen und Versieden im Vacuum bestimmt ist. Fig. 39 zeigt diesen
Apparat in einem Aufrisse. Der Ofen A, A ist dem an dem
Darrapparate beschriebenen aͤhnlich. Der Kessel B
hat einen gerippten Boden und um diesen laͤuft das Gehaͤuse C, so daß zwischen Boden und Gehaͤuse der Raum
d bleibt, der bis zu der Abflußroͤhre d² hinauf mit Oehl gefuͤllt wird. Von dem
Dampferzeuger e aus, der in einen anderen Ofen eingesezt
ist, faͤhrt die mit dem Sperrhahne a¹
ausgestattete Roͤhre F den Dampf in den Kessel.
Die Roͤhre g fuͤhrt den Dampf an den
mittleren Theil der Verdichter oder Kuͤhlapparate I,
K, die man in Fig. 40 in einem
senkrechten Durchschnitte sieht. An dieser Roͤhre befindet sich eine Kugel
H, die man auch entbehren kann, wenn man der
Roͤhre einen groͤßeren Durchmesser gibt. Die Verdichtungskammern sind
auf die aus Fig.
39 und 40 ersichtliche Weise gebaut und eingerichtet. N,
N sind die beiden oberen Verdichtungsgefaͤße, in die der Dampf
gelangt, nachdem er durch die oberen Verdichtungs- oder Kuͤhlkammern
gegangen ist. An deren Grund befinden sich die Hoͤhne p¹, p¹, welche zum Behufe des Austrittes der Luft
abwechselnd geoͤffnet werden muͤssen, wenn in diesen Gefaͤßen
ein Vacuum erzeugt werden soll. Die kleinen Roͤhren o², o² verbinden die Gefaͤße mit dem Verdichter; sie
sind mit Haͤhnen versehen, und durch sie gelangen der verdichtete Dampf und
die Luft durch die Kammern I, K nach Abwaͤrts in
den Recipienten, wenn die Haͤhne p¹,
p¹ geschlossen, und die Haͤhne Q¹ der Recipienten dafuͤr geoͤffnet wurden. Die
Recipienten s, s muͤssen von solchem Rauminhalte
seyn, daß sie mehr
fassen als jene Quantitaͤt Wasser, die dem Syrupe waͤhrend des
Versiedens entzogen werden soll. Sie nehmen die von der Roͤhre Q herbeigeleitete Luft und auch den Dampf auf, und die
Luft entweicht zugleich durch den Hahn Q¹,
welcher geschlossen werden muß, wenn das Vacuum im Apparate erzeugt wird. p ist ein Gefuͤge, durch welches die Recipienten
T, T mit dem Verdichter oder Kuͤhlapparate in
Verbindung stehen. W sind die graduirten Roͤhren,
die die aus dem Syrup ausgezogene Quantitaͤt Wasser andeuten, und in deren
Innerem sich ein Thermometer befindet, durch den man sich von der Temperatur des
verdichteten Wassers uͤberzeugt. In Fig. 40 sind q³, q³ die von dem Dampferzeuger
ausgehenden Dampfroͤhren; sie sind mit Haͤhnen versehen, damit
abwechselnd in jedem der Recipienten S, T das Vacuum
erzeugt werden kann. Die Recipienten selbst kann man mit Gefaͤßen, welche mit
kaltem Wasser gespeist werden, umgeben, um den zur Erzeugung des Vacuums in ihnen
verwendeten Dampf zu verdichten. Die mit einem Hahne versehene Roͤhre X dient zur Einfuͤhrung der abzudampfenden
Fluͤssigkeit in den Kessel; sie taucht bis in die Naͤhe des
Behaͤlters Y, der zur Aufnahme dieser
Fluͤssigkeit dient, unter. Von der Quantitaͤt, welche bei jeder
Operation in den Kessel gelangte, uͤberzeugt man sich durch die graduirte
Roͤhre v. Der Ventilator Z kommt in Thaͤtigkeit, sobald die Fluͤssigkeit in den
Kessel gelangt ist, und nach vorausgegangener Absperrung der Haͤhne a¹, q¹ und g.
Er treibt so viel Luft in den Verdichter oder in den Kuͤhlapparat als
noͤthig ist, um die durch diesen stroͤmende Fluͤssigkeit rasch
abzukuͤhlen. Die Luft nimmt dabei den durch Pfeile angedeuteten Weg, um
endlich oben zu entweichen. Die Fluͤssigkeit, welche von dem Behaͤlter
N¹ in die Rinnen der aͤußeren
Oberflaͤche der Kammern gelangen soll, laͤuft durch die Roͤhren
p³, p⁴ ab,
die in der Naͤhe des Behaͤlters N¹
mit Haͤhnen versehen sind; und zwar durch lezteren auf die Oberflaͤche
der oberen Kammer I, durch ersteren hingegen auf die
Oberflaͤche der Kammer K. Die Kammern sind wie
bereits erwaͤhnt, und wie in Fig. 40 durch punktirte
Linien angedeutet ist, mit Wollen- oder Baumwollzeug umgeben. Die
Fluͤssigkeit gelangt von einer Kammer auf die andere, und die Kammern werden
sowohl hiedurch, als durch die vermittelst des Ventilators eingetriebene Luft
abgekuͤhlt, waͤhrend die als Kuͤhlmittel benuzte
Fluͤssigkeit selbst ohne allen Aufwand an Brennmaterial verdichtet wird. Die
auf die obere Kammer I geleitete Fluͤssigkeit
tropft bis zur vierten Kammer herab, wo sie bei dem Hahne q⁴ abfließt; die auf die obere Kammer K
geleitete Fluͤssigkeit hingegen fließt bei dem Hahne q³ ab. Kleine, mit den Rinnen einer jeden Kammer communicirende
Haͤhne q⁶ dienen dazu der in diesen Rinnen
enthaltenen Fluͤssigkeit am Ende einer jeden Tagesarbeit Ausfluß zu
verschaffen. C¹, C¹ ist das den Verdichter
oder Kuͤhlapparat umgebende Gehaͤuse, welches der Circulation der
eingetriebenen Luft hinreichenden Spielraum gestattet. C², C² sind die Behaͤlter, in welche die
Verdichtungsgefaͤße N untergetaucht sind, und die
durch die Roͤhren C³, an welchen sich
Sperrhaͤhne befinden, von dem Behaͤlter N² aus mit Wasser gespeist werden. Zum Abflusse des
uͤberschuͤssigen Wassers aus ihnen dienen die Roͤhren T¹. Der Thermometer h¹ deutet die Temperatur des Oehles oder der sonstigen als Bad
verwendeten Fluͤssigkeit an, und i¹ ist
der Hahn, durch den man Luft in den Kessel eintreten laͤßt, wenn er entleert
werden soll. Fig.
41 zeigt einen kleinen Trichter oder ein kleines Gefaͤß, welches
oben auf den Kessel gesezt wird, und welches mit zwei Haͤhnen versehen ist,
zwischen denen sich eine mit Butter oder einer anderen oͤhligen Substanz
gefuͤllte Kugel befindet. Die Fuͤllung dieser Kugel geschieht, indem
man den oberen Hahn oͤffnet, den unteren aber schließt; nach vollbrachter
Fuͤllung schließt man zur Abhaltung der Luft den oberen Hahn, und
oͤffnet dafuͤr den unteren, damit eine gehoͤrige
Quantitaͤt Butter in den Kessel gelange. Eine Glasroͤhre deutet an,
wie hoch die Butterschichte ist, die zur Verhuͤtung des Aufwallens der
Fluͤssigkeit in den Kessel gebracht worden. In Fig. 42 sieht man die
Kuppel oder den oberen gewoͤlbten Theil des Kessels, in welchem zwei
Glasplatten angebracht sind, damit man den im Kessel Statt findenden Vorgang
beobachten kann. Durch die Roͤhren o¹,
o¹ gelangt der Dampf, der zur Erzeugung des Vacuums dient, in die
Gefaͤße N, N; waͤhrend die Roͤhren
und Haͤhne p¹, p¹ die Luft
entweichen lassen. Am Scheitel dieser Gefaͤße sind zwei kleine Roͤhren
befestigt, welche mit zweien Vacuummessern v²,
v² communiciren. Fig. 46 ist ein
seitlicher Aufriß des Kessels und des Ofens. Man sieht hier den Probehahn A² an dem großen, zur Entleerung des Kessels
dienenden Hahne T angebracht. Die mit einem Hahne
versehene, von dem Behaͤlter B²
herfuͤhrende Roͤhre X² dient zur
Einfuͤhrung von bereits gewaͤrmter Fluͤssigkeit in den Kessel.
Die Erwaͤrmung selbst geschieht durch jene Hize, welche unter dem
Abdampfkessel entwich. Fig. 48 zeigt die
Verbindung des Kessels mit dem Verdichter oder Kuͤhlapparate und mit dem
unteren Recipienten in etwas groͤßerem Maaßstabe. Fig. 49 zeigt eine der
gerippten Kammern I mit ihren Haͤhnen einzeln
fuͤr sich. Fig. 50 ist ein Durchschnitt durch eines der oberen
Verdichtungsgefaͤße N mit dem dazu
gehoͤrigen Wasserbehaͤlter C². Fig. 51
endlich ist ein Durchschnitt des Behaͤlters fuͤr die in den Kessel
einzutragende Fluͤssigkeit.
Schließlich muß bemerkt werden, daß der Abdampfkessel auch uͤber freies Feuer
gesezt werden kann, und daß man, wenn man sich eines Erhizungsmediums bedienen will,
anstatt des Oehles auch heiße Luft, Dampf oder irgend eine andere Materie anwenden
kann, wenn dieselbe im Stande ist, die zur Abdampfung oder Concentration
noͤthige Quantitaͤt Waͤrmestoff aufzunehmen und abzugeben.
Endlich ist auch noch zu erinnern, daß die verschiedenen Theile des Verdichters oder
Kuͤhlapparates, bestehend aus den beiden Gefaͤßen N, N, aus den beiden unter dem Verdichter angebrachten
Recipienten, aus dem 30 Fuß hoch uͤber dem Kessel befindlichen Kasten T und aus dem Ventilator, entweder einzeln oder
insgesammt an den verschiedenen nach anderen Systemen eingerichteten
Abdampfapparaten angebracht werden koͤnnen.
Tafeln