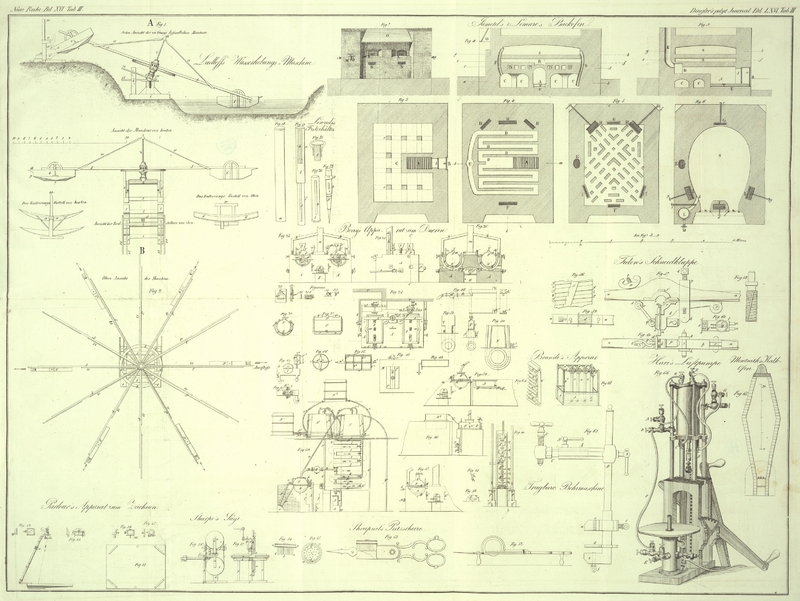| Titel: | Beschreibung des von den HH. Jametel und Lemare erfundenen Bakofens. |
| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. XLIII., S. 208 |
| Download: | XML |
XLIII.
Beschreibung des von den HH. Jametel und Lemare erfundenen Bakofens.Man vergleiche was wir uͤber diesen Bakofen, der in Frankreich immer mehr
und mehr in Aufnahme kommt, im Polyt. Journ. Bd. LV. S. 320, Bd. LVI. S.
475 und Bd. LXI. S. 481
berichtet haben.A. d. R.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement. Januar 1837, S. 25.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Ueber Jametel's und Lemare's Bakofen.
Die Société d'encouragement hat den
Erfindern des Bakofens, der den Gegenstand gegenwaͤrtigen Aufsazes bildet, im
Jahre 1836 ihre silberne Medaille zuerkannt. Sie ergaͤnzt nun die bereits
fruͤher uͤber diese wichtige Erfindung gegebenen Andeutungen durch
eine Beschreibung und Abbildung der verschiedenen zu ihr gehoͤrigen
Theile.
Der neue Bakofen, dem die Erfinder den Namen Four
aérotherme gaben, hat 4 Meter Laͤnge auf 3 Meter Breite, und
ist ganz aus Baksteinen gebaut. Man sieht ihn in Fig. 3 in einem
Grundrisse, welcher im Niveau des Bodens oder nach der Linie a, b von Fig. 8 genommen ist. Fig. 4 ist ein Grundriß in
der Hoͤhe der Rauchcanaͤle D oder nach der
Linie c, d; Fig. 5 ein eben solcher in
der Hoͤhe des Luftcanales oder nach der Linie e,
f; man sieht hier in Gaͤngen Baksteine aufgestellt, welche den Heerd
des Ofens zu tragen haben. Fig. 6 ist ein
horizontaler Durchschnitt des Herdes des Ofens S nach
der Linie g, h von Fig. 8. Fig. 7 zeigt den Ofen von
Vorne; Fig. 8
ist ein senkrechter Laͤngendurchschnitt nach der Linie i, k
Fig. 4; Fig. 9 endlich
ist ein Querdurchschnitt nach der Linie l, m.
An allen diesen Figuren sind zur Bezeichnung gleicher Theile auch einerlei Buchstaben
gewaͤhlt.
Der Zugang B zu dem Feuerherde A ist mit einer gußeisernen Thuͤre a,
und damit die Waͤrme nicht so schnell verloren gehe, außerdem auch noch mit
einer doppelten Thuͤre b verschlossen. C, C, C sind Gaͤnge oder Behaͤlter
fuͤr die heiße Luft, welche den Feuerherd umgeben. Die Zuͤge D, D, D dienen zur Circulation des Rauches, der endlich
durch den in der Dike der Mauer angebrachten Schornstein E entweicht. Der Schlauch F leitet die heiße
Luft des Behaͤlters direct in den Ofen; er laͤuft von dem oberen
Theile der Gaͤnge C, C, C aus und steigt bis zum
Anlaufe des Gewoͤlbes des Ofens empor. Der Schlauch G fuͤhrt die abgekuͤhlte Luft aus dem Ofen in den
Behaͤlter oder in die Gaͤnge zuruͤk, und laͤuft also vom
Herde des Ofens beginnend bis zum Boden dieses Behaͤlters. Die
Schlaͤuche H, H leiten die erhizte Luft des
Behaͤlters direct in den Luftcanal R; sie
entspringen von dem hoͤchsten Punkte des Behaͤlters oder Ganges und
endigen sich im unteren Boden des Luftcanales; auch sind sie mit Schiebern, an denen
Stangen angebracht sind, versehen, damit man sie nach Belieben oͤffnen oder
schließen kann. Die Schlaͤuche I, I, welche die
erhizte Luft aus diesem Luftcanale in den Ofen leiten, beginnen von dem oberen
Theile des Luftcanales und steigen bis zum Anlaufe des Gewoͤlbes des Ofens
empor. k, k sind die Thuͤrchen des Feuerherdes.
L ist ein in die Dike des Gemaͤuers
eingesezter Kessel oder Wasserbehaͤlter, welcher mit einem Hahne M ausgestattet ist. Die Fallthuͤren oder Tampons
N, N dienen zum Einlassen von kalter Luft in den
Luftcanal, um dadurch den Herd des Ofens abkuͤhlen zu koͤnnen. Der
uͤber den Muͤndungen des Ofens aufgesezte Mantel leitet den Rauch im
Momente des Anzuͤndens und auch einen Theil des Dunstes, der beim Einschießen
entweicht, ab. R ist der Luftcanal; S der Ofen; T das
Aschenloch; U ein unter dem Boden des Feuerherdes
befindlicher leerer Raum, der zur Einfuͤhrung der atmosphaͤrischen
Luft in die Gaͤnge oder Behaͤlter dient. a,
b sind gußeiserne Thuͤrchen, welche sich am Eingange des Feuerherdes
befinden. c, c sind Traͤger oder Saͤulen,
auf denen das den Behaͤlter C bildende
Gewoͤlbe ruht. d ist der Schieber des Schlauches
F: e jener des Schlauches G:
f, f jene der Schlaͤuche H, H: g, g jene
der Schlaͤuche I, I. Die Roͤhre h fuͤhrt vom Ofen an den Kessel L; in ihr ist der Schieber i
angebracht.
Dieser Ofen arbeitet nun folgendermaßen. Das Brennmaterial, welches
gewoͤhnlich aus Kohks besteht, wird auf den Feuerherd A gelegt. Sobald es daselbst angezuͤndet worden ist, circulirt die
Flamme in den Zuͤgen D, D, bis endlich nach
Abgabe der Waͤrme an die seitlichen Gaͤnge C, C
und an den Canal R der Rauch bei dem Rauchfange E entweicht. Die aͤußere atmosphaͤrische
Luft dringt durch die unter dem Boden des Feuerherdes angebrachte Spalte U in den Raum C, C, der an
mehreren Orten durch gemauerte Pfeiler, welche sich in Bogengewoͤlbe endigen,
und welche das Mauerwerk des Ofens zu tragen haben, abgetheilt ist. Die Luft
circulirt in Folge dieser Einrichtung frei um den Feuerherd und um das Aschenloch,
und wird durch die Beruͤhrung, in welche sie hiebei mit den Waͤnden
des Herdes gelangt, bis auf einen bedeutenden Grad erhizt, um dann durch die
Schlaͤuche H, H, welche sich an dem oberen Theile
des Behaͤlters und der Thuͤre des Ofens gegenuͤber befinden, in
Canaͤle zu entweichen, die unter dem Ofenherde und uͤber den
Zuͤgen D, D angebracht sind. Nachdem sie auf
diesem Wege eine noch hoͤhere Temperatur erlangt hat, gelangt sie in den
Luftcanal R, aus dem sie sich durch die in der
Naͤhe der Sohle ausmuͤndenden Schlaͤuche I, I in den Ofen begibt. Zugleich steigt die in C erhizte Luft durch den Schlauch F bis zu dem
Gewoͤlbe des Ofens empor, dem sie eine Waͤrme von 200 bis 220°
Celsius mittheilt. Wenn das Brod in diesem Momente bei den Thuͤren K, K eingeschossen worden ist, so verschließt man
saͤmmtliche Zugaͤnge, indem die durch das Mauerwerk dringende Luft zur
Unterhaltung der Verbrennung hinreichen wird. Waͤhrend das Baken von Statten
geht, werden die Gase, welche im Inneren des Ofens durch den Dunst des Brodes und
durch den gewoͤhnlichen Verlust an Waͤrmestoff abgekuͤhlt
werden, specifisch schwerer, wo sie dann durch den Schlauch G in den unteren Behaͤlter gelangen, um daselbst neuerdings wieder
erhizt zu werden, und abermals zum Behufe der Circulation im Ofen durch den Schlauch
F emporzusteigen. Jede zur Circulation der Luft
dienende Oeffnung ist mit einem Schieber versehen, womit man den Zug
ermaͤßigen und noͤthigen Falls auch ganz unterbrechen kann.
Hieraus ergibt sich, daß die Gase des Feuerherdes nicht in unmittelbare
Beruͤhrung mit der circulirenden Luft gerathen, und daß sie auch nicht in den
Ofen eindringen koͤnnen. Es wird ferner beinahe aller Waͤrmestoff zu
Gunsten des Ofens verwendet, so daß die verbrannte Luft, nachdem sie
allmaͤhlich ihres Waͤrmestoffes beraubt worden ist, endlich bei einer
mehr oder minder niedrigen Temperatur durch den Schornstein E entweicht. Da sich in dem Ofen eben so wenig Staub ansammelt, wie in dem
zur Bereitung des Teiges dienenden Geraͤthe, so erhaͤlt man auch ein
reineres und weißeres Gebaͤk.
Man kann in dem beschriebenen Ofen in 24 Stunden 16 bis 20 Trachten, jede zu 170
Kilogr. baken. Das Baken geht ohne Unterbrechung von Statten, und zwar mit einer großen
Ersparniß an Brennmaterial und Arbeitslohn, so wie auch mit groͤßter
Reinlichkeit.
Ein derlei Ofen, den man in der Baͤkerei der Civilspitaͤler in Paris
anwendet, gab die genuͤgendsten Resultate. Man hat in demselben von Montag 2
Uhr bis Samstag 2 Uhr bei einem Verbrauch von 945 Kilogr. Kohks 11965 Kilogr. Brod
gebaken. Die Kosten des Bakens beliefen sich auf 47 Cent. per Tracht von 120 Kilogr.; mit den gewoͤhnlichen, mit Holz
geheizten Bakoͤfen belaufen sie sich auf das Doppelte dieses Betrages. Man
hat gefunden, daß es zur Unterhaltung des Feuers vollkommen genuͤgend ist,
wenn man nach 3 bis 4 Trachten einige Schaufeln voll Kohks auf den Feuerherd wirft.
Der Heizer hat demnach sehr wenig zu thun, und kann sich anderen
Beschaͤftigungen hingeben. Die Arbeiter brauchen nicht wie bisher brennend
heiße, der Gesundheit nachtheilige Luft einzuathmen, und das Brod wird, indem im
ganzen Ofenraume uͤberall eine gleiche Hize herrscht, auf das Vollkommenste
gebaken.
Eine der Wirkungen der Circulation der heißen Luft um den Feuerherd ist: daß die
Verbrennung, wenn sie ein Mal begonnen hat, eine unbestimmt lange Zeit
fortwaͤhrt, ohne daß irgend eine bemerkbare Aufnahme von aͤußerer
atmosphaͤrischer Luft Statt findet: ja dieß geht so weit, daß sie selbst dann
noch fortwaͤhrt, wenn man sowohl die Thuͤre des Feuerherdes, als jene
des Ofens verschließt. Es folgt also hieraus, daß die Verbrennung nur mit jener
geringen Menge Luft, welche durch das Mauerwerk des Ofens dringt, unterhalten
wird.
Tafeln