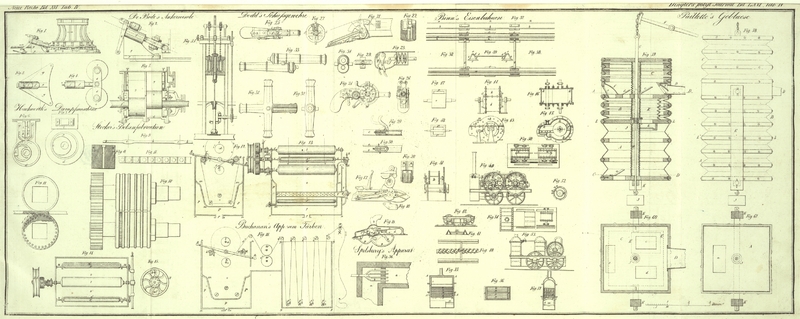| Titel: | Verbesserter Apparat zum Färben und zu anderen ähnlichen Operationen, worauf sich John Buchanan, von Rambottom in der Grafschaft Lancaster, am 22. Nov. 1836 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. LXIII., S. 280 |
| Download: | XML |
LXIII.
Verbesserter Apparat zum Faͤrben und zu
anderen aͤhnlichen Operationen, worauf sich John Buchanan, von Rambottom in der Grafschaft
Lancaster, am 22. Nov. 1836 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Jun.
1837, S. 310.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Buchanan's verbesserter Apparat zum Faͤrben und zu anderen
aͤhnlichen Operationen.
Der von mir zum Behufe des Faͤrbens und anderer aͤhnlichen Operationen
erfundene Apparat besteht aus einer nach meinem Systeme zusammengesezten
Maschinerie, womit das Faͤrben und die uͤbrigen Operationen auf eine
wirksamere und wohlfeilere Weise bewerkstelligt werden koͤnnen, als mit den
gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen Apparaten. Die beigefuͤgten
Zeichnungen, zu deren Beschreibung ich nunmehr sogleich uͤbergehen will,
werden dieß anschaulich machen.
Fig. 12 zeigt
meinen Apparat in einem an seinem Ende genommenen Durchschnitt; Fig. 13 ist ein
seitlicher Durchschnitt und Fig. 14 ein Grundriß.
Fig. 15
ist eine Endansicht des spaͤter zu beschreibenden Raͤderwerkes. Fig. 16
endlich zeigt in einer der ersten Figur aͤhnlichen Ansicht eine Modification
desselben Apparates, in Folge deren die Stuͤke zugleich auch ausgewaschen
oder gespuͤlt werden.
An allen diesen Figuren ist A eine Rolle, die von einem
Laufbande umgetrieben wird, und die mit dem Stirnrade B,
welches an dem fixirten
Zapfen a, a umlaͤuft, in Verbindung steht. An
demselben Zapfen a, a laͤuft auch die lose Rolle
E, auf die der Riemen oder die Schnur
uͤbergetragen wird, wenn die Bewegung der Maschine angehalten werden soll.
Das Rad B sezt zwei andere aͤhnliche
Raͤder C, D, welche lose um die Wellen d, d und c, c laufen, in
Bewegung. F und F' sind
verschiebbare Kuppelbuͤchsen, deren Stellung von dem Hebel f abhaͤngt, welcher sich um den durch den
fixirten Zapfen a, a gehenden Stuͤzpunkt bewegt.
In der aus Fig.
13 ersichtlichen Stellung des Hebels f
verbindet die Kuppelbuͤchse F die Welle d mit dem Rade D;
waͤhrend die von dem Rade C losgemachte
Kuppelbuͤchse F' dieses Rad frei um die Welle c, c laufen laͤßt. Gesezt jedoch der Hebel f werde in die durch punktirte Linien angedeutete
Stellung bewegt, so wird die Welle c, c an das Rad C geschirrt, und die Welle d,
d dafuͤr frei seyn. An dem entgegengesezten Ende der
Verkuppelungsbuͤchsen F, F', d.h. nicht an jenem
Ende, an dem sie die Raͤder D und C auf die beschriebene Weise mit den Wellen d und e verbinden, befinden
sich die Reibungszapfen g und g', welche frei und ohne mit den fixirten Zapfen H,
H' in Beruͤhrung zu stehen, umlaufen, wenn eine der
Kuppelbuͤchsen mit den Raͤdern D, C in
Verbindung steht; ist hingegen dieß nicht der Fall, so verhindert der Zapfen H oder H' das Umlaufen der
Welle, an der die betreffende Kuppelbuͤchse angebracht ist. Dieß ist z.B. in
Fig. 13
mit der Welle c, c der Fall; indem hier die
Kuppelbuͤchse F' von dem Rade C befreit ist, waͤhrend der Zapfen g' mit dem Zapfen H' in
Beruͤhrung steht. Die Stellung dieses Treibraͤderwerkes erhellt noch
deutlicher aus Fig.
15.
An der Welle d, d befindet sich ein hoͤlzerner
Cylinder I, und senkrecht unter diesem ist an der Welle
c, c ein aͤhnlicher Cylinder K angebracht; beide werden der Bewegung ihrer
entsprechenden Wellen theilhaftig. Das ganze oben beschriebene Raͤderwerk
ruht in einem laͤnglichen gußeisernen Behaͤlter, dessen Gestalt in
Fig. 12,
13 und
14 durch
die Buchstaben n, n, n, n angedeutet ist, und dessen
unterer Theil durch das innere Gehaͤuse oder durch die Scheidewand m, m, m, m in eine innere Kammer O und in eine aͤußere Kammer P
abgetheilt ist. Leztere dient, wie spaͤter gezeigt werden wird, zur Aufnahme
von Dampf.
Unabhaͤngig von dem Raͤderwerke dieses Apparates, jedoch parallel mit
der Welle d, d sind die Wellen L und M angebracht, die mit den frei
umlaufenden Cylindern N und N' ausgestattet sind. An denselben Wellen sind auch mittelst
Stellschrauben die Spannungsstaͤbe Q, Q'
befestigt, deren Stellung, wie Fig. 12 am besten zeigt,
von der Schwingung des Hebels R, R abhaͤngt,
indem dieser Hebel mit
Zahnstangen r, r versehen ist, die in die an den Enden
der entsprechenden Wellen L, M befindlichen Getriebe
oder Zahnraͤder eingreifen. An den unteren Theilen der inneren Kammer O laufen frei die Fuͤhrwalzen S, S um.
Ich will nun zeigen, auf welche Weise eine Maschine dieser Art arbeitet, und hiebei
zugleich auch jene Theile derselben erlaͤutern, die bis hieher noch nicht
erwaͤhnt wurden. Ich nehme den Fall an, es seyen gewoͤhnliche Calicos,
welche in der Drukmaschine die Beize erhalten haben, auszufaͤrben; das
Raͤderwerk befinde sich in der aus Fig. 13 ersichtlichen
Stellung; und es seyen gegen 20 an den Enden zusammengenaͤhte Stuͤke
so gleichfoͤrmig und glatt als moͤglich auf die Walze I aufgewunden, so daß diese hiedurch den in Fig. 12 und
13 durch
die Linien i, i, i, i angedeuteten Raum
ausfuͤllt. Wenn nun dieß der Fall ist, so wird der Treibriemen auf die lose
Rolle E geschoben und das Stuͤkende uͤber
die Fuͤhrwalzen N', dann unter den am Boden der
Kammer O befindlichen Walzen S,
S hinweg, und hierauf wieder empor und uͤber den Spannstab Q gefuͤhrt, um endlich an dem unteren Cylinder
K in der durch Pfeile angedeuteten Richtung
befestigt zu werden. Hierauf wird die innere Kammer O
bis zur Linie q, q empor mit der erforderlichen
Farbbruͤhe gefuͤllt, und in die aͤußere Kammer P durch die Oeffnung p Dampf
eingelassen, damit die Farbbruͤhe durch diesen allmaͤhlich bis zum
Sieden erhizt werde. Sollte der Erhizungsproceß beschleunigt werden muͤssen,
so koͤnnte man auch in die innere Kammer durch den Hahn x, der durch die durchbrochene Roͤhre T, T mit der Farbbruͤhe, und wenn er dem Canale
t, t zugedreht wird, durch die Oeffnung x' mit der Dampfkammer P
communicirt, Dampf eintreten lassen. Dieser Canal t, t
steht in der Richtung des aus Fig. 13 ersichtlichen
gebogenen Pfeiles mir der Kammer P, P in Verbindung, und
ist etwas hoͤher hinauf gefuͤhrt, damit jede auch noch so unbedeutende
Verdichtung in der Dampfkammer P verhuͤtet werde,
und damit die Farbbruͤhe, im Falle dieß geschehen sollte, durch den
atmosphaͤrischen Druk in die Dampfkammer getrieben wird. In Fig. 13 ist der Hahn x als geschlossen dargestellt. Wenn nun die
Farbbruͤhe in die Kammer O gebracht und der Zeug
auf die angedeutete Weise durch die Maschine gefuͤhrt ist, so wird die
Stellung des Hebels f umgekehrt und dadurch die
Kuppelbuͤchse F' mit dem Rade C verbunden, waͤhrend die Kuppelbuͤchse
F von dem Rade D befreit
wird, und waͤhrend der Reibungszapfen g mit dem
Zapfen oder Aufhaͤlter H in Beruͤhrung
kommt. Hierauf wird der Treibriemen auf die Treibrolle A
geschoben, und der Cylinder K in Bewegung gesezt, so daß
der Zeug regelmaͤßig und eben uͤber den Spannstab Q hinweg aufgewunden wird, nachdem er zuvor durch die
Farbbruͤhe gelaufen. Ist auf diese Weise saͤmmtlicher Calico, der sich
fruͤher auf der Walze I befand, auf die Walze K uͤbergetragen worden, so sezt der Arbeiter die
Hebel R, R in Bewegung. Die Folge hievon ist, daß die
Stellung der Spannstaͤbe Q, Q umgewechselt, und
zugleich auch die Stellung des Hebels f umgekehrt wird,
so daß nunmehr die Bewegung des Cylinders K, auf den der
Calico dermalen aufgewunden ist, unterbrochen, und dafuͤr der Cylinder oder
die Walze I in Bewegung gesezt wird, damit der Calico
eben und glatt uͤber den Spannstab Q' auf leztere
zuruͤkgewunden werde. Die Stuͤke werden auf diese Weise so lange durch
die Farbbruͤhe durch bewegt und abwechselnd auf die Walze I oder auf die Walze R
aufgewunden, bis das Ausfaͤrben beendigt ist, wo man sie dann abnimmt, neue
an deren Stelle bringt, und wenn es noͤthig ist, auch die Farbbruͤhe
erneuert, nachdem man sie bei dem Hahne v abgelassen
hat. Waͤhrend dieß geschieht, kann der Dampf je nach dem Gutduͤnken
des Faͤrbers und der Art der zu verrichtenden Arbeit durch einen eigenen Hahn
in die Kammer P und in die Kammer O eingelassen werden oder nicht.
Fig. 16 zeigt
eine Modification des von mir erfundenen Apparates und zwar in einem
aͤhnlichen Durchschnitte, wie er in Fig. 12 gegeben ist. Man
sieht hieraus, daß mein fruͤherer Apparat hier mit einem
Wasserbehaͤlter in Verbindung gesezt ist, in welchem die Stuͤke
uͤber mehrere parallele Fuͤhrwalzen S, S
und unter den am Grunde angebrachten gerippten Walzen y, y,
y hinweg gefuͤhrt sind. Um nun diesen Theil der Vorrichtung in
Thaͤtigkeit zu bringen, muß man gleich nach Beendigung des Ausfaͤrbens
das eine Stuͤkende von der Walze K losmachen und
es uͤber die erste Fuͤhrwalze S hinweg
zwischen den Preßwalzen W, W hindurch, und dann
uͤber und unter den verschiedenen Walzen S hinweg
fuͤhren, um es endlich auch noch durch die Zugwalzen w, w hindurch zu leiten, damit die Stuͤke von diesen, die auf
irgend eine geeignete Weise in Bewegung gesezt werden koͤnnen, durch den
Apparat hindurch gezogen, und endlich bei z auf den
Boden gelegt werden. Waͤhrend dieser Theil des Processes von Statten geht,
fließt dem Wasserbehaͤlter y, y, y
fortwaͤhrend frisches Wasser zu; zugleich wird das Wasser auch durch die an
den unteren Walzen S, S, S angebrachten Hebel oder
Schlaͤgel bestaͤndig in Bewegung erhalten.
Aus der hier gegebenen Beschreibung des von mir erfundenen Apparates erhellt, daß
derselbe auch zur Behandlung der Stuͤke im Kuͤhkoth-,
Kleien- und Seifenbade, so wie zu allen uͤbrigen aͤhnlichen
Processen geeignet ist. Bemerken muß ich, daß die Farbbruͤhe durch die
Erhizung mittelst einer Dampfkammer weniger geschwaͤcht wird, als wenn man sie wie
gewoͤhnlich durch Einlassen von Dampf erhizt. Ferner braucht man eine
bedeutend geringere Menge Farbbruͤhe zum Ausfaͤrben; der Apparat nimmt
auch einen kleineren Raum ein als die gewoͤhnliche Vorrichtung. Ich fand
auch, daß man zum Hizen der Farbbruͤhe beinahe um 2/5 weniger Dampf braucht,
wodurch man bedeutend an Brennmaterial erspart. Endlich gewinnt man beinahe in eben
diesem Verhaͤltnisse auch an Arbeit, ohne daß die Stuͤke Gefahr laufen
beschaͤdigt zu werden.
Alle die einzelnen bekannten Theile meiner Maschinerie gehoͤren nicht mit
unter meine Patentanspruͤche; denn diese gruͤnden sich lediglich auf
die hier beschriebene Anordnung und Verbindung derselben zu den angedeuteten
Zweken.
Tafeln