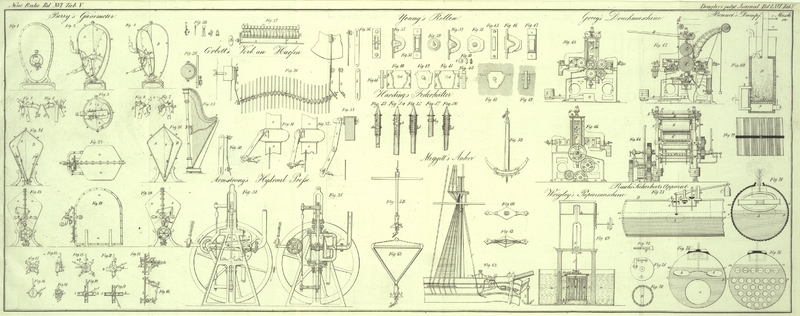| Titel: | Verbesserungen an den Gasmessern, worauf sich Miles Berry, Patentagent im Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 19. März 1833 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. LXV., S. 287 |
| Download: | XML |
LXV.
Verbesserungen an den Gasmessern, worauf sich
Miles Berry,
Patentagent im Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, in Folge einer von
einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 19.
Maͤrz 1833 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Septbr. 1837, S.
321.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Berry's verbesserte Gasmesser.
Die Erfindungen, auf welche obiges Patent genommen worden ist, betreffen einen neuen
Apparat, womit die Quantitaͤt Gas, die von der Hauptgasroͤhre her
durch ihn hindurch an den Brenner gestroͤmt ist, gemessen und registrirt
werden kann. Dieser Apparat gehoͤrt zu jener Art von Gasmessern, welche man
die trokenen (dry meters) zu nennen pflegt: d.h. zu
jenen, an denen weder Wasser, noch irgend eine andere Fluͤssigkeit angewendet
wird, um das Entweichen des Gases durch den Meßapparat zu hemmen oder zu
verzoͤgern, damit dasselbe durch seine Expansivkraft den Apparat in Bewegung
seze, wie dieß an den gewoͤhnlichen rotirenden Gasmessern der Fall ist.
Die bisher angegebenen trokenen Gasmesser scheiterten saͤmmtlich an der Reibung und an der
Complicirtheit ihres Baues. Dagegen gehoͤrt es zu einer der
vorzuͤglichsten Eigenthuͤmlichkeiten des neuen Apparates, daß er mit
der moͤglich geringsten Reibung arbeitet, und daß dem Durchgange des Gases
durch den Gasmesser folglich auch der moͤglich geringste Widerstand geboten
wird: so zwar, daß das Gas selbst bei sehr niedrigem Druke durch ihn
hindurchstroͤmt, obschon die durchgestroͤmte Quantitaͤt mit
großer Genauigkeit gemessen und registrirt wird.
Der neue Gasmesser besteht aus einem hohlen, vollkommen luftdichten, durch eine
bewegliche oder biegsame Scheidewand in zwei Faͤcher oder Kammern
abgetheilten Gehaͤuse; d.h. die Scheidewand ist mittelst eines biegsamen, um
ihre Raͤnder herum angebrachten Verbindungsmittels auf solche Weise an dem
Gehaͤuse befestigt, daß sie sich von einer Seite des Gehaͤuses zur
anderen bewegen kann, und dabei dennoch zwischen den beiden Kammern eine luftdichte
Scheidewand bildet. Eine dieser Kammern ist bestaͤndig der von der
Hauptgasroͤhre herfuͤhrenden Speisungsroͤhre offen; die andere
hingegen ist den Gasbrennern offen. Die schwingenden Bewegungen der Scheidewand
werden mittelst eines Sperrkegels und mittelst Sperrraͤdern, die mit einem
Raͤderwerke, Zifferblaͤttern und Zeigern, welche den an den
gewoͤhnlichen Gasmessern gebraͤuchlichen aͤhnlich sind,
registrirt, und so oft die Scheidewand das Ende ihrer Bewegung erreicht hat,
oͤffnet und schließt oder wechselt sie mittelst eines Hebels und einer Feder
augenbliklich die Oeffnungen oder Wege in dem Hahne, wodurch die Gasroͤhren
mit dem Gasmesser und Brenner in Verbindung stehen. Der Hahn selbst hat vier Wege
oder Canaͤle, von denen zwei von der Hauptgasroͤhre herfuͤhren,
waͤhrend die beiden anderen mit den beiden Kammern communiciren.
Da die Theile dieser verbesserten Gasmesser in Hinsicht auf Gestalt und Anordnung
verschiedene Modificationen zulassen, so sind in den beigegebenen Zeichnungen
zweierlei Formen abgebildet. An der einen befindet sich naͤmlich das Gehwerk
innerhalb, an der anderen hingegen außerhalb des Gehaͤuses.
In Fig. 1 sieht
man einen verbesserten Gasmesser von der Fronte, und zwar mit Beseitigung des
Zifferblattes mit seinen Zeigern, und auch mit Beseitigung eines Theiles des
Raͤderwerkes, damit man den Sperrkegel und das Sperrrad, welches zur
Fortpflanzung der Bewegung der elastischen Scheidewand an die registrirenden Zeiger
auf dem Zifferblatte dient, deutlich ersieht. Fig. 2 ist ein senkrechter
Durchschnitt durch den Gasmesser, an welchem man die Scheidewand am
aͤußersten Ende ihrer Bewegung und die Haͤhne, Federn und Hebel in
jener Stellung sieht, in der sie sich unmittelbar vor Umwandlung der Hahnwege
befinden. Fig.
3 ist ein horizontaler, und Fig. 4 ein senkrechter
Durchschnitt, in welchem die Scheidewand an dem entgegengesezten Ende ihrer Bewegung
zu ersehen ist. An saͤmmtlichen Figuren sind zur Bezeichnung derselben
Gegenstaͤnde einerlei Buchstaben beibehalten.
Das Gehaͤuse a, a, a ist durch die bewegliche
Scheidewand b, die sich in der Naͤhe des Bodens
des Gehaͤuses um ein Charnirgelenk c dreht, in
die beiden Kammern A und B
abgetheilt. Es hat hier eine eifoͤrmige Gestalt, und kann aus Gußeisen oder
irgend einem anderen Materiale verfertigt werden, und zwar in zwei Theilen, welche
man mit Randvorspruͤngen und Schrauben so mit einander verbindet, daß die
Scheidewand zwischen sie zu liegen kommt, wobei man, um das Gefuͤge luftdicht
zu machen, auch noch eine duͤnne Liederung aus Leder zwischen sie legen kann.
Die Roͤhre d fuͤhrt von der
Hauptgasroͤhre an den Gasmesser, die Roͤhre e von lezterem an den Brenner. f ist der
Vierweghahn, um dessen Zapfenende die Feder g, welche
die Veraͤnderungen der Wege des Hahnes bewirkt, gewunden ist. An dem anderen
Ende des Zapfens des Hahnes sind die beiden Hebel h und
i befestigt; und an der Scheidewand ist ein Arm k angebracht, auf dessen untere Seite der Hebel i und auf dessen obere Seite der Hebel h wirkt. An der Scheidewand befindet sich aber auch noch
ein zweiter Arm l, an dessen Ende ein Zapfen angebracht
ist, der sich in einem von dem doppelten Ende der Spiralfeder g gebildeten Fenster bewegt. Einen dritten kurzen Arm bemerkt man an der
Scheidewand bei m, und dieser pflanzt die Bewegungen
dieser lezteren durch den Sperrkegel oder Hebel n an das
Sperrrad o fort, welches mittelst eines
Raͤderwerkes die weitere Fortpflanzung an das Zifferblatt und an die Zeiger
bedingt. p und q sind zwei
in die beiden Kammern A und B sich oͤffnende Roͤhren, durch die das Gas aus den Kammern
an die Brenner entweicht.
Fig. 9 und
10 sind
Durchschnitte durch den Vierweghahn; in ersterer sieht man diese Wege in der
Stellung, welche sie haben, wenn sich der Apparat in dem in Fig. 2 abgebildeten
Zustande befindet: d.h. wenn der zum Entweichen des Gases aus der Kammer B in den Brenner dienende Canal geoͤffnet ist.
Dieses Entweichen geschieht in der Richtung des Pfeiles aus dem Ende der
Roͤhre p durch den Zapfen des Hahnes f und durch die Roͤhre e an den Brenner. Waͤhrend das in der Kammer B befindliche Gas verzehrt wird, wird die Kammer A von der Hauptgasroͤhre her durch die Roͤhre d und den Hahn gefuͤllt, und zwar indem das Gas
in der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung bei der Oeffnung q in die Kammer eintritt. Da die Expansivkraft des Gases
solcher Maßen uͤber die ganze Oberflaͤche der beweglichen Scheidewand
ausgebreitet ist, so wird die Scheidewand hiedurch von einer Seite der Kammer gegen
die andere bewegt werden, so daß sie mit den Hebeln, Federn und Armen in die aus
Fig. 2 zu
ersehende Stellung kommt, in welcher der gebogene Arm des Hebels h auf die untere Oberflaͤche des Armes k druͤkt. Zu gleicher Zeit bewegt sich der an dem
Ende des Armes l befindliche Zapfen in dem an dem Ende
der Feder g angebrachten Fenster, wodurch die Feder in
einem geringen Grade abgewunden wird, waͤhrend jedoch das Umdrehen des
Hahnzapfens durch die Feder dadurch verhuͤtet wird, daß das gebogene Ende des
Hebels h gegen die untere Flaͤche des Armes k druͤkt. So wie aber das gebogene Ende des
Hebels h an dem Ende des Armes k voruͤbergegangen ist, kann sich die Feder wieder aufrollen, wo
dann durch deren Spannung der Zapfen des Hahnes augenbliklich in jene Stellung
versezt wird, die man in Fig. 5 und 6 von der Seite und in
Fig. 10
im Durchschnitte sieht. Die Folge hievon ist, daß die Communication mit der Kammer
B augenbliklich abgebrochen, jene mit der
Hauptgasroͤhre hingegen hergestellt wird; und da zugleich die Communication
zwischen der Kammer A und dem Brenner hergestellt wird,
so wird das Gas sogleich aus der Kammer A durch die
Oeffnung q, durch den Hahn f
und durch die Roͤhre e in den Brenner zu
entweichen beginnen. Wenn dann eine gehoͤrige Quantitaͤt Gas verzehrt
worden ist, so wird der von der Hauptgasroͤhre her Statt findende Druk die
bewegliche Scheidewand in die aus Fig. 4 zu ersehende
Stellung versezen, waͤhrend der an dem Arme l
befindliche Zapfen die Feder etwas weniges anspannt, so daß als Folge hievon das
gebogene Ende des Hebels i auf den oberen Theil des
Armes k zu liegen kommt, wie man dieß aus Fig. 4 ersieht.
Und so bald das gebogene Ende des Hebels i an dem Ende
des Armes k voruͤbergegangen, wird die Feder den
Hahn wieder in seine fruͤhere, aus Fig. 7, 8 und 9 zu ersehende Stellung
zuruͤkfuͤhren, u.s.f. Hieraus erhellt, daß die Laͤnge des Armes
k oder die Laͤnge der Streke, uͤber
welche sich die Enden der Hebel h und i an dessen oberen und unteren Seite bewegen, den
Spielraum der beweglichen Scheidewand bedingen, und daß die zwischen den beiden
aͤußersten Graͤnzen der Bewegung dieser lezteren verzehrte
Quantitaͤt Gas die von den Zeigern und dem Zifferblatte gemessene und
registrirte Quantitaͤt seyn wird, indem der Hebel m und der Sperrkegel n das Sperrrad
waͤhrend zweier Schwingungen der Scheidewand nur um einen Zahn bewegen. Es
erhellt ferner, daß der Spielraum der beweglichen Scheidewand einer solchen
Adjustirung faͤhig ist, daß er genau immer die gewuͤnschte
Quantitaͤt Gas registrirt. Ebenso augenscheinlich ist, daß Gas von jedem
Druke rasch durch den
Gasmesser stroͤmen wird, indem das Gas nur durch den Hahn allein entweichen
kann; und daß alles Gas, welches durch ihn stroͤmt, auch gemessen werden muß.
r ist ein kleines Schaͤlchen oder ein
Behaͤlter, der luftdicht auf das aus dem Gehaͤuse hinausragende Ende
der Roͤhre p geschraubt ist, und der zur Aufnahme
aller aus der Hauptgasroͤhre entweichenden sauren oder fremdartigen Theilchen
bestimmt ist. Er kann daher auch von Zeit zu Zeit abgenommen und ausgeleert
werden.
In den Fig. 19
bis 24 sieht
man einen verbesserten Gasmesser, der sich von dem eben beschriebenen durch seine
Gestalt unterscheidet, und an dem die zum Registriren der verbrannten Gasmenge und
zum Umwechseln der Gaswege des Hahnes bestimmten Vorrichtungen außer dem
Gehaͤuse angebracht sind. Es sind uͤbrigens bei diesen Figuren die zur
Bezeichnung der gleichgebliebenen Theile gewaͤhlten Buchstaben beibehalten
worden. Fig.
19 zeigt diese Art von Gasmesser in einem seitlichen Aufrisse. Fig. 20 stellt
sein vorderes Ende dar; Fig. 21 ist ein
senkrechter Durchschnitt; und Fig. 22 ein Grundriß. Die
arbeitenden Theile befinden sich in denselben Stellungen, wie an Fig. 2 und 3. Die bewegliche
Scheidewand b dreht sich in dem Gehaͤuse a um ein Angelgewinde c,
dessen Dorn an der Scheidewand befestigt ist. Das eine Ende dieses Dornes bewegt
sich an der inneren Seite des hinteren Endes des Gehaͤuses in einem kleinen
Zapfenlager; das andere Ende hingegen ragt durch eine kleine, an dem vorderen
Gehaͤusende befindliche Stopfbuͤchse hindurch, und ist an seinem
aͤußersten Ende mit einem Sperrkegel m versehen,
der die Bewegung der beweglichen Scheidewand an das Sperrrad o und an die Zeiger fortpflanzt. Die Roͤhre d fuͤhrt von der Hauptgasroͤhre her; die Roͤhre e fuͤhrt an den Brenner. Die Roͤhre p fuͤhrt zu der Kammer B und von ihr weg; und q ist eine
aͤhnliche, der Kammer B angehoͤrige
Roͤhre. f ist der Vierweghahn. Hier an diesem
Gasmesser ist an dem Ende des Hahnzapfens nur ein einziger Hebel h befestigt; auch hat die Feder g eine gerade Gestalt. l ist ein langer Hebel,
der an dem Ende der Spindel oder des Dornes c der
Scheidewand befestigt ist, und der sich nach Aufwaͤrts zwischen die beiden
Roͤhren p und q
erstrekt; sein oberes Ende steht durch eine kleine Kette s mit dem Ende der Feder g in Verbindung. So
wie sich die Scheidewand in Folge der Expansivkraft des Gases von einer Seite zur
anderen bewegt, wird der Hebel l mittelst der Kette s und der Feder g den Hebel
h abwechselnd mit den an den kurzen Armen des Hebels
l befindlichen Zapfen t
und u in Beruͤhrung bringen, wie dieß aus Fig. 20 und
21
erhellt.
In Fig. 20
sieht man den Hebel h und die Feder in jener Stellung, welche sie haben, kurz
bevor die Scheidewand an dem Ende ihrer Bewegung anlangt. Ist dieser Zeitpunkt
eingetreten, so gleitet das Ende des Hebels h von dem
Zapfen t ab, und die Feder wird frei. Hiedurch wird der
Hebel alsogleich in die Stellung gebracht, die in Fig. 20 durch Punkte
angedeutet ist, wo dann die Hahnwege veraͤndert und die Communication
zwischen den Kammern und Gasroͤhren umgekehrt wird, so daß die bewegliche
Scheidewand nunmehr durch die Expansivkraft des Gases veranlaßt wird, in die aus
Fig. 23
und 24
ersichtliche Stellung zuruͤkzukehren.
Fig. 23 ist
ein Endaufriß, in welchem man die Theile in einer Fig. 20 entgegengesezten
Stellung sieht. Fig. 24 ist ein Durchschnitt. Wenn naͤmlich das Ende des Hebels
h von dem Zapfen u
abgegleitet ist, so treibt die Feder den Hebel in jene Stellung, welche man in Fig. 23 durch
Punkte angedeutet sieht, und in welcher der Hebel durch die Kraft des Gases in die
in Fig. 20 zu
ersehende Stellung getrieben wird, u.s.f. Die kleinen Roͤhren v, v erstreken sich mit den an ihren Enden befindlichen
Zapfen durch das Gehaͤuse hindurch, und sind zu demselben Zweke bestimmt, wie
die in Fig. 1,
2, 3 und 4 abgebildeten
Schalchen oder Behaͤlter.
Die an dem verbesserten Gasmesser anzuwendenden Haͤhne oder Ventile
koͤnnen von verschiedener Art seyn; es sollen hier nur einige von denen
abgebildet werden, deren man sich mit Vortheil bedienen kann. Fig. 11 ist ein
Durchschnitt durch einen Hahn von der in Fig. 9 und 10 abgebildeten Art; doch
ist dessen Einrichtung eine einfachere, indem durch den Zapfen f nur eine Scheidewand laͤuft, welche die beiden
Wege oder Muͤndungen bildet.
In Fig. 12,
13, 14, 15 und 16 sieht man
eine andere Art von Hahn, der aus einem Rohre mit vier Wegen oder Kammern, und aus
einem Dekel, welcher durch eine Scheidewand in zwei Kammern getheilt ist, besteht.
An dem Rohre f befinden sich wie an den fruͤheren
Figuren die vier Wege d, e, p, q. Der Dekel w paßt luftdicht auf das Rohr, und wird durch die
Schraube x, die man in Fig. 12, 13 und 14 sieht, und um die sich
der Dekel wie um seine Achse dreht, auf demselben festgehalten. h, i sind die Hebel und g
ist die an dem Dekel befestigte Feder, wodurch der Dekel um den vierten Theil eines
Umganges umgedreht wird, so oft die bewegliche Scheidewand das Ende ihrer Bewegung
erreicht hat, und wodurch die Gascanaͤle, welche in den Gasmesser und aus
demselben fuͤhren, abwechselnd umgeaͤndert werden, wie dieß aus den
fruͤher gegebenen Beschreibungen erhellt. Fig. 12 gibt eine
Frontansicht des Hahnes oder Ventiles. Fig. 13 ist eine
seitliche Ansicht; Fig. 14 ist ein Durchschnitt durch das Ventil. Fig. 15 ist ein
Durchschnitt durch das
Rohr des Hahnes, woraus die verschiedenen Wege oder Canaͤle zu erkennen sind.
Fig. 16
gibt eine Ansicht des Dekels fuͤr sich allein.
In Fig. 17 und
18 sieht
man eine andere Art von Ventil, welches gleichfalls an dem verbesserten Gasmesser
angebracht werden kann. Es besteht aus zwei Roͤhen mit Tfoͤrmigen Enden, von denen die eine das Gas in den Gasmesser
eintreten laͤßt, waͤhrend die andere das Gas in den Brenner leitet.
Das eine Ende einer jeden dieser beiden Roͤhren tritt in die Kammer A das andere hingegen in die Kammer B; und an jeder der Muͤndungen der Roͤhren
befinden sich Ventile, welche durch die Bewegung der Scheidewand mittelst Hebel und
Federn von der beschriebenen Art in Thaͤtigkeit gesezt werden, und die also
den in den Gasmesser und aus demselben fuͤhrenden Weg oͤffnen und
schließen. Fig.
17 ist ein Grundriß der Roͤhren und Ventile, in welchem sowohl die
aus der Hauptgasroͤhre in die Kammer B, als auch
von der Kammer A zum Brenner fuͤhrenden Wege als
geoͤffnet dargestellt sind. In Fig. 18 ist eine
seitliche Ansicht derselben Theile gegeben. Die Roͤhre d fuͤhrt von der Hauptgasroͤhre her; die Roͤhre e fuͤhrt an den Brenner. b, b ist die bewegliche Scheidewand; p der
Weg, durch den das Gas in die Kammer B gelangt; q der Weg, durch den es aus der Kammer A in den Brenner entweicht; p* die Einmuͤndung der Hauptgasroͤhre in die Kammer A, und q* die
Muͤndung, durch die das Gas aus der Kammer B in
den Brenner entweicht. Alle diese Muͤndungen oder Roͤhrenenden werden
abwechselnd durch Ventile verschlossen, welche durch Staͤbe, die durch die
Roͤhren gehen, und die sich innerhalb der Roͤhren in kleinen Anwellen
bewegen, mit einander verbunden sind. Den Enden der Roͤhren gegenuͤber
befindet sich die kleine Spindel l, die an ihren Enden
mit Zapfen umlauft; und die in der Nabe ihres unteren Endes mit einem
Querstuͤke x versehen ist, dessen Enden mit den
Ventilen in Verbindung stehen, und welches folglich jede Bewegung, die ihm durch die
Spindel mitgetheilt wird, an die Ventile fortpflanzt. An derselben Spindel sind auch
die Feder g und die beiden Hebel h und i aufgezogen; leztere werden durch die
von der beweglichen Scheidewand k. und q* auslaufenden Arme in Bewegung gesezt. Die Hebel, Arme
und Federn wirken auf die bei Fig. 1, 2, 3 und 4 beschriebene Weise und
drehen die Spindel 1 um einen Theil eines Umganges zuruͤk oder
vorwaͤrts, so oft die bewegliche Scheidewand das eine Ende ihrer Bahn
erreicht hat. Die Bewegung wird dann durch die Querarme weiter an die Ventile
fortgepflanzt, und diese werden hiedurch veranlaßt die Enden der Roͤhren
abwechselnd zu eroͤffnen und zu verschließen.
Schließlich kommt zu bemerken, daß die Gehaͤuse der hier beschriebenen
Gasmesser aus Kupfer, Messing, Eisen oder anderen Metallen gegossen oder
gehaͤmmert, aus Thon verfertigt, oder auch aus irgend einem anderen
luftdichten Materiale erzeugt werden koͤnnen; und daß man die Scheidewand aus
Holz, Blech, Messing oder einem anderen Metalle und deren elastischen Theil aus
Rindsblase, Leder, Pergament, Kautschuk oder irgend einem luftdichten Zeuge
verfertigen kann. Der ganze Apparat arbeitet nicht nur in der senkrechten Stellung,
in der er hier abgebildet wurde, sondern man kann ihm auch eine horizontale oder
irgend eine beliebige Stellung geben. Endlich kann man die Haͤhne aus Messing
oder einem anderen Metalle und deren Zapfen aus Metall oder aus Glas
verfertigen.
Tafeln