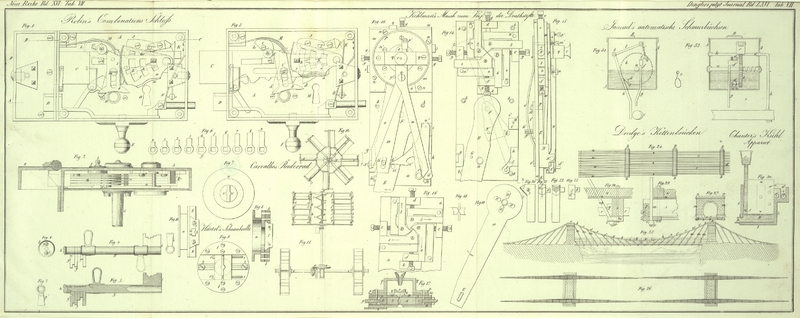| Titel: | Kehlmann's Maschine zur Verfertigung der Drahtstifte für Klaviermacher. |
| Fundstelle: | Band 66, Jahrgang 1837, Nr. LXXXVII., S. 411 |
| Download: | XML |
LXXXVII.
Kehlmann's Maschine zur
Verfertigung der Drahtstifte fuͤr Klaviermacher.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Kehlmann's Maschine etc. fuͤr Klaviermacher.
Vorliegende Maschine ist der Direction des Gewerbevereins in Hannover von dem
Instrumentenmacher Hrn. Kehlmann in Badbergen mitgetheilt worden, der ein hoͤlzernes
Modell derselben einsandte. Nach diesem hat Hr. Mechaniker Klindworth in Hannover fuͤr die
Werkzeugsammlung der hoͤheren Gewerbsschule in Hannover ein Exemplar
verfertigt, welches sich als sehr zwekmaͤßig bewaͤhrt hat. Nur wird es
der Festigkeit wegen gut seyn, einige Theile etwas staͤrker zu machen, als
sie in der Zeichnung nach dem Modelle dargestellt sind. – Hr. Kehlmann hat die Maschine nach
eigenem Entwurfe ausgefuͤhrt und mit dem besten Erfolge angewendet. Es war
ihm dabei nicht unbekannt, daß schon seit laͤngerer Zeit, namentlich in Wien,
Stifte mit vierekigen gepreßten Spizen verfertigt werden; allein uͤber die
Einrichtung und Leistung der dazu angewendeten Maschinen war ihm nichts bekannt
geworden. Vor 7–8 Jahren ersann und modellirte Hr. K. (damals in
Muͤnster) eine Maschine zu demselben Zweke, jedoch mit ganz anderem
Mechanismus; ob dieselbe jemals ausgefuͤhrt wurde, ist unbekannt. Die
Redaction kann hinzufuͤgen, daß eine Maschine zum Pressen der Drahtstifte
auch von dem Instrumentenmacher Pfeiffer in
Groß-Glogau erfunden worden ist, welche man in den Verhandlungen des Berliner Gewerbevereins (Jahrg. 1834, S. 50) beschrieben
und abgebildet findet, die aber der des Hrn. Kehlmann (troz einiger Aehnlichkeit, die sie
damit hat) in mehreren Hinsichten nachsteht.
Um die Einrichtung und Wirkung dieser kleinen Maschine leicht zu begreifen, muß man
auf folgende Betrachtungen zuruͤkgehen: Wenn ein Draht mit einer
gewoͤhnlichen Kneipzange abgekneipt wird, so sind die dadurch entstehenden
Querschnittsflaͤchen nur in so fern eben, als die
Zuschaͤrfungsflaͤche der Zange so ist. Da nun bekanntlich die meisten
Kneipzangen an der Schneide aͤußerlich flach, dagegen von der inneren oder
unteren Seite her schraͤg sind, so faͤllt auch nur eine der
Schnittflaͤchen ziemlich eben, die andere aber in Gestalt einer
stumpfwinkeligen, zweiseitig abgedachten Kante aus. Wuͤrde man eine Zange
gebrauchen, deren Schneiden von beiden Seiten gleichmaͤßig schraͤg
waͤren, so koͤnnte man es dahin bringen, beide Schnittflaͤchen
in der schon erwaͤhnten kantigen Form zu erhalten. Je stumpfer die
schneidenden Winkel der Zange sind, desto spizer wird der Winkel an jenen kantigen
Enden, welche durch das Abkneipen des Drahtes entstehen. Denkt man sich ferner eine
Vorrichtung, welche an vier Seiten des Drahtes zugleich
einschneidet, wie eine Kneipzange nur an zwei Seiten, so ist ganz klar, daß durch
den Schnitt zwei vierseitig zugespizte Enden entstehen
muͤssen, welche desto schlankere und schaͤrfere Spizen darbieten, je
stumpfwinkeliger die einschneidenden Kanten des Werkzeuges sind, was am Ende so weit
gehen kann, daß diese Kanten den Draht eigentlich nur abdruͤken, statt
wirklich zu schneiden. Hierauf gruͤndet sich die Construction der
Vorrichtung, von welcher hier die Rede ist, und die auf Tafel VII in mehreren Ansichten (nach einem auf die Haͤlfte
verjuͤngten Maaßstabe) abgebildet ist. Fig. 13 zeigt den
Grundriß oder die Ansicht von Oben; Fig. 14 ebenfalls den
Grundriß, jedoch nach Entfernung der obersten Bestandtheile, damit das Innere
sichtbar wird; Fig.
15 die Seitenansicht; Fig. 16 eine theilweise
Wiederholung von Fig. 14, nur mit etwas veraͤnderter Stellung einiger
Bestandtheile; Fig.
17 einen Querschnitt.
Die Grundlage der Maschine ist eine laͤnglich vierekige Eisenplatte a, welche mittelst der sechs Loͤcher b auf der Oberseite eines starken hoͤlzernen, mit
einer Schieblade versehenen Kastens befestigt wird, damit die verfertigten Stifte in
die Schieblade hinabfallen koͤnnen. Zunaͤchst sind auf der Platte
sieben eiserne Kloͤzchen c, d, e, f, g, h, i
festgenietet und in desselben zwei Loͤcher, ein laͤngliches, k, und ein rundes, l (Fig. 17),
angebracht. Ueber den vier Kloͤzchen c, d, e, f
liegt eine kleinere, mit a parallele Platte in, welche
durch vier Schrauben, n, befestigt ist. Leztere gehen
mit ihrem glatten, kein Gewinde enthaltenden Theile durch Loͤcher n' (Fig. 14) in den vier Eisenstuͤken o, so daß diesen die Schrauben als Drehungspunkte
dienen. Auf der Platte m ist durch drei Schrauben ein
flacher Ring p und auf diesem durch zwei Schrauben ein
Buͤgel q angebracht. Durch den in q eingeschraubten Trichter r
wird ein Draht von Oben her eingeschoben, den man so weit hinuntergleiten
laͤßt, daß er durch das Loch l mit dem Schieber
s in Beruͤhrung kommt, und durch denselben
weiter zu gehen verhindert wird. Als unter der Platte a
liegend, ist der Schieber s in Fig. 13 groͤßten
Theils gar nicht, in Fig. 14 nur durch
Punktirung angegeben; dagegen bemerkt man ihn in Fig. 15 und 17. Er besteht
aus einem Streifen Stahlblech, der bei s' um eine von
Unten in a eindringende Schraube sich drehen kann. Seine
Wirkung wird noch spaͤter sich ergeben. Zwischen dem Ringe p und dem Buͤgel q
befindet sich, auf der Oberflaͤche des ersteren liegend, eine kleine Schere
t, deren Blaͤtter nach Art der Kneipzangen
wirken, indem die Schneiden auf einander treffen und nicht neben einander
vorbeigehen (s. Fig. 17). Die Schraube u, welche das Gewinde
der Schere bildet, ist außer aller Verbindung mit dem unter ihr befindlichen Ringe
p, auf welchen uͤberhaupt die Schere nur lose
hingelegt ist. Leztere stuͤzt sich dagegen, wenn sie geschlossen wird, an
einen auf p stehenden Stift y. Von den zwei Armen v, w der Schere ist v durch die Schraube x an
dem Kloͤzchen g befestigt, w dagegen ist frei beweglich, und endigt in eine schraͤge
Flaͤche.
Die bisher erkaͤrten Theile dienen zum Abmessen und Abschneiden des Drahtes,
wobei die senkrechte Entfernung zwischen der Schere t
und dem Schieber s die Laͤnge des abgeschnittenen
Stuͤkes festsezt. Ein solches Stuͤk lifert zwei Stifte, indem es in
der Mitte seiner Laͤnge durch vier staͤhlerne Baken eingeklemmt und
abgepreßt wird; wobei die Gestalt der Baken mit sich bringt, daß die abgepreßten
Enden die Gestalt vierseitiger, einander zugekehrter Spizen erhalten. Um Stifte von
groͤßerer Laͤnge zu verfertigen, muß man gleichzeitig die Schere t von dem Ringe p erheben,
und unten den Schieber s von der Flaͤche der
Platte a entfernen, damit die gleich naͤher zu
beschreibenden Preßbaken stets in der Mitte zwischen t
und s bleiben, und die zwei aus einem Drahtstuͤke
gebildeten Stifte gleiche Laͤnge erhalten. Zu diesem Behufe geht durch das
eine etwas verlaͤngerte Blatt der Schere eine Schraube p' (Fig.
13, 15), welche sich auf die Oberflaͤche des Ringes p stuͤzt, folglich, wenn sie eingeschraubt wird,
die Schere erhebt. Und eine zweite Schraube m' reicht
durch p, m und a (mit dem
Muttergewinde in a) bis auf den Schieber s hinab, der vermoͤge seiner Elasticitaͤt
nachgibt, wenn die Schraube auf ihn druͤkt. Das Loch fuͤr leztere ist
in Fig. 14
bei o'
angegeben, wo man
zugleich bemerkt, wie das Stuͤk o ausgeschnitten
ist, um der Schraube nicht im Wege zu seyn.
Die Preßbaken sind von gehaͤrtetem Stahle, und liegen in dem Raume zwischen
den Platten m und a,
unmittelbar auf der lezteren. Man sieht sie in Fig. 14 mit 1, 2, 3, 4
bezeichnet; genauer erkennt man ihre Gestalt aus den verschiedenen Ansichten in Fig. 20, 21, 22 und 23. Hier ist
Fig. 20
die Ansicht von Oben; Fig. 21 die
Seitenansicht; Fig.
22 eine Wiederholung von Fig. 21, wo jedoch die
Spize 6 nach der Linie z, z weggeschnitten erscheint;
Fig. 23
die Ansicht von dem Ende 5 aus. Von den beiden Flaͤchen, welche in dem Winkel
bei 6 zusammenlaufen, ist die eine, mit 6, 7 bezeichnete von Oben und von Unten her
dergestalt abgeschraͤgt, daß auf ihr, in der Mitte der Dike, eine
stumpfwinkelige Kante oder Rippe entsteht, welche in Fig. 21 durch die Linie
6,7 und in Fig.
20 durch die doppelte Linie bezeichnet wird. Befinden sich alle vier Baken
in der Lage, welche Fig. 16 angibt, so lassen sie zwischen sich eine kleine quadratische
Oeffnung, welche in der Mitte ihrer senkrechten Hoͤhe am kleinsten ist und
sich gleichmaͤßig nach Oben und nach Unten wie ein vierseitiger Trichter
erweitert. Diese Gestalt der Oeffnung ist die nothwendige Folge von der vorhin
erklaͤrten Beschaffenheit der Flaͤchen 6,7 an den Baken; denn es sind
eben Theile jener doppelt abgedachten Flaͤchen, welche die Oeffnung
begraͤnzen. Damit aber die Baken in den Eken der Oeffnung einander
voͤllig genau beruͤhren koͤnnen, ist die Flaͤche 5, 6
eines jeden nach einem stumpfen Winkel vertieft ausgearbeitet (s. die Linie 5, 6 in
Fig. 21
und Fig. 23,
sowie die punktirte Linie in Fig. 20), so daß die
Rippe 6, 7 des benachbarten Bakens in jener Vertiefung stets Plaz findet, auch wenn
die Stellung der Baken sich veraͤndert. Jeder Baken kann sich zwischen einem
der Kloͤzchen c, d, e, f und einem der schon
erwaͤhnten Stuͤke o aus- und
einschieben; die durch die Kloͤzchen gehenden Schrauben 9 druͤken
mittelst o auf die Baken, so daß leztere in die
genaueste Beruͤhrung mit einander gesezt werden koͤnnen.
Wird bei der Stellung, welche Fig. 16 anzeigt, ein
Draht in die Oeffnung zwischen den Baken gestekt, und bewegen sich dann alle vier
Baken gleichzeitig in der Richtung der Pfeile, so verkleinert sich die Oeffnung mit
Beibehaltung ihrer quadratischen Form, folglich wird der Draht von vier Seiten durch
die Kante oder Rippen 6, 7 (Fig. 20–23)
eingedruͤkt und endlich abgequetscht, wodurch er sich in zwei zugespizte
Theile trennt, von welchen der obere die Spize abwaͤrts, der untere die
seinige aufwaͤrts kehrt (s. Fig. 18). Fig. 14 zeigt die Baken
in der Lage, wo die Oeffnung zwischen ihnen ganz verschwunden ist, was
natuͤrlich nicht der Fall seyn kann, so lange ein Draht darin stekt. Um die eben
erklaͤrte Wirkung von Neuem auf einen anderen Draht auszuuͤben,
muͤssen die Baken vorlaͤufig wieder in die Lage der Fig. 16 gebracht
werden.
Das Mittel zur Bewegung der Baken ist ein eiserner Hebel 10 (Fig. 19), der zur
Unterscheidung der Preßarm genannt werden soll. Er liegt in gleicher Flaͤche
mit der Platte m, in einem passenden Ausschnitte dieser
lezteren, und fuͤllt den Raum aus, welcher der Hoͤhe nach zwischen dem
Ringe p und den Preßbaken gelassen ist. Sein Ende ist
scheibenfoͤrmig, und enthaͤlt, außer einer runden (zum Durchgange des
Drahtes bestimmten) Oeffnung in der Mitte, vier etwas laͤngliche
Loͤcher 11, welche auf die mit 8 bezeichneten Stifte der Baken paffen. Stellt
man sich vor, daß sich Fig. 19 in eben genannter
Weise auf Fig.
20 gelegt, und daß dann der Preßarm 10 in der Richtung des Pfeiles (Fig. 19)
geschoben werde, so muß hiedurch eine Bewegung der Baken entstehen, deren Richtung
in Fig. 16
durch die Pfeile angegeben ist. Eine entgegengesezte Bewegung des Preßarmes hat auch
eine entgegengesezte der Baken zur Folge. Aber diese beiden Bewegungen
muͤssen in den erforderlichen Zusammenhang mit dem Oeffnen und Schließen der
Schere gebracht werden. Dieß erreicht man durch einen Mechanismus von Hebeln, der
hauptsaͤchlich aus Fig. 13 deutlich
wird.
Auf dem Kloͤzchen i ist der Drehungspunkt a' einer eisernen Platte a', b',
c', d', welche mit ihrem Stifte bei d' gegen
die Abschraͤgung am Ende des Scherenarmes w
wirkt. Ferner dreht sich auf dem Kloͤzchen h um
die Schraube e' der kleine Hebel e', f', welcher von der inneren Seite sich an den Arm w der Schere lehnt. F ist
der Drehungspunkt eines langen eisernen Hebels E,
welcher des Raumes wegen in der Zeichnung abgebrochen erscheint, im Ganzen aber eine
Laͤnge von 22'' hat, einschließlich des
hoͤlzernen Heftes, welches sich daran befindet. Eine Schraube, welche durch
das laͤngliche Loch G des Preßarmes in den Hebel
E (bei G', Fig. 14) geht,
verbindet diese beiden Theile mit einander. Unweit davon steht auf E ein diker Stift 13, von welchem in der oberen
Haͤlfte ein Theil mondviertelartig weggefeilt ist. Endlich haͤngt mit
dem Haupthebel E eine unter der Platte a liegende Vorrichtung zusammen, welche in Fig. 15 und
(punktirt) in Fig.
14 zu bemerken ist. Dieselbe besteht aus einer kleinen Platte i', welche auf der Achse F
des Hebels mittelst der Schraubenmutter 12 befestigt ist, und mit ihren zwei Stiften
g', h' den schon fruͤher beschriebenen
Schieber s, s' umfaßt. Der Hebel E und diese Platte i' machen alle ihre
Bewegungen gemeinschaftlich. – Fig. 13 stellt alle
Theile des Mechanismus in dem Zustande vor, worin sie sich in dem Augenblike
befinden, nachdem ein
Paar Stifte fertig geworden sind. Zunaͤchst muß nun der Haupthebel E in der Richtung des Pfeils, also von g gegen h hin, bewegt
werden. Dadurch oͤffnen sich (wie oben schon erklaͤrt wurde) die
Preßbaken und nehmen die Stellung von Fig. 16 an, weil der
Preßarm 10 vermoͤge der Verbindung bei G
mitgezogen wird: so ist den beiden eben verfertigten Drahtstiften gestattet, in den
Kasten der Maschine hinabzufallen. Ferner stoͤßt der Stift 13 an den kleinen
Hebel e', f', und bewegt mittelst desselben den Arm w so, daß die Schere sich oͤffnet. Indem w den Stift d' vor sich
hertreibt, wird auch die Platte, worauf lezterer steht, dergestalt um den Punkt a' gedreht, daß ihr Haken c'
sich links vor den Stift 13 legt. Endlich nimmt der Stift g' der Platte i' den Schieber s mit sich, und stellt ihn so, daß durch denselben die
Oeffnung l der Platte a
(Fig. 15)
verschlossen wird.
Jezt wird ein Draht von Oben durch den Trichter r, durch
die geoͤffnete Schere t, so wie durch die
Oeffnung des Preßarmes 10, der Preßbaken 1, 2, 3, 4 und der Platte a (vergl. Fig. 15) eingeschoben,
bis er auf den Schieber s stoͤßt, und folglich
nicht weiter gehen kann.
Wenn hierauf der Haupthebel E wieder zuruͤk in die
Lage gebracht wird, welche er in Fig. 13 hat, so macht
sich zuerst der Stift 13 mit seinem abgefeilten Theile von dem Haken c' los, und noͤthigt dabei den Stift d', durch seine Wirkung auf den Arm w die Schere zu schließen, welche also den Draht
abschneidet. Die Preßbaken naͤhern sich einander und zertheilen das zwischen
ihnen befindliche Drahtstuͤk in zwei zugespizte Stifte. Der Stift h' entferne den Schieber s
von dem Loche l der Platte a, damit die beiden fertigen Drahtstifte bei der Wiederoͤffnung der
Preßbaken ungehindert in die Schieblade fallen koͤnnen.
Die Bewegung des Hebels E wird ohne Anstrengung mit einer
Hand bewirkt; die andere Hand gebraucht man, um den Draht nachzuschieben. Man kann
neben der Maschine eine Stange mit daran befindlichen Ringen senkrecht anbringen, um
in lezteren einen Vorrath von geraden, in bequemer Laͤnge zugeschnittenen
Eisen- oder Messingdrahten aufzustellen. Einer dieser Draͤhte wird
dann durch den Trichter zwischen die Schere und die Preßbaken gestellt und im
erforderlichen Maaße mit gelindem Druke nachgefuͤhrt. Da der Hebel leicht 40
bis 45 Bewegungen in einer Minute machen kann, so lassen sich ohne besondere
Anstrengung und Uebung der arbeitenden Person, in einer Stunde 5000 Stifte
verfertigen; wenn man fuͤr kurze Zeit eine groͤßere Anstrengung nicht
scheut, so kann die Zahl selbst auf 7200 gesteigert werden, was in jeder Secunde
eine Bewegung des Hebels
(hin und zuruͤk) erfordert. Faͤnde man fuͤr lange anhaltenden
Gebrauch die Bewegung unmittelbar mit der Hand nicht bequem genug, so koͤnnte
sehr leicht der Haupthebel durch eine Zugstange an einen Krummzapfen
eingehaͤngt werden, dessen Achse mit Kurbel und Schwungrad zum Drehen
eingerichtet waͤre.
Nicht nur die Stegstifte fuͤr Klavier-Instrumentenmacher, sondern auch
Drahtstifte zu anderem Gebrauche koͤnnen auf der beschriebenen Maschine
verfertigt werden. Sie fallen sehr regelmaͤßig aus. Die gepreßten Spizen sind
schoͤner und schaͤrfer, als man sie auf irgend eine andere Weise
erzeugen kann; zugleich besizen sie eine groͤßere Haͤrte als gefeilte
oder geschliffene Spizen, weil das Metall durch den Druk der Preßbaken stark
verdichtet wird.Seit einiger Zeit kommen aus den Fabriken im Bergischen die
gewoͤhnlichen kleinen Drahtnaͤgel ebenfalls mit gepreßten
Spizen in den Handel.
(Mittheil. des Hannoͤver'schen Gewerbevereins, Nr. 12 und 13.)
Tafeln