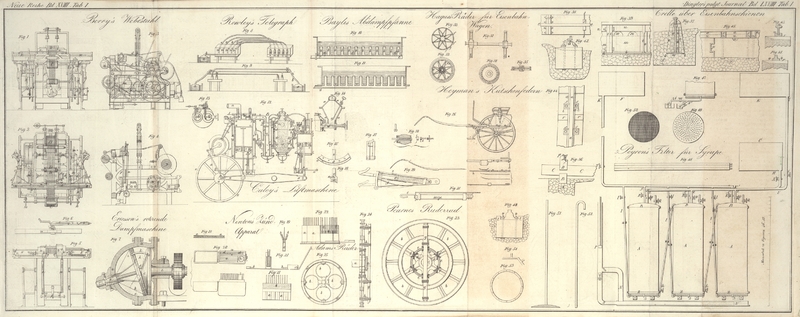| Titel: | Verbesserungen an den mechanischen oder Kunstwebstühlen, worauf sich Miles Berry, Ingenieur und Zeichner von Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, auf die von einem Ausländer erhaltene Mittheilung, am 5. Decbr. 1835 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. VIII., S. 26 |
| Download: | XML |
VIII.
Verbesserungen an den mechanischen oder
Kunstwebstuͤhlen, worauf sich Miles Berry, Ingenieur und Zeichner von
Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, auf die von einem Auslaͤnder
erhaltene Mittheilung, am 5. Decbr. 1835 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts. Februar 1838, S.
265.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Berry's verbesserte Kunstwebstuͤhle.
Der Zwek der vorliegenden Verbesserungen ist, den mechanischen Webstuhl mit solchen
Vorrichtungen auszustatten, daß man mit ihm in Ketten, welche mit Seiden-,
Baumwoll-, Flachs-, Wollen- und anderen Faͤden
aufgezogen sind, einen aus Borsten, Roßhaar, Fischbein, Binsen, Stroh, Rohr oder
anderen kurzen Materialien bestehenden Eintrag einweben kann.
Fig. 1 ist ein
Frontaufriß eines Webstuhles dieser Art, welcher durch eine rotirende Kraft in Gang
gesezt werden kann. Fig. 2 zeigt denselben in einer horizontalen Ansicht von Oben betrachtet.
Fig. 3 ist
ein Endaufriß; Fig.
4 ein Querdurchschnitt, welcher beinahe durch die Mitte der Maschine und
parallel mit Fig.
3 genommen ist. Fig. 5 gibt eine
Ruͤkenansicht.
Die Treibwelle A, an der sich die zum Betriebe der
arbeitenden Theile dienenden Zahnraͤder befinden; der Kettenbaum B; der Werkbaum C; die Lizen
oder Geschirre D; die Lade E; der Knechthebel F, der durch die an der unteren
Welle G befindlichen Excentrica seine Bewegung
erhaͤlt; die an eben dieser Welle befindlichen, zur Bewegung der
Geschirrhebel oder Tretschaͤmel H befindlichen
Excentrica: alle diese und noch einige andere, in der Zeichnung ersichtliche Theile
sind so bekannt, daß sie keiner weiteren Beschreibung beduͤrfen.
Die neuen Theile sind die Buͤchsen oder Behaͤlter, worin sich die
Borsten, Haare oder sonstigen als Eintrag zu verwendenden Substanzen befinden; die
Zangen, womit diese Substanzen aus den Buͤchsen ausgezogen und zwischen die
Kettenblaͤtter gelegt werden; die Arme oder Hebel und Daͤumlinge,
welche zur Bewegung dieser Zangen dienen; und der Mechanismus, durch den der Wurf
der Schuͤze in gewissen Zeitraͤumen unterbrochen wird. Ich will, um
deren Anwendung zu zeigen, andeuten, wie sich mit deren Huͤlfe ein
Cravattenzeug, d.h. ein Zeug, in welchen mit dem Eintrage stellenweise Borsten
eingewebt werden, fabriciren laͤßt. Ich bemerke im Voraus nur, daß in diesem
Falle, so wie uͤberhaupt, wenn das Fabricat nur eine geringe Breite bekommen
soll, die Ketten, Rietblaͤtter, Geschirre und uͤbrigen
entsprechenden Theile gleichfalls nur eine geringe Breite zu haben brauchen.
Die die Borsten enthaltenden Buͤchsen a, a, welche
gegen 6 Zoll Laͤnge, 3/8 Zoll Breite und 4 Zoll Tiefe haben sollen, sieht man
am Ruͤken der Lade angebracht. Die Borsten werden in der Richtung des
Schuͤzenwurfes gerade und so in diese Buͤchsen gelegt, daß sie mit
ihren Enden etwas weniges uͤber die offenen, den Sahlbaͤndern
zunaͤchst gelegenen Enden der Buͤchse hinausragen, wie man dieß in
Fig. 5
angedeutet sieht. Ein bleiernes Gewicht, welches man schraͤg in jede der
Buͤchsen legt, druͤkt die Borsten dicht zusammen. Die Zangen
koͤnnen demnach die Enden der Borsten erfassen, sie einzeln aus den
Buͤchsen ausziehen, und sie in dem Maaße, als das Weben von Statten geht, in
das Gewebe einlegen.
Die Zangen b, b, von denen man in Fig. 6 ein einzelnes Paar
in etwas groͤßerem Maaßstabe abgebildet sieht, sind gleichfalls am
Ruͤken der Lade angebracht; jede derselben schiebt sich seitwaͤrts in
dem Falze einer Messingplatte, die, wie Fig. 5 zeigt, am
Ruͤken der Lade befindlich ist. Die in ihren Falzen gleitenden Zangen werden
hinter dem Rietblatte quer durch die Maschine in die an den
gegenuͤberliegenden Seiten befindlichen Borstenbuͤchsen getrieben; und
zwar mittelst der Hebel oder Arme c, c, die, wie Fig. 2 und 3 zeigen, mit
den Hebeln d, d ein Gefuͤge bilden. Jeder dieser
lezteren dreht sich bei e um einen in einen Arm oder
eine Leiste eingelassenen Arm; und an dem Ende eines jeden derselben befindet sich
eine kleine Rolle, die bei den Bewegungen der Lade in dem geraden Falzen f des Laufbrettes auf und nieder steigt, und dadurch den
Hebel d verhindert die Zange in Bewegung zu sezen. Dieß
ist der Fall, wenn nur der Einschußfaden allein von der Schuͤze durch die
Kettenblaͤtter geworfen wird; wenn aber zugleich Borsten eingeschlagen werden
sollen, so wird das bewegliche Stuͤk g, welches
sich um den in das Laufbrett eingelassenen Stift h
dreht, wie Fig.
2 andeutet, auf die eine Seite geschoben, wodurch der gerade Falzen f geschlossen, und dafuͤr der im Bogen laufende
Falzen i geoͤffnet wird. Die am Ende des Hebels
d befindliche Rolle laͤuft also bei der
Bewegung der Lade nach Ruͤkwaͤrts in den krummlinigen Falz i, und veranlaßt hiedurch, daß die Zange hinter dem
Rietblatte durch die Kettenblaͤtter geworfen wird.
Die Verschiebung des Stuͤkes g an dem Laufbrette
wird durch einen Zapfen k bewerkstelligt, der, wie Fig. 1 und 3 zeigen, an
dem Ende des Hebels l angebracht ist. Dieser Zapfen k wird naͤmlich von einer Feder gegen die
Flaͤche des Muschelrades m angedruͤkt,
dessen Erhabenheiten und Einschnitte den von den Zangen b,
b zu vollbringenden Bewegungen entsprechen. Zu jeder Seite der Maschine ist eines der
Muschelraͤder m an der Welle j angebracht, damit die Bewegung der Zangen von beiden
Seiten der Lade her bewirkt werden kann. Sind beide Raͤder m so an ihrer Welle fixirt, daß die Erhabenheiten beider
mit einander correspondiren, so werden beide Zangen zwischen den
Kettenblaͤttern durchgehen und gleichzeitig eine Borste zwischen dieselben
einlegen; wechseln hingegen die Erhabenheiten beider Raͤder mitsammen ab, so
werden die Zangen an jeder Seite bei den abwechselnden Schlaͤgen der Lade in
Bewegung kommen. Diese Abaͤnderungen sind, was die Zahl der in das Gewebe
einzufuͤhrenden Borsten betrifft, ganz unter der Controle des Arbeiters und
von der Beschaffenheit des zu erzielenden Fabricates abhaͤngig. Um diese
Abaͤnderungen noch mehr zu erleichtern, kann man durch leichte Verschiebung
der Stellung des Zapfens k auch anders eingeschnittene
Muschelraͤder m* in Anwendung bringen.
Damit nach dem jedesmaligen Durchwerfen der Zangen b, b
durch die Kettenblaͤtter denselben ein anderer Theil des Borstenpaketes
dargeboten werde, werden die Buͤchsen a, a auf
und nieder bewegt. Es geschieht dieß mit Stangen n, n,
welche an den unteren Theilen der Buͤchsen festgemacht sind, und deren untere
Enden eine Reibungsrolle tragen, welche auf dem Umfange der Excentrica oder
Herzraͤder o, o ruht. Leztere befinden sich an
einer kleinen Welle, die am Ruͤken der Schwerter der Lade aufgezogen ist, wie
aus Fig. 5
erhellt. Ihre Umlaufsbewegung erhalten diese Herzraͤder o, o durch ein an derselben Welle befindliches Sperrrad
p, in welches ein Sperrkegel q eingreift, den man in Fig. 4 an einem Querriegel
des Maschinengestelles angebracht sieht. Die schwingenden Bewegungen der Lade
bewirken, daß der Sperrkegel bei jedem Schlage der Lade das Sperrrad p um einen Zahn umtreibt. Die Stangen n, n werden demnach durch die allmaͤhliche
Umlaufsbewegung der Herzraͤder auf und nieder bewegt; und hiedurch erhalten
die Buͤchsen a, a zu dem oben angegebenen Zweke
gleichfalls eine langsame Auf- und Niederbewegung.
Die Schließung der Zangenspizen geschieht mittelst einer Feder r, die, wie Fig. 6 andeutet, den
Schwanz einer ihrer Wangen bildet. Das Oeffnen hingegen geschieht mittelst des
Stuͤkes s, welches sich um einen unter dem
Schwanze der unteren Wange befindlichen Zapfen dreht. Die Zangenspizen sind vom
Ruͤken her durch eine Platte geschuͤzt. Wenn die Zangen durch die
Schuͤzenbahn geworfen werden, so sind deren Spizen geoͤffnet, indem
die Stuͤke s dadurch, daß die Zange auf dem
Ruͤkwege auf einen kleinen, an dem Ruͤken der Lade fixirten Zapfen
oder Finger t traf, in die geradstehende Stellung geriethen, in der man sie
in Fig. 6
sieht. Sind jedoch die offenen Zangenspizen in die Borstenbuͤchsen
eingedrungen, so treibt ein anderer, gleichfalls am Ruͤken der Lade
befestigter Finger v das Stuͤk s unter dem Schwanze der Zange hinweg in die Stellung,
welche in Fig.
6 durch Punkte angedeutet ist, wodurch die Spizen so geschlossen werden,
daß sie die Borsten festhalten. Beim Zuruͤkkehren der Zangen werden die
Borsten zum Behufe des Einziehens derselben zwischen die Kettenblaͤtter
festgehalten, und erst, wenn die Zangen beinahe das Ende ihrer Bewegung erreicht
haben, trifft der Schwanz oder das Ende der unteren Wange auf den Zapfen u, der die Wangen oͤffnet, damit die Borsten
ausgelassen und als Eintrag eingelegt werden. Die Lade vollbringt hierauf ihren
Schlag, womit die Borste als Eintrag untergebracht ist.
Um das Eintragen der Borsten, nachdem eine hinreichende Laͤnge gewebt worden
ist, zu unterbrechen, sind an den Enden der Welle des Werkbaumes C, wie man in Fig. 1, 2 und 3 sieht, ein Paar
Muschelraͤder w angebracht, deren Umfang gegen
die oberen Enden der Hebel x, x, welche sich an Zapfen,
die in den Seitengestellen des Webstuhles fixirt sind, aufgezogen befinden,
umlaͤuft. An einem dieser Hebel x ist, wie in
Fig. 3 zu
sehen, ein Arm y befestigt, dessen anderes Ende mit dem
an dem Seitengestelle aufgezogenen Winkelhebel z in
Verbindung steht. Das obere Ende dieses Hebels z ist an
einem Federarme a, Fig. 3, festgemacht, der
sich an einer Klauenstange b, welche sich in der hohlen
Welle des Muschelrades m schiebt, bewegt. Diese
Klauenstange steht mit einem an derselben Welle befindlichen Muschelrade c in Verbindung, welches zu einem Theil an der Welle
fixirt ist, waͤhrend es sich mit dem anderen Theile daran schiebt, und
dadurch zur Fuͤhrung des Hebels d eine gerade
oder eine im Zikzak laufende Fuge bildet. Der Hebel d
hat seinen Drehpunkt an einem Zapfen, der sich an einem von dem Gestelle
auslaufenden Arme e befindet. Das eine Ende desselben
bewegt sich mit einem Knaufe in der Kehle oder Fuge des Muschelrades c, waͤhrend sich das andere gabelfoͤrmige
Ende an einem an der Welle G befindlichen Schieber f bewegt. Wenn das Ende des Hebels x in die Auskerbung des Muschelrades w einfaͤllt, so wird das Klauenmuschelrad c in eine solche Stellung gezogen, daß es fuͤr
den Knauf des Hebels d eine gerade laufende Fuge bildet,
wo dann der Webstuhl nur glatten Zeug webt. Wenn sich hingegen der cylindrische
Theil des Muschelrades w gegen den Hebel x bewegt, so wird dieser Hebel zuruͤkgetrieben
und das Klauenmuschelrad so verschoben, daß es fuͤr den Knauf des Hebels d eine im Zikzak laufende Fuge bildet. Hieraus folgt,
daß das entgegengesezte Ende dieses Hebels den an der Welle G
befindlichen Schieber f verschiebt, und die
Daͤumlinge g, welche fruͤher die
Knechthebel in Bewegung sezten, außer Thaͤtigkeit bringt: so daß die Bewegung
der Schuͤze unterbrochen wird, und die Zange allein einen Einschuß aus
Borsten eintraͤgt. Soll uͤbrigens der Einschuß sowohl aus Garn als aus
Borsten bestehen, so ist der Klauenapparat ganz entbehrlich.
Wenn die in dem Muschelrade w befindliche Auskerbung dem
Hebelende sich vorwaͤrts zu bewegen gestattet, so zieht dieses, wie Fig. 3 zeigt,
die horizontale Stange h mit sich, wo dann der
Faͤnger i, der den Hebel l sperrt und die Wirkung des Muschelrades m
auf den Bolzen k verhuͤtet, vorwaͤrts
kommt. Dieser Theil des Apparates kommt zum Behufe der Erzeugung der glatten Stellen
des Fabricates in Thaͤtigkeit.
Es versteht sich von selbst, daß die zur Abaͤnderung des Fabricates bestimmten
Theile des Webstuhles auf mannigfache Weise modificirt, und durch verschiedene
Mechanismen hervorgebracht werden koͤnnen. Ich binde mich daher keineswegs an
bestimmte Formen, Dimensionen und Stellungen, sondern behalte mir vor, alles dieß je
nach der Art und Qualitaͤt des gewuͤnschten Fabricates
abzuaͤndern. Meine Anspruͤche gruͤnden sich im Allgemeinen auf
Ausstattung des Kunstwebstuhles mit Mechanismen, mit deren Huͤlfe Borsten,
Draͤhte, Haare, Fischbein, Stroh, Rohr, Binsen und andere derlei Stoffe als
Eintrag eingewebt werden koͤnnen, und auf Anhaltung und Abaͤnderung
der Thaͤtigkeit dieser Mechanismen sowohl als der Schuͤze zum Behufe
des Einwebens verschiedener Quantitaͤten dieser Materialien in das Gewebe.
Wenn der Webstuhl mit allen diesen Theilen gehoͤrig ausgestattet ist, so kann
er ohne Beihuͤlfe von Menschenhaͤnden alle Fabricate der angedeuteten
Art liefern.
Tafeln